Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Gang der Untersuchung
2. Konflikte im Unternehmen
2.1 Konflikttheoretischer Hintergrund
2.1.1 nach Hobbes
2.1.2 nach Marx
2.1.3. nach Simmel
2.1.4. nach Coser
2.1.5. nach Dahrendorf
2.2 Der Konfliktbegriff
2.3 Konflikttypologien
2.3.1 Intrapersonale Konflikte
2.3.2 Interpersonale Konflikte
2.3.2.1 Sachkonflikte
2.3.2.2 Beziehungskonflikte
2.3.2.3 Strukturkonflikte
2.3.2.4 Rangkonflikte
2.3.2.5 Verteilungskonflikte
2.3.2.6 Interessenskonflikte
2.3.2.7 Wertkonflikte
2.3.2.8 Informationskonflikte
2.4 Konfliktentstehung
2.4.1 Bedürfnisbedrohung
2.4.2 Kommunikationsstörungen
2.5 Konflikteskalation
2.6 Auswirkung von Konflikten
2.6.1 .aufdas Unternehmen
2.6.2 .aufden Einzelnen
2.7 Konflikt: Risiko und Chance
3. Wirtschaftsmediation
3.1 Definition
3.2 Geschichte der Mediation
3.3 Abgrenzung zu anderen Verfahren
3.3.1 Gerichtsverfahren
3.3.2 Schiedsgerichtsverfahren
3.3.3 Schlichtungsverfahren
3.4 Das Mediationsverfahren
3.4.1 Pre-Mediation
3.4.2 Main-Mediation
3.4.3 Post-Mediation
3.5 Der Mediator
3.5.1 Rolle
3.5.2 Innere Haltung
3.6 Verbreitung und Akzeptanz von Wirtschaftsmediation in deutschen Unternehmen
4. Conclusio und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abb.1: Häufigkeit typischer Konflikte
Abb.2: Häufigkeit von internen und externen Konflikten
Abb.3: Bedürfnispyramide nach Maslow
Abb.4: Nachrichtenquadrat und Vier-Ohren-Modell
Abb.5: Stufen der Eskalation nach Glasl
Abb.6: Konfliktkosten
Abb.7: Chinesisches Zeichen für „Konflikt“
Abb.8: Kostenvergleich derVerfahren
Abb.9: Struktur der Mediation
Abb.10: Eignung der Mediation
Abb.11: Einsatz von Konfliktbearbeitungsverfahren im Vergleich
Abb.12: Zuordnung von Verfahrensvorteilen
Abb.13: Mittlere Vorteilswerte derVerfahren
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
„Solch trüben Himmel klärt ein Sturm nur auf.“ Shakespeare, William („König Johann“)
In unserem bisherigen Leben sah sich jeder von uns mit nicht nur einem Konflikt konfrontiert. Konflikte in der Beziehung oder Ehe, Konflikte am Arbeitsplatz, Konflikte unter Freunden und sogar Konflikt zwischen völlig fremden Personen, der vielleicht nur wegen einem nicht gesetzten Blinker entstanden ist. Nicht zu vergessen der Konflikt mit sich selbst, sei es wegen der täglichen bilateralen Entscheidungen die wir zu treffen haben oder des durch Freud bekannt gewordenen „Über-Ich“, das uns permanent überwacht und uns zur Einhaltung der gesellschaftlichen Normen „zwingt“ - vorausgesetzt man hat ein Gewissen. Konflikte, Antagonismus, Feindschaft und Hass gibt es seit Menschengedenken und solange Gesellschaften existieren wird es sie auch immer geben. Dabei reicht das Spektrum von kurzweiligen Differenzen wegen einer falschen Bemerkung bis hin zu Kriegen die fast ganze Völker ausrotten. Ebenso kann die Zahl der Beteiligten massiv variieren. Sie reicht von zwei Personen bis hin zu ganzen Nationen.
Konflikt ist also etwas das uns umgibt. Und damit sind nicht nur unsere eigenen Konflikte gemeint, die wir auszutragen oder zu ertragen haben. Dank des medialen Netzes, das unsere Welt umgibt können wir ebenfalls an den Konflikten Anderer partizipieren. Wer Zeitung liest oder Nachrichten per Fernsehen oder Internet verfolgt kann teilhaben wie Konflikte im Nahen-Osten entstehen, oder Arbeitnehmer sich öffentlich für ihre Interessen einsetzen indem sie streiken. Aber was bedeutet es einen Konflikt zu haben? Sind Konflikte eine „dysfunktionale Störung“ so wie Parsons sie bezeichnet? (vgl. Bonacker 2008: 267) Oder aber kann Konflikt als „Motor einer notwendigen gesellschaftlichen Veränderung“ gesehen werden? (Bonacker 2008: 9 f.; vgl. auch Dahrendorf 1972: 78) Könnte es ein Leben ohne Konflikte geben? Und wenn ein Konflikt entstanden ist, wie lässt er sich wieder lösen?
Diese Arbeit soll sich vornehmlich mit dem sozialen Konflikt beschäftigen, also weniger mit intrapersonalen Konflikten. Das Hauptaugenmerk soll auf Konflikte in Unternehmen gerichtet sein, obgleich diese Arbeit auch als eine allgemeine Konfliktbetrachtung angesehen werden kann. Das rührt daher, dass Konflikte, egal ob im Unternehmen oder im Privatleben häufig aus sehr ähnlichen Motiven heraus entstehen, auch wenn die Streitgegenstände unterschiedlich sind.
Ein weiterer Hauptteil dieser Arbeit befasst sich mit der Bearbeitung von Konflikten. Genauer gesagt mit der außergerichtlichen Konfliktbearbeitung durch Wirtschaftsmediation. Es soll aufgezeigt werden, dass Konflikte nicht immer gleich vor Gericht ausgetragen werden müssen, dass es einen Weg gibt, der weg führt von der „Wir-sehn-uns-vor- Gericht-Kultur“ hin zu einer Streitkultur, deren Inhalt darin besteht, alle Parteien zufrieden zu stellen. Diese Arbeit soll zeigen, was (Wirtschafts-)Mediation ist und was sie leisten kann, sowie welches Potential Konflikte haben können, wenn sie durch Konsens gelöst werden.
1.1 Gang der Untersuchung
Die vorliegende Arbeit besteht, wenn man so will, aus zwei Teilen. Der erste Teil befasst sich mit Konflikt (im Unternehmen). Hier soll zu Anfang ein konflikttheoretischer Hintergrund aufgezeigt werden, sowie ein Versuch unternommen werden den Konflikt definito- risch und begrifflich fassbar zu machen. Ebenso sollen Konflikttypologien erläutert werden, wobei nicht auf alle eingegangen werden kann, da dies zu umfassend wäre. Vielmehr soll eine bestimmte Auswahl an Typologien erläutert werden. Über die Entstehung und die Dynamik eines bereits bestehenden Konflikts wird in den Punkten 2.4 und 2.5 eingegangen. Auch auf die Auswirkung von Konflikten bei Nichtbearbeitung derselben, zum Einen auf das Unternehmen und zum Anderen auf den Einzelnen, d.h. den Arbeitnehmer, aber auch den Arbeitgeber, wird eingegangen. Am Ende des ersten Teils soll aufgezeigt werden, welches Risiko, aber auch welche Chance der Konflikt birgt.
Der zweite Teil der Arbeit geht auf die Bearbeitung von Konflikten ein. Im Rahmen dieser Arbeit auf die außergerichtliche Streitbeilegung, genauer gesagt auf die Wirtschaftsmediation. Wirtschaftsmediation soll definiert und erläutert werden. Außerdem soll kurz der geschichtliche Hintergrund der Mediation beleuchtet werden. Da Mediation, wie bereits erwähnt, ein außergerichtliches Verfahren ist, folgt eine Abgrenzung zu anderen gerichtlichen, aber auch zu anderen außergerichtlichen Verfahren. Da das Mediationsverfahren nach einem bestimmten drei Phasen-Modell abläuft, wird es in Punkt 3.4 ausführlich dargestellt. Auch auf die Rolle und die Haltung des Mediators bzw. der Mediatorin, die im Mediationsverfahren von entscheidender Bedeutung ist, wird eingegangen. Der Punkt 3.6 soll anhand der Ergebnisse der drei PricewaterhouseCoopers-Studien Aufschlüsse über die Verbreitung, Annahme und Anwendung von Mediation in deutschen Unternehmen geben. Abschließend sollen in einer Conclusio die Erkenntnisse zusammengefasst werden und ein Ausblick auf die Zukunft der Wirtschaftsmediation erfolgen.
2. Konflikte im Unternehmen
Wie bereits erwähnt gibt es Konflikte in fast allen gesellschaftlichen Bereichen - so auch in der Arbeitswelt. Konflikte zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, unter Kollegen, zwischen zwei Unternehmen oder zwischen Kunden und Unternehmen. Ebenso zahlreich wie die Beziehungen in der Wirtschaft, die konfliktär sein können, sind die Gründe für die Entstehung dieser Konflikte. Es treffen die unterschiedlichsten Persönlichkeiten und Charaktere mit verschiedenen Ansichten und Arbeitsweisen aufeinander. Und obgleich wir diese Art der Konflikte nur selten öffentlich verfolgen können, zum Beispiel in Form von Massenstreiks, existieren sie. Und sie kosten die deutsche Wirtschaft jährlich Beträge in Millionenhöhe. Sei es durch Arbeitszeitverlust, Gerichtskosten oder Mitarbeiterfluktuation. Warum es Konflikte gibt, wie sie entstehen, sich entwickeln und welchen Schaden sie bei Nichtbearbeitung anrichten, soll im Folgenden aufgezeigt werden.
2.1 Konflikttheoretischer Hintergrund...
Eine einheitliche Konflikttheorie gibt es nicht. Es kann sie auch nicht geben, ist doch Konflikt als soziales Phänomen viel zu vielschichtig, um ihm in einer allgemeinen Theorie gerecht zu werden. Eine solche Theorie würde nämlich nach Bonacker „automatisch die andere Seite, also den Konsens, [vernachlässigen], die sie aber benötigt, um von Konflikt sinnvoll sprechen zu können.“ (Bonacker 2008: 15) Obwohl der Konfliktbegriff in den Sozialwissenschaften eine große Rolle spielt, „bezeichnet er doch eine grundsätzliche Möglichkeit der Form des Sozialen“ (Bonacker 2008: 15), ist die Konfliktsoziologie doch eher den jüngeren Disziplinen zuzurechnen. Dennoch gibt es mittlerweile eine Vielzahl von soziologischen Konflikttheorien von verschiedensten Theoretikern. Einige der bekanntesten und wichtigsten Theoretiker werden nachfolgend aufgeführt.
2.1.1 nach Hobbes
Die Konflikttheorie von Thomas Hobbes (1588-1679) ist die älteste Theorie die hier dargestellt werden soll. Hobbes nennt Konkurrenz, Misstrauen und Ruhmsucht als die drei Hauptursachen für konfliktäres Verhalten. Allerdings sind diese nicht dem Charakter des Menschen zuzuschreiben, sondern sie beschreiben Interdependenzgeflechte. Es gibt eine allumfassende Ursache-Wirkungs-Kette, d.h. „bestimmte Einflüsse rufen bestimmte Reaktionen hervor.“ (Noetzel 2008: 35) Auf das Individuum angewandt bedeutet das, dass es auf andere Individuen auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. Im Falle der Nichtexistenz einer staatlichen Regulierung bedeutet dies wiederum, dass der Einzelne bei seiner Selbsterhaltung nur sich selbst vertrauen kann. Er muss sich also im Falle eines Angriffs selbst verteidigen. Dabei resultieren die Ursachen des Konflikts nicht aus der Natur des Menschen, sondern aus dem Zustand seiner Soziabilität. (vgl. Noetzel 2008: 35) Das heißt, aus der Neigung heraus, den Kontakt zu anderen Menschen leicht und gerne herzustellen und somit auch der Fähigkeit zu vertrauen. (vgl. Fuchs-Heinritz et al. 1994: 610)
Folglich entsteht der Zustand der Abwehr und Konkurrenz aus einer lückenhaften Gesellschaftsbildung. Ein schlechtes Menschenbild, geprägt von Ruhmsucht, Rachsucht, Neid und Hochmut, kann nach Hobbes nur im Zustand unzureichender Gesellschaftsbildung bzw. Staatsbildung in Erscheinung treten. (vgl. Noetzel 2008: 35)
Hobbes glaubt an eine „in der Natur enthaltene^] Vernunft der friedlichen Konfliktbeilegung.“ (Noetzel 2008: 36) In dieser hat der Mensch es als seine Pflicht anzusehen, den Frieden zu wahren. (vgl. Noetzel 2008: 36) Ist es dem Menschen jedoch nicht möglich, diesen Frieden zwanglos zu erreichen, „so darf er sich alle Hilfsmittel und Vorteile des Kriegs verschaffen und sie benützen.“ (Hobbes 1984: 99 f.) Die Fähigkeit Konflikte friedlich beizulegen kann der Mensch allerdings nur zur Anwendung bringen, wenn ein politisches System ihm Schutz gewährt. Nur dann kann der Einzelne sich sicher fühlen, wenn eine höhere Macht ihn von der Notwenigkeit befreit sich selbst zu verteidigen. Dies fordert jedoch vom Individuum sich mit anderen Individuen zusammenzuschließen und sich einer übergeordneten Instanz unterzuordnen. (vgl. Noetzel 2008: 36) Diese Rolle übernimmt Hobbes berühmter „Leviathan“. Folglich dient Macht als neues Instrument der Friedenssicherung. (vgl. Noeztel 2008: 38)
Bevor es zur Vergesellschaftung kam, befanden sich die Menschen im Naturzustand. Dieser Naturzustand war im Wesentlichen ein Konfliktzustand in dem jeder den anderen als potentielle Gefahr wahrnahm. War der Einzelne in diesem Kriegszustand nicht jederzeit bereit sich zur Wehr zu setzen, gab er sich damit selbst auf. (vgl. Noetzel 2008: 36) Allerdings zehrt die ständige Angst und Wachsamkeit so am Menschen, dass keine Ressourcen bleiben, um Zeit für Arbeit oder Kunst aufzubringen. (vgl. Noetzel 2008: 36) Hobbes beschreibt diesen vorgesellschaftlichen Zustand als „einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz.“ (Hobbes 1984: 96) Aus diesem Konfliktzustand heraus schafft sich der Mensch den Leviathan. Dieser ist nichts anderes „als ein künstlicher Mensch, wenn auch von größerer Gestalt und Stärke als der natürliche, zu dessen Schutz und Verteidigung er ersonnen wurde.“ (Hobbes 1984: 5) Dieser „Staat“ besteht aus einem politischen Körper, dessen Seele der Alleinherrscher und dessen Nerven und Gelenke, Beamte und Bedienstete stellen - sie sind das Antriebszentrum. Der restliche Körperbau besteht aus Menschen, die sich per Vertragsschluss unter den Schutz des Leviathans stellen. (vgl. Noetzel 2008: 37) Durch den gegenseitigen Verzicht auf individuelle Gewaltausübung werden Konflikte reguliert. Dies wird im Gewaltverzichtsvertrag geregelt. Der Einzelne überträgt seine eigene Herrschaft an den Leviathan. Dieser ist nicht selbst an den Vertrag gebunden und hat somit das Gewaltmonopol inne. Durch seine neu gewonnen Macht muss er in der Lage sein, die Menschen einzuschüchtern. Der Frieden wird durch die Angst der Menschen vor dem Leviathan gesichert. (vgl. Noetzel 2008: 38) Diese friedenserhaltende Macht kann der Staat aber nur erhalten, wenn es ihm möglich ist, andere eventuelle Machtquellen konsequent auszuschalten. Das bedeutet, auch die göttliche Macht. Privat darf zwar jeder seinen eigenen Glauben leben, was Staatsbelange betrifft, gelten jedoch nur staatliche Glaubensbekenntnisse. (vgl. Noetzel 2008: 39) Der Leviathan ist also weltliche und geistige Macht zugleich.
Die Individuen sind alle Teil des Leviathan. Das haben sie durch den Abschluss des Gesellschaftsvertrags besiegelt. Somit ist der Einzelne Erschaffer des Ganzen und schlussfolgernd für dessen Taten mitverantwortlich. Daraus resultiert allerdings ebenso, dass die Individuen den Leviathan nicht anklagen können, klagen sie sich doch damit selbst an. Das bedeutet, dass der Leviathan „im eigentlichen Sinn“ keine Ungerechtigkeit begehen kann, würden doch die Untertanen sich selbst nie ein Unrecht zufügen. (vgl. Noetzel 2008: 39)
Die Individuen haben sich selbstbestimmt an den Leviathan ausgeliefert. Sie sind also an seine friedensstiftende Macht gebunden. Sollte dieser künstliche Mensch die Individuen nicht mehr beschützen können, so würde dies das Ende des Leviathan und einen Neubeginn des Krieges bedeuten. Jeder Einzelne würde dann wieder selbst für seinen Schutz einstehen - nötigenfalls mit Gewalt. (vgl. Noetzel 2008: 39)
Hobbes sah im Sozialvertrag die Lösung der politischen Konfliktregulierung. Allerdings beschreibt er eine Situation, in der ein Vertrag aus Furcht, vielleicht auch Verzweiflung geschlossen wird. Das starke Bedürfnis nach Sicherheit zwingt die Menschen in ein Abhängigkeitsverhältnis, in dem sie fast alle Freiheiten aufgeben. John Locke kritisiert Hobbes Idee einem Einzigen, bei völliger Straflosigkeit und scheinbar auch Fehlbarkeit desjenigen, alle Gewalt zuzusprechen, wie folgt: „Das heißt die Menschen für solche Narren zu halten, dass sie sich zwar bemühen, den Schaden zu verhüten, der ihnen durch Marder oder Füchse entstehen kann. Aber Glücklich sind, ja es für Sicherheit halten, vom Löwen verschlungen zu werden.“ (Locke 1977: 258)
Hobbes „Leviathan“ entspringt aus der konfliktgeprägten Zeit des 30-jährigen Krieges. Sein Gedankenkonstrukt kann also als Konfliktlösungsvorschlag verstanden werden. Zwar ist Hobbes Konstrukt zu starr, um eine angepasste Konfliktregulierung innerhalb der gesellschaftlichen Ordnung bieten zu können. Alle Konflikte werden vom Leviathan entschieden. Außer einen weiteren Machtzuspruch an den künstlichen Menschen, gibt es keine Vorschläge für eine genaue Konfliktbereinigung. (vgl. Noetzel 2008: 40) Aber dennoch wird seine Konflikttheorie hier aufgeführt, weil sie, ebenso wie weitere Theorien, maßgeblich zur Entwicklung der modernen Konfliktsoziologie beigetragen hat.
2.1.2 nach Marx
„Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.“ (Marx 1848: 462) Diese Aussage aus Marx und Engels „Manifest der Kommunistischen Partei“ macht klar, dass es bei Marx Konflikttheorie nicht um den sozialen Konflikt zwischen Menschen, sondern um den Kampf unter den Klassen geht. Was aber bedeutet Klassenkampf?
Der Marxsche Klassenbegriff beschreibt eine Zweiklassengesellschaft, in der sich Bourgeoisie und Proletariat gegenüber stehen. Diese beiden Klassen unterscheiden sich durch ihre Position in den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen. Während das Bürgertum das Eigentum an den Produktionsmitteln inne hat, besitzt die Arbeiterklasse als „Ware“ nur ihre eigene Arbeitskraft. Beide tragen ihren Teil dazu bei, die materiellen Bedürfnisse aller Mitglieder der Gesellschaft, und somit auch ihre eigenen, zu befriedigen. (vgl. Demirovic 2008: 50)
Aus dieser unterschiedlichen Verteilung von Eigentum entsteht jedoch ein HerrschaftKnechtschaft-Verhältnis zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Zwar ist der Arbeiter offiziell frei und kann auch über seine Arbeitskraft frei verfügen, und es wird auch keine direkte physische Gewalt auf ihn ausgeübt, dennoch ist er vom Wohlwollen des Bürgertums abhängig. Für seine Ware Arbeitskraft erhält der Arbeiter einen Arbeitslohn. Verlangt er zuviel, wird der Unternehmer sich nach einer billigeren Arbeitskraft umsehen. Weil der Arbeiter um seine Existenz fürchtet ist er früher oder später gezwungen, ein Beschäftigungsverhältnis einzugehen und dies für den üblichen oder einen schlechteren Lohn. Aber selbst bei Zahlung des marktüblichen Lohns ist es dem Unternehmer möglich, durch ökonomischen Druck einen Mehrwert zu erzielen. Dieser, durch längere Arbeitszeiten oder erhöhte Arbeitsleistung, gewonnene Mehrwert, ist immer Eigentum des Unternehmers. Dieser Mehrwert kann wiederum reinvestiert werden, was zu noch höherem Druck für den Arbeiter bei gleichem Lohn führt. Während also die Bourgeoisie weiter an Reichtum gewinnt, verarmt die Arbeiterklasse zunehmend. (vgl. Demirovic 2008: 50)
Doch auch das Bürgertum hat sich mit Konflikten auseinanderzusetzen, durch den gewonnen Mehrwert ist es den Unternehmern möglich, Ware auf dem Markt billiger anzubieten. Dies zwingt die Unternehmer untereinander in die Konkurrenz um Marktanteile und Profit. Aus Angst vor der Verdrängung vom Markt sind sie zum ständigen Wandel der Produktionsverhältnisse und -mittel, und somit auch der gesellschaftlichen Verhältnisse überhaupt, gezwungen. (vgl. Demirovic 2008: 51) Trotz der Negativität des Klassenkonflikts kann ihm also auch etwas Positives abgewonnen werden. Zwar ist die „Produktionsanarchie, die Quelle so vieles Elends, gleichzeitig [aber] die Ursache alles Fortschritts.“ (Marx 1847: 97) Dahrendorf bezeichnet ihn sogar als einen „der Großen Motoren der Geschichte [...], solange Herrschaft nötig ist, um Gesellschaft zusammenzuhalten.“ (Dahrendorf 1972: 78)
Die Konkurrenzfähigkeit hängt allerdings auch davon ab, wie sehr die einzelnen Unternehmer zur Veränderung bereit und fähig sind. Dabei spielt vor allem auch die Arbeiterklasse eine große Rolle. Ist es doch das Proletariat, das sich immer wieder von Neuem auf Veränderungen einstellen muss und gezwungen ist, seine sichere Lebenslage aufs Spiel zu setzen. Ist die Kompromissbereitschaft der Arbeiterschaft diesbezüglich erschöpft, wird die Konkurrenzfähigkeit der Bourgeoisie massiv eingeschränkt. Dann bilden große Unternehmen Monopole, kleinere werden geschluckt oder zerstört. Durch die Zerstörung kleinerer Unternehmen wächst gleichzeitig das Proletariat. Die Folge daraus ist nach Marx, dass eine kleine Zahl von Eigentümern einer sehr großen Zahl an Arbeitern gegenübersteht. Diesen wäre es dann möglich, einen Übergang der Produktionsmittel in das Eigentum der gesamten Gesellschaft bzw. des Staates zu erzwingen. (vgl. Demirovic 2008: 51 f.) Dieser Prozess des Klassenkonflikts führt dann „zur Aufhebung aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft.“ (Marx 1852: 507)
Es werden drei Austragungsformen des Klassenkampfes genannt. Der erste Schritt zum Klassenkampf war notwendigerweise erst einmal die Formierung zur Klasse. Es war jedoch ein harter Weg für die Menschen vom Bauern bis hin zum Lohnarbeiter. So wurde das Landvolk mit Gewalt in die Lohnarbeit gezwungen. Der gewaltvolle Zwang ging jedoch mit der Zeit zurück, da die Arbeiter ihre neue Position annahmen, bildete sie doch jetzt ihre Existenzgrundlage. Allmählich formierten sich „in den lokalen und regionalen Arbeitermilieus in den ersten Industriezentren sowie den Handwerkvereinigungen und intellektuellen Zirkeln [...] national und international vernetzte[...] gewerkschaftliche[...] und politische^..] Arbeiterorganisationen.“ (Demirovic 2008: 55) Diese Zusammenschlüsse resultierten aus der Erkenntnis, dass trotz lokaler, kultureller und beruflicher Unterschiede der einzelnen Arbeitergruppierungen, gemeinschaftliche Interessen bestanden. Marx beschreibt diesen Wandel von der „Klasse an sich zur Klasse für sich“ wie folgt: „Die Herrschaft des Kapitals hat für die Masse [der Arbeiter] eine gemeinsame Situation, gemeinsame Interessen geschaffen. So ist diese Masse bereits eine Klasse gegenüber dem Kapital, aber noch nicht für sich selbst. In dem Kampf, den wir nur in einigen Phasen gekennzeichnet haben, findet sich diese Masse zusammen, konstituiert sich als Klasse für sich selbst. Die Interessen, welche sie verteidigen, werden Klasseninteressen.“ (Marx 1847: 181) Aus Furcht vor dem stetigen Machtgewinn der Arbeiterorganisationen und aus Angst, ihre billigen Lohnarbeiter zu verlieren, versuchte die Bourgeoisie immer wieder die Gewerkschaften zu schwächen oder zu zerschlagen, was ihr teilweise auch gelang. (vgl. Demirovic 2008: 56)
Die fortschrittliche Bourgeoisie war dem ständigen Wandel ihrer Existenzgrundlage unterworfen, sei es aus Konkurrenzdruck oder dem Willen, den Gewinn zu maximieren. Damit veränderte sich auch die Identität der gesamten Klasse. Da Bürgertum und Proletariat unweigerlich miteinander verbunden waren, war auch die Arbeiterklasse einem permanenten Wandel unterlegen. Immer mehr Menschen wurden in die Lohnarbeiterklasse gezwungen. Marx bezeichnete diese zusätzlichen Arbeitskräfte, die Frauen, Jugendliche und sogar Kinder und ausländische Arbeiter beinhalteten, als „industrielle Reservearmee“. (vgl. Marx 1867: 673) Der Aufstieg wurde ihnen verwehrt, stattdessen wurden sie immer wieder auf handelbare Ware reduziert. Natürlich versuchten die Arbeiter, diesem Zwang zu entfliehen. Der Wunsch nach sozialem Aufstieg durch Bildung oder Kunst war groß, wenngleich auch für viele unmöglich. Die, die es sich leisten konnten, meldeten sich krank und gingen früher in Ruhestand. Frauen übernahmen vermehrt die Rolle der Hausfrau. Wer genug Geld angesammelt hatte, um davon Leben zu können, zog sich von der Arbeit zurück. Das Bürgertum seinerseits verfolgte diese Entwicklung mit wenig Begeisterung. Durch finanzielle Anreize einerseits, aber auch durch ein Niedrighalten des Mindestlohns wird versucht, die Arbeiter zurück in die Unternehmen zu bringen. Auch wird propagiert, dass Freizeit und Arbeitslosigkeit nichts anderes sind als Faulheit und Parasitismus. (vgl. Demirovic 2008: 56)
Die dritte Austragungsform des Klassenkonflikts ist der Kampf um höheren Lohn und geringere Arbeitszeit. Sowohl Kapitalisten, als auch Arbeitersahen beide ihren Anspruch auf das gesellschaftliche Mehrprodukt. Marx schrieb dazu: „Produktion von Mehrwert, dargestellt in dem Mehrprodukt oder dem aliquoten Teil der produzierten Waren, worin unbezahlte Arbeit vergegenständlicht ist. Man muss nie vergessen, dass die Produktion dieses Mehrwerts [...] der unmittelbare Zweck und das bestimmende Motiv der kapitalistischen Produktion ist.“ (Marx 1983: 253 f.) Während die Arbeiterorganisationen durch Streiks versuchten ihre Interessen durchzusetzen, versuchte das Bürgertum mit unternehmerfreundlichen Gewerkschaften die Organisationsmacht der Arbeiter zu schwächen. Erst Tarifverträge bedeuten für beide Parteien Sicherheit. Die Arbeiterschaft musste nicht immer aufs Neue um ihre Löhne kämpfen und auch die Unternehmer konnten bezüglich der Löhne langfristig planen. Trotzdem herrschte hinsichtlich der Arbeitszeit immer noch Uneinigkeit. Die Gewerkschaften kämpften für eine Wochenarbeitszeit von weniger als 40 Stunden, gleichzeitig forderten die Unternehmer aus Gründen von Konkurrenzfähigkeit und des Arbeitsplatzerhalts Überstunden und Wochenendarbeit. Durch die Entwicklung von neuen Maschinen und verbesserten Organisationskonzepten wurde die Verhandlungsmacht des Proletariats jedoch erheblich geschwächt. Der Arbeiter der seine Arbeitskraft als Ware verkaufte konkurriert jetzt mit der Maschine. (vgl. Demirovic 2008: 57) Zwar steigen jetzt die Gewinne der Unternehmer, gleichzeitig nimmt jedoch die Maschine vielen
Arbeitern ihre Existenzgrundlage. „Der Wert der Arbeitskraft war bestimmt nicht nur durch die zur Erhaltung des individuellen erwachsenen Arbeiters, sondern durch die zur Erhaltung der Arbeiterfamilie nötige Arbeitszeit. Indem die Maschinerie alle Glieder der Arbeiterfamilie auf den Arbeitsmarkt wirft, verteilt sie den Wert der Arbeitskraft des Mannes über seine ganze Familie. Sie entwertet daher seine Arbeitskraft.“ (Marx 1867: 417) Die Ausprägungen des Klassenkampfes reichten vom Leistungsentzug der Arbeiter bis hin zu blutigen Auseinandersetzungen. Er war also im Sinn seines Begriffs ein echter „Kampf“. Marx „brillante, wenngleich unhaltbare Theorie des Wandels“, wie sie Dahrendorf in „Konflikt und Freiheit“ bezeichnet, befasst sich mehr mit dem speziellen Thema der kapitalistischen Gesellschaft und nicht mit einer allgemeinen Theorie über den Konflikt. (vgl. Dahrendorf 1972: 76) Marx äußert sich nicht über andere Konfliktformen, wie zum Beispiel den Konflikt zwischen Einzelnen. Dennoch findet Marx Theorie seine Berechtigung, hier dargestellt zu werden, findet man doch auch heute noch Parallelen zum „Klassenkampf“, wenngleich man ihn nicht mehr als solchen bezeichnen kann. Heute ist er am ehesten mit dem Konflikt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vergleichen. Auch heute gibt es noch Konflikte zwischen Unternehmen und ihren Angestellten, ebenso wie Gewerkschaften die sich für die Interessen ihrer Mitglieder einsetzen. Gerade der Streitpunkt um höhere Löhne und geringere Arbeitszeiten, wie er in der dritten Austragungsform des Klassenkonflikts erwähnt wurde ist, auch heute noch im Arbeitsalltag vorzufinden. So zum Beispiel in den im März 2011 stattgefundenen Verhandlungen um Lohnerhöhung zwischen der „Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer“ (GDL) und der „Deutschen Bahn“.
2.1.3 nach Simmel
Georg Simmel war einer der bedeutendsten, wenn nicht der bedeutendste, Konfliktsoziologe. Sein Werk „Der Streit“ zählt zu den Klassikern der (Konflikt)Soziologie. Simmels „formale Soziologie“ befasst sich mit der Art und Weise, wie sich zwischenmenschliche Beziehungen vollziehen. Diese Beziehungsformen der Individuen schaffen durch Vergesellschaftung die Gesellschaft. Gesellschaft ist also für Simmel „die Summe der Wechselwirkungen, die Individuen miteinander eingehen.“ (Stark 2008: 84) Simmel spricht von „gegenseitiger Beeinflussung“, d.h. dass sich das Individuum in und durch die Wechselwirkung verändert. Soziale Wechselwirkungen sind Teil der Gesellschaft. Folglich ist Gesellschaft die Veränderung des Individuums durch soziale Wechselwirkung. (vgl. Stark 2008: 84)
Da sich auch im Konflikt Wechselwirkungen ergeben, ja der Konflikt eine Wechselwirkung ist, so ist er auch eine Form der Vergesellschaftung. Ist doch der Konflikt eine der lebhaftesten Wechselwirkungen. (vgl. Simmel 1972: 65) Betrachtet man Konflikt als eine Vergesellschaftungsform bedeutet dies gleichzeitig, auch die soziale und sozialisierende Komponente des Konflikts zu sehen. Konflikte sind nach Simmel keineswegs dysfunktionale Störungen, die Gesellschaft bedrohen. Vielmehr sind sie als Wechselwirkung Gesellschaft. (vgl. Stark 2008: 85)
Keinesfalls bedeutet dies jedoch, dass Konflikten immer etwas Positives abzugewinnen ist. Immerhin können sie der Grund für Krieg, Zerstörung und Totschlag sein. Trotzdem sind sie Vergesellschaftungsformen, deren Folgen zwar destruktiv, aber eben auch konstruktiv sein können. (vgl. Stark 2008: 85) Denn so „wie der Kosmos .Liebe und Haß’, attraktive und repulsive Kräfte braucht, um eine Form zu haben, so braucht auch die Gesellschaft irgendein quantitatives Verhältnis von Harmonie und Disharmonie, Assoziation und Konkurrenz, Gunst und Missgunst, um zu einer bestimmten Gestaltung zu gelangen.“ (Simmel 1972: 67)
Simmel unterscheidet zwei Grundprinzipien der Konfliktaustragung: Opposition und Repulsion. Er beschreibt die große Bedeutung der Repulsion (Abstoßung/ Feindschaft) am Beispiel des indischen Kastensystems. Das indische Sozialsystem basiert nicht nur auf Hierarchie, sondern direkt auf ihrer gegenseitigen Repulsion. Würde es keine Feindseligkeiten innerhalb der Gruppe gegenüber einer anderen Gruppe geben, so würden die Grenzen verschwimmen. Vielmehr noch ist Repulsion direkt soziologisch produktiv, weil erst sie häufig Klassen und Persönlichkeiten ihre gegenseitige Stellung gibt. Diese unterschiedlichen Stellungen hätten sie nicht einnehmen können, wenn sie zwar von den objektiven Ursachen der Feindseligkeit begleitet worden wären, aber ohne Gefühle und Äußerungen der Feindschaft. So bestimmt Repulsion die gegenseitig Stellung und Distanz der Elemente. (vgl. Simmel 1972: 68 f.)
Ebenso wichtig für das gesellschaftliche Miteinander ist für Simmel die Opposition. Er sieht sie als oft einziges Mittel, um mit unaushaltbaren Persönlichkeiten überhaupt ein Zusammen zu gestalten. „Hätten wir nicht Macht und Recht, gegen Tyrannei und Eigensinn, gegen Launenhaftigkeit und Taktlosigkeit wenigstens zu opponieren, so würden wir Beziehungen zu Menschen, unter deren Charakter wir derartig leiden, überhaupt nicht ertragen, sondern zu Verzweiflungsschritten gedrängt werden [...].“ (Simmel 1972: 69) Opposition ist deshalb so wichtig, weil sie uns das Gefühl völliger Unterdrückung nimmt und „uns eine innere Genugtuung, Ablenkung, Erleichterung [gewährt] - wie es unter anderen psychologischen Umständen gerade die Demut und Geduld tut.“ (Simmel 1972: 69) Dabei muss Opposition keinesfalls äußerlich in Erscheinung treten. Auch innere Opposition kann zur Beruhigung beitragen. (vgl. Simmel 1972: 69)
Je enger eine Gruppe in sich geschlossen ist, desto ambivalenter kann sich die Feindschaft zwischen den Mitgliedern äußern. Zum einen kann die Gruppe auf Grund ihrer starken Bindung einen inneren Konflikt ertragen, ohne sich aufzulösen. Genauso kann sie jedoch, wenn sie stark auf Zusammengehörigkeit und Einheit basiert, auch durch kleine Streitigkeiten auseinander brechen. Diese starke Bindung innerhalb der Gruppe macht sie gegen die Bedrohung durch Feindschaften unter ihren Mitgliedern, je nach Umstand, entweder anfälliger oder resistenter. Simmel nennt dies die Ambivalenz des Konflikts. (vgl. Simmel 1972: 72)
Simmel interessiert sich weniger für das „Warum“ des Konflikts, sondern vornehmlich für das „Wie“. So unterscheidet er sieben Formen, wie ein Konflikt ausgetragen werden kann.
1) Kampfspiel:
Simmel nimmt durchaus eine Unterscheidung vor, zwischen Kampf und Kampfspiel. Der Kampf wird nicht um des Kampfes und Sieges willen geführt. Es geht um die Durchsetzung von Interessen - häufig materieller Natur. Der gewaltvolle Kampf wird durch antagonistische Triebe begünstigt. (vgl. Simmel 1972: 74)
Anders als der Kampf, ist der Antrieb des Kampfspiels einzig und allein der reine Reiz des Kampfes und Sieges. Es enthält „in seiner soziologischen Motivierung absolut nichts als den Kampf selbst.“ (Simmel 1972: 75) Es geht nur darum sich gegen den Gegner durchzusetzen.
Trotzdem kann auch aus reinem, formalen und unpersönlichem Kampf, Wut und Hass gegenüber dem Gegner entstehen. Nach Simmel ist Hass gegenüber seinem Gegner jedoch genauso zweckmäßig, wie Liebe gegenüber seinem Partner. Nähren diese Gefühle doch die seelische Kraft der Gegnerschaft bzw. des Miteinanders. (vgl. Simmel 1972: 74) Die Form des Kampfspiels verläuft unter der beiderseitigen Anerkennung von Normen und Regeln. Und dies mit einer Strenge wie sie Kooperationen nur selten aufweisen. (vgl. Simmel 1972: 75) Dies könnte jedoch auch aus Furcht oder Selbstschutz resultieren, da man eine Normabweichung im Kampf mehr als in der Kooperation fürchtet.
2) Rechtsstreit:
Hier liegt, anders als beim Kampf, der ja aus Lust am Kampf stattfindet, ein Streitobjekt vor. Durch beiderseitige, freiwillige Zugeständnisse bezüglich des Streitobjekts kann der Rechtsstreit beendet werden. Der Rechtsstreit geht mit einem energischen Rechtsgefühl einher und wird auf Grund eines Eingriffs in die Rechtssphäre des Ichs ausgelöst. Er ist also durch den individualistischen Trieb der Selbsterhaltung der Persönlichkeit bestimmt. (vgl. Simmel 1972: 76)
Der gerichtliche Rechtsstreit ist geprägt von reiner Sachlichkeit und verläuft nach eigenen Regeln. Simmel bezeichnet ihn als den „Streit schlechthin“, weil in den kompletten Prozess nichts eindringt, was nicht dem Streitzweck dient. Jede Subjektivität wird durch die Sachlichkeit außer Acht gelassen. (vgl. Simmel 1972: 76)
So basiert diese Konfliktform durch ihre Sachlichkeit auf der Einheitlichkeit der Parteien. Müssen sie sich doch gemeinsam den Gesetzen unterordnen, sich an die Verfahrensordnung halten und der Entscheidungen harren, die durch Dritte gefällt werden. Gemeinsam sind sie also der sozialen Ordnung unterlegen. Somit ist der Rechtsstreit eine starke Form der Vergesellschaftung. (vgl. Stark 2008: 86)
3) ideologischer Streit:
Der ideologische Streit beinhaltet zwei mögliche Austragungsformen. Zum einen kann er sich mit einer rein sachlichen Entscheidung befassen. Das bedeutet alles Persönliche nicht in den Streit mit einzubeziehen. Allerdings „kann das Bewusstsein, nur der Vertreter überindividueller Ansprüche zu sein, nicht für sich, sondern nur für die Sache zu kämpfen, dem Kampfe einen Radikalismus und eine Schonungslosigkeit geben, die ihre Analogie an dem gesamten Verhalten mancher sehr selbstloser, sehr ideal gesonnener Menschen findet.“ (Simmel 1972: 78) Simmel meint damit Menschen, die es in ihrer Selbstaufopferung durchaus als berechtigt ansehen auch Andere für ihre Idee zu opfern. (vgl. Simmel 1972: 78) Durch den Verzicht der Parteien auf alles Persönliche „wird der Kampf nun, ohne Zuspitzungen, aber auch ohne die Milderungen durch personale Instanzen und nur seiner immanenten Logik gehorsam, mit der absoluten Schärfe ausgefochten. (Simmel 1972: 79) Simmel zeigt dies auch am Beispiel des Klassenkampfes. Durch die Formierung von Gewerkschaften wurde der Kampf sachlicher. Bürgertum und Arbeiterschaft hörten auf, sich gegenseitig persönliche Böswilligkeit zu unterstellen. Den Einzelnen wurde jetzt bewusst, dass sie nicht für sich, sondern für ein größeres, sachliches Ziel kämpfen. Die Gegnerschaft wurde konzentrierter, nahm jedoch nicht an Heftigkeit ab. (vgl. Simmel 1972: 79)
Andererseits kann der ideologische Streit aber gerade das Persönliche mit einbeziehen, ohne dass die gemeinsamen objektiven Interessen dadurch negativ beeinträchtigt werden. Dabei ist es durchaus von Vorteil, wenn sich der Streit auf seinen eigentlichen Ausgangspunkt beschränkt, ist es doch so den Parteien besser möglich, sich auf diesen zu konzentrieren. Wesentlich anstrengender und komplizierter wäre es, wenn andere, eigentlich befriedete Gebiete der Beziehung, in denen Übereinkunft herrscht, in den Streit hineingezogen werden. (vgl. Simmel 1972: 78)
4) persönliche Feindschaft:
Persönliche Feindschaft entwickelt sich paradoxerweise aus vorausgehender Gemeinsamkeit. Je stärker und enger diese Gemeinsamkeit ist, desto heftiger wird das Bewusstsein bei Abweichungen von dieser erregt. Dies ergibt sich aus der Unterschiedsempfindlichkeit des Menschen. (vgl. Simmel 1972: 80)
Diese Anzeichen von Erregung bei Unterschieden in der Gemeinsamkeit, können in durchgehend harmonischen Beziehungen als Warnfunktion dienen. So ist es möglich den Streitgrund frühzeitig zu beseitigen, bevor er die Beziehung in seinen Grundfesten ernsthaft schädigt.
In Beziehungen, in denen der Wille zum unbedingten Frieden jedoch fehlt, äußert sich der aus der Dissonanz resultierende Antagonismus jedoch umso heftiger. So fügen sich Menschen, die viel gemeinsam haben, oft schlimmeren Schaden zu, als völlig Fremde. Dies kann zum Einen die Folge daraus sein, dass die große Gemeinsamkeit in einer Beziehung zur Selbstverständlichkeit geworden ist „und deshalb nicht [sie], sondern das momentan Differente ihre gegenseitige Stellung bestimmt.“ (Simmel 1972: 80)
Anders ist es aber auch möglich, dass in einer sehr engen Beziehung nur wenig Unterschiede existieren, so dass ein auch schon kleiner Konflikt eine wesentlich andere Bedeutung hat als zwischen Fremden, die a priori nicht von unbedingter Gemeinsamkeit ausgehen. So steht man fremden Personen, wenn man mit ihnen weder Interessen noch Qualitäten gemein hat, objektiv und reserviert gegenüber. Auseinandersetzungen zwischen Fremden erregen deshalb nicht in so heftiger Form das ganze Gemüt. (vgl. Simmel 1972: 80)
Je mehr ein Mensch jedoch mit einem anderen gemein hat, desto enger und umfassender assoziiert er sich mit ihm. Das erklärt nach Simmel die „unverhältnismäßige Heftigkeit, zu der sich sonst durchaus beherrschte Menschen manchmal gerade ihren Intimsten gegenüber fortreißen lassen.“ (Simmel 1972: 81) Entspringt doch tiefster Hass aus gebrochener Liebe.
Allerdings verhält es sich mit dem Konflikt der aus gebrochener Liebe entsteht, in etwas anderer Form, als mit Konflikten auf Grund von anderen Differenzen. Können wir doch Liebe, aber auch Hass als die uns stärksten, bekannten Gefühle bezeichnen. Wird eine Liebesbeziehung beendet, also die Gemeinsamkeit „Liebe“ zu einem einseitigen Empfinden, so fühlt sich der jetzt mit seiner Liebe Alleingelassene derart bloßgestellt und in seinem Selbstwert und seiner Sicherheit erschüttert, dass nur der Hass und die Schuldzuweisung das geheime Gefühl der eventuell eigenen Schuld zu überdecken vermag. (vgl. Simmel 1972: 82)
Dass in einer so engen Bande wie der Ehe keine Konflikte vorkommen, ist völlig unmöglich. Simmel sagt sogar, dass eine Beziehung, in der von vornherein durch gegenseitige Nachgiebigkeit versucht wird, jedweden Konflikt zu vermeiden, zwar geprägt sein mag von Liebe, Sitte und Treue, es ihr jedoch an der letzen, unbedingtesten Hingebung des Gefühls, ja der Leidenschaft, fehlt. Ein Individuum dem bewusst ist, dieses Gefühl nicht aufbringen zu können, ist folglich umso mehr damit bemüht, durch Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung, die Beziehung von jedem noch so kleinen Konflikt zu bewahren. (vgl. Simmel 1972: 82) Vielmehr aber noch „das eigene Gewissen über die leisere oder stärkere Unwahrhaftigkeit seines Verhaltens zu beruhigen, die auch der aufrichtigste, ja oft leidenschaftlichste Wille nicht in Wahrheit verwandeln kann - weil es sich hier um Gefühle handelt, die dem Willen nicht zugängig sind, sondern wie Schicksalsmächte kommen oder ausbleiben.“ (Simmel 1972: 82)
So ist eine dem Anschein nach konfliktfreiere und harmonischere Beziehung zwar moralisch und gut, fehlt es ihr jedoch wahrscheinlich an Gefühlstiefe. (vgl. Simmel 1972: 83)
5) Feindschaft zwischen Gruppen:
Das Grundmotiv für Feindschaft zwischen Gruppen ist sozialer Hass. Es ist der Hass gegen ein Gruppenmitglied, weil es die Existenz der Gruppe gefährdet und dieser Hass ist völlig frei von persönlichen Motiven. Dabei hasst die Gruppe den Gegner nicht nur aus dem Grund der den Konflikt entfacht hat, „sondern auch aus dem soziologischen: daß wir eben den Feind der Gruppe als solchen hassen.“ (Simmel 1972: 83) Löst sich die Gruppe auf Grund der Feindschaft auf, so ist der Konflikt beendet. Wollen sich jedoch die Parteien nicht von der Gruppe lösen, weil ihnen die Werte der Zugehörigkeit wichtig sind, verschärft sich der Antagonismus zwischen den Parteien - sind sie doch alle Teil einer größeren Gruppeneinheit. Die Folge ist eine gegenseitige Zuweisung der Schuld an der Bedrohung des Ganzen. (vgl. Simmel 1972: 83)
„So wächst der Streit in einer eng verbundenen Gruppe oft genug über das Maß hinaus, das sein Gegenstand und dessen unmittelbares Interesse für die Partien rechtfertigen würde.“ (Simmel 1972: 84) Hinzu kommt das Gefühl, dass der Konflikt nicht nur die Parteien, sondern auch die ganze Gruppe betrifft. Jede Partei kämpft somit im Namen der Gruppe gegen die Bedrohung der Gruppe und hasst damit nicht nur die andere Partei als Gegner der eigenen Partei, sondern auch gleichzeitig als Gegner der höheren soziologischen Einheit. (vgl. Simmel 1972: 84)
6) Eifersucht:
Simmel unterscheidet, anders als häufig im Sprachgebrauch üblich, zwischen Eifersucht und Neid. Es handelt sich bei beiden um einen Wert, „an dessen Erlangung [(Neid)] oder dessen Bewahrung [(Eifersucht)] uns ein Dritter real oder symbolisch hindert.“ (Simmel 1972: 84) Bei der Eifersucht meint der Betroffene einen Rechtsanspruch auf den Besitz zu haben, während der Neid sich nicht um das vermeintliche Recht dreht, sondern entsteht, weil das gewünschte Objekt verwehrt bleibt. Dabei spielt es beim Neid keine Rolle, ob das Objekt im Besitz eines anderen ist oder dieser den Besitz aufgegeben hat. (vgl. Simmel 1972: 85) Würde doch der Verkauf des Sportwagens des Einen, keinesfalls bedeuten, dass der Andere ihn dadurch erhält. Wenn ein Dritter nun den Sportwagen erwirbt, bleibt der Neid trotzdem bestehen. Also bezieht sich der Neid auf das Objekt, das heißt den Besitz selbst.
Anders ist es bei der Eifersucht. Hier betrifft der Zustand nicht den Besitz, sondern den Besitzer selbst. Bleiben wir beim Beispiel des Sportwagens. Angenommen der Eine gewinnt bei einem Preisausschreiben einen Sportwagen, so entsteht die Eifersucht des Anderen, weil er glaubt, dass ihm der Wagen, als absolutem Sportwagenfan, eher zustünde als dem jetzigen Besitzer. Diese Meinung entsteht nicht zuletzt aus der Einbildung, dass der Sportwagenbesitzer ihm den Wagen quasi, weil auch er am Preisausschreiben teilgenommen hat, „weggenommen“ hat, auch wenn dies ein völlig falscher Gedanke ist. (vgl. Simmel 1972: 85)
Jetzt kennt man den Begriff der Eifersucht weniger in Zusammenhang mit Automobilen, sondern eher aus dem Bereich der Liebe. Auch hier ist die Voraussetzung für die Eifersucht das vermeintliche Recht auf den seelischen oder physischen Besitz des Objekts. (vgl. Simmel 1972: 86) „Den Besitz einer Frau mag ein Mann einem andren beneiden; eifersüchtig aber ist nur der, der irgendeinen Anspruch auf ihren Besitz hat. Dieser Anspruch kann allerdings in der bloßen Leidenschaft des Begehrens bestehen.“ (Simmel 1972: 86) Und aus dieser „Leidenschaft des Begehrens“ ein Recht auf Besitz herzuleiten, ist nach Simmel ein „allgemein menschlicher Zug.“ (Simmel 1972: 86)
Simmel nimmt zwischen Neid und Eifersucht noch eine weitere Unterscheidung vor - die Missgunst. Sie ist, wenn man so will, eine Mischung zwischen Neid und Eifersucht. Missgunst bezieht sich sowohl auf den Besitz, als auch auf den Besitzer. Es wird also ein Objekt neidisch begehrt, nur weil es in Besitz eines Anderen ist und nicht, weil es vom Subjekt besonders begehrt wird. Zwei Extreme sind in diesem Zusammenhang möglich. Zum Einen die leidenschaftliche Missgunst, d.h. das Subjekt verzichtet lieber auf das Objekt, zum Beispiel indem es das Objekt zerstört, als dass es dem Anderen gestattet, es zu besitzen. Ein anderes Extrem beinhaltet eine völlige Gleichgültigkeit, oder sogar Abneigung, des Subjekts gegenüber dem Objekt und trotzdem kann nicht ertragen werden, dass ein anderer das Objekt besitzt. (vgl. Simmel 1972: 85)
So wächst schon im Voraus der Eifersucht ein Anspruch auf den Besitz - zum Einen als einfaches Begehren und zum Anderen als rechtlich begründetes Begehren. Gerade durch diesen Rechtsanspruch entwickelt sich die Eifersucht häufig zu einem Ereignis mit einem tragischen Ende. So ist der Versuch, Rechtsansprüche „auf Gefühle, wie Liebe und Freundschaft, [...] geltend zu machen, [...] ein Versuch mit einem völlig untauglichen Mittel.“ (Simmel 1972: 87)
Vielleicht ist Eifersucht die subjektiv radikalste Form von Konflikt, der aus einer Einheit hervorgeht. (vgl. Simmel 1972: 88) Immerhin kann aus vorausgegangener Liebe ebenso intensiver Hass entstehen, der den Eifersüchtigen dazu veranlasst, nicht nur seinen Kontrahenten, sondern auch die Verbindung, zum Beispiel zu einer Frau, zu zerstören. Folglich zerstört er zwar das, was er auch zu zerstören vor hatte, jedoch ebenso das, was er unbedingt besitzen wollte.
7) Konkurrenzkampf:
Konkurrenz ist ein indirekter Kampf, denn, wer den Konkurrenten direkt bekämpft und zerstört, konkurriert folglich nicht mehr mit ihm. Was den Konkurrenzkampf ausmacht, ist die Tatsache, dass beide Parteien sich um denselben Kampfpreis bemühen. Zum Beispiel Automobilhersteller die um den Marktanteil konkurrieren. Konkurrenzkampf ist also eher defensiv, weil der Kampfpreis nicht in Besitz einer der Gegner ist. Vielmehr ist er für jeden der Parteien, ohne direkten Kampf mit einem der Konkurrenten, zu erreichen. (vgl. Simmel 1972: 88)
Nach Simmel gibt es zwei Kombinationen von Konkurrenz. Zum Einen der Konkurrenztyp, bei dem zwar die Besiegung des Konkurrenten eine erste Notwendigkeit darstellt, jedoch nicht zum Kampfpreis führt. Erst die Art der nachfolgenden Präsentation seiner selbst kann zum Ziel führen. So nützt es dem Automobilhersteller X wenig, wenn er zwar den Automobilhersteller Y vom Markt verdrängt hat, sein Angebot sich jedoch nicht mit den Bedürfnissen der Kunden deckt. (vgl. Simmel 1972: 88 f.)
Beim zweiten Konkurrenztyp wird der Unterschied von Konkurrenzkampf zu anderen Kämpfen noch deutlicher. Hier verwenden die Parteien überhaupt keine Kraft auf den Gegner, sondern nur auf die Erreichung des Ziels. Am Beispiel der Automobilhersteller würde dies bedeuten, dass sie nur durch zum Beispiel Qualität und den Preis ihren Marktanteil zu vergrößern versuchen. Allerdings erfolgt diese Leistung auch im Bewusstsein, dass die Konkurrenz mit ähnlicher Intensität und Art an diesem Ziel arbeitet. Das heißt, obwohl äußerlich kein Kampf zwischen den Konkurrenten besteht, nützt der „innere“ Konkurrenzkampf allen Parteien - treibt er sie doch zu höheren Leistungen an. Der Antagonismus zwischen den Parteien entwickelt sich so folglich zu einer nützlichen Formalität. (vgl. Simmel 1972: 89) So kann man auch besonders an der Konkurrenz, der es an anderen Kampfformen fehlt, die positive Seite des Konfliktes erkennen. Die „subjektive antagonistische Triebfeder [führt uns] zur Verwirklichung objektiver Werte, und der Sieg im Kampfe ist nicht eigentlich der Erfolg eines Kampfes, sondern eben der Wertverwirklichungen, die jenseits des Kampfes stehen.“ (Simmel 1972: 89)
Die Konkurrenz hat eine sehr stark vergesellschaftende Wirkung, da sie den Einen zwingt, seinen Konkurrenten kennenzulernen. So gelingt der Konkurrenz, „was sonst nur der Liebe gelingt: das Ausspähen der innersten Wünsche eines andern, bevor sie ihm noch selbst bewußt geworden sind.“ (Simmel 1972: 91) Denn, um überhaupt mit seinen Mitbewerbern konkurrieren zu können muss man ihre Stärken und Schwächen, ja ihre Leistungsfähigkeit kennen.
Simmel sagt: „Das wertvollste Objekt für den Menschen ist der Mensch [selbst], unmittelbar wie mittelbar.“ (Simmel 1972: 92) So ist der Mensch der Hauptgegenstand moderner Konkurrenz. Die einzelnen Parteien konkurrieren alle um den Menschen, müssen sich um ihn bemühen und sich an seine Bedürfnisse anpassen. Obwohl alle gegen alle kämpfen, kämpfen jetzt auch alle um alle. (vgl. Simmel 1972: 91)
Ein weiterer wichtiger Abschnitt in Simmels „Der Streit“ befasst sich mit „Konflikt und Gruppenstruktur“.
Ein Konflikt zwischen zwei Personen verändert nicht nur die Beziehung zueinander, sondern auch den Einzelnen selbst. Dabei kann die Veränderung sowohl negativ, als auch positiv sein.
In jedem Fall muss der Einzelne im Konfliktfall seine ganze Kraft auf den Konflikt verwenden. Er sollte sich nur auf den Streit konzentrieren und andere Interessen hinten anstellen. Anders ist es im Friedensfall, hier kann er sich entspannen und auch anderen Interessen nachgehen. (vgl. Simmel 1972: 93)
Ebenso ist es bei einer Gruppe, im Konflikt müssen alle Mitglieder der Gruppe ihre Kräfte vereinen und zentralisieren - sie müssen als Einheit agieren. Natürlich können sie in Friedenszeiten diese Einheit lockern oder sogar ganz aufgeben, dies würde allerdings bedeuten, dass sie sich in einem erneuten Streitfall erst wieder zusammenfinden müssten. Da diese Wiedervereinigung, vor allem bei einem häufigen Wechsel von Streit und Frieden, einen großen Kraft- und Zeitaufwand bedeuten würde, kommt es nicht selten vor, dass Gruppen die sich ursprünglich nur in konfliktären Zeiten zusammenschlossen, permanent eine Einheit bilden. (vgl. Simmel 1972: 93 f.)
Der US-Amerikanische Soziologe Charles Cooley schrieb in seinem Werk „Social Process“, das im Sterbejahr von Georg Simmel veröffentlicht wurde: „The more one thinks of it the more he will see that conflict and co-operation are not separable things, but phases of one process which always involves something of both.” (Cooley 1918: 39)
Jetzt erscheint es nur logisch, wenn diese Zusammenführung zu einer Einheit ihr die nötige Kraft verleiht, um andere in einem Kampf zu besiegen, dass jede Gegenpartei an einer Auflösung dieser Einheit starkes Interesse hat. Das ist jedoch nicht immer so. Es gibt durchaus Fälle, in denen ein großer Konflikt, mit einer stark zentralisierten Einheit, vielen kleinen, häufig wiederkehrenden Konflikten vorgezogen wird. So erscheint ein großer Streik einer Arbeitergruppe sinnvoller, und dies auch für den Arbeitgeber, als ständige kleinere Konflikte und Reibereien, die im Endeffekt vielleicht noch kostenintensiver und kraftraubender sind.
Hinzu kommt, dass der Kampf konzentrierter und somit überschaubarer ist. Zwar können die Gegenparteien kleinere Einheiten leichter besiegen, aber ein Kampf gegen eine einheitliche Organisation kann den Frieden eher und langfristiger sichern. (vgl. Simmel 1972: 94)
Simmel unterscheidet im Wesentlichen zwei Gruppenstrukturen. Zum Einen die Gruppe die sich ganz bewusst enger verbindet und zentralisiert, weil sie als Ganzes in ein konflik- täres Verhältnis zu einer außenstehenden Partei tritt. Zum Anderen eine Gruppe, die sich erst zusammenschließt, weil jedes Element einen Feind hat und dieser für jeden derselbe ist. (vgl. Simmel 1972: 95)
Die als erstes beschriebene Gruppenstruktur hat zur Folge, dass sich die Gruppe im Konfliktfall „säubert“. Auch in scheinbar einheitlichen Gruppen gibt es Elemente die gegenstrebende Interessen verfolgen. Da im Streitfall eine unbedingte Zentralisierung nötig ist, bedeutet dies, dass die abweichenden Elemente entweder ihre innere Gegenstrebung ablegen, oder dass diese Mitglieder, um eine reine Einheit herzustellen, aus der Gruppe ausgeschlossen werden.
Das heißt, dass der Streitzustand die Gruppe so eng zusammenzieht, dass sich die einzelnen Elemente entweder vollständig vertragen oder sich vollkommen gegenseitig abstoßen.
Anders ist es im Friedenszustand. Er erlaubt den einzelnen Elementen trotz ihrer Unterschiedlichkeit, weil keine Zentralisierung nötig ist und jeder in eine andere Richtung ziehen kann, zusammenzuleben. (vgl. Simmel 1972: 95)
Das Bestehen von gegenstrebenden Mitgliedern ist für Minoritätsgruppen jedoch gefährlicher als für Majoritätsgruppen. Die Majoritätsgruppe kann schwankende Anhänger auf Grund ihrer großen Ausdehnung besser ertragen, da der Kern nicht davon berührt wird. Anders ist es bei Minoritäten. Ihre Ausdehnung ist geringer, d.h. die Peripherie liegt näher am Zentrum, was wiederum bedeutet, dass jedes unsichere Element den Kern und somit die Bindung bedroht. So ist bei Minoritätsgruppen die unbedingte Einheit aller Elemente von wesentlicherer Bedeutung als bei Großgruppen. (vgl. Simmel 1972: 97)
Wegen des starken Zusammenhalts der Gruppe im Konfliktfall, ist der Sieg oder Frieden im soziologischen Sinn nicht immer von Vorteil, sinkt doch dadurch „die Energie die ihren Zusammenhalt garantiert, und die auflösenden Kräfte, die immer an der Arbeit sind, gewinnen an Boden.“ (Simmel 1972: 98) So kommt es vor, dass manche Gruppen ständig für Feinde sorgen, damit die Elemente das Interesse an der Einheit nicht verlieren. So bringt der Streitfall Personen und sogar ganze Gruppen zusammen, die sonst nichts miteinander zu tun hatten. Dabei muss die Bedrohung nicht einmal in Wirklichkeit bestehen. Die Verbindung zwischen Streitfall und Zusammenschluss ist so groß, dass manch eine Gruppe gar nicht aktiv nach einem neuen Feind suchen muss, um die Einheit aufrechtzuerhalten. Der Zusammenschluss zum Kampf ist schon so oft erfahren worden, dass mit der bloßen Vereinheitlichung zur Gruppe eine Kampfhandlung assoziiert wird. So fühlen sich andere Parteien nur durch eine Verbindung von Elementen ganz ohne antagonistische Absicht bedroht. (vgl. Simmel 1972: 98) Dies hat zur Folge, dass sich andere Elemente ebenfalls zu einer Gruppe formieren, allerdings auf Grund der „Bedrohung“ in voller Bereitschaft zum Kampf. Ein neuer Konfliktfall kann entstehen.
Es ist allerdings auch zu unterscheiden, ob sich die Gruppe zusammengefügt hat zum Zweck des Angriffs und der Verteidigung, oder nur zur Verteidigung. Im besten Fall hat sich die Gruppe zwar aus einer Kampfsituation heraus gebildet, besteht aber nicht mehr wegen der gemeinsamen antagonistischen Absicht, sondern auf Grund wachsender Verbindungsenergien und anderweitigen Interessen. (vgl. Simmel 1972: 99)
Die zweite Gruppenstruktur, die weiter oben angeführt wurde, unterliegt einer weniger starken Bindung. Die Elemente fühlen sich zusammengehörig, die eine gleichartige Aversion gegen einen Dritten hegen. Dies muss jedoch nicht zu einer gemeinsamen Kampfaktion führen. So fühlen sich Personen in der U-Bahn, die sich einen Wagon mit Personen mit vulgärem Verhalten teilen, gegenüber diesen zusammengehörig. Dies geschieht ganz ohne einen Zwischenfall oder dass Blicke oder Worte gewechselt werden. Die bloße gemeinsame Aversion gegen die Pöbelnden macht sie zu einer Partei. (vgl. Simmel 1972: 100) Dieses Phänomen findet man vermehrt im Streitfall. Im Friedensfall beschränkt man sich auf näher stehende Personen. Erst der Konflikt bringt eine größere Zahl von einzelnen, auch fremden, Elementen zur Kooperation. Dies rührt erstens daher, dass man im Konfliktfall nicht wählerisch sein kann, zweitens der Konflikt nur temporär ist und die einzelnen Elemente sich nach Beendigung wieder trennen können und drittens der Sieg durch den Kampf, so gefährlich er auch sein mag, ein schnellerer und intensiverer ist und somit eine natürliche Anziehung auf die Elemente ausübt. Als letzter Grund ist aufzuführen, dass auch völlig heterogene Elemente sich im Kampf zu einer Gruppe zusammenführen lassen, weil persönliche Interessen in den Hintergrund treten. Hinzu kommt, dass alle latenten Feindseligkeiten von Elementen der einen Gruppe gegen Elemente der anderen Gruppe im Kampf offen gelegt und beseitigt werden können, die sonst nie aufgekommen wären. (vgl. Simmel 1972: 101)
Simmels Konflikttheorie war lange Zeit eine der einzigen echten Konflikttheorien, die sich mit dem sozialen Konflikt zwischen Individuen und auch zwischen Gruppen beschäftigte. So ist sie mit die aussagekräftigste Konflikttheorie der damaligen, aber auch der modernen Soziologie. Leider kann sie in diesem Rahmen nicht in ihrem vollen Umfang dargestellt werden. Allerdings sind die wichtigsten Elemente als theoretischer Grundstock dieser Arbeit enthalten. Eine Kritik soll nachfolgend durch Lewis A. Coser erfolgen.
2.1.4 nach Coser
Lewis Coser hat sich sehr stark an Simmels Konflikttheorie orientiert. Ebenso wie Simmel erkennt auch er den gruppenbildenden und -festigenden Charakter des Konflikts. Er betont allerdings auch, dass dieser Gedanke nicht neu ist, sondern auch von William Graham Sumner in seinem Werk „Folkways“ beschrieben wird. Auch Sumner sagt, dass die Unterscheidung zwischen Wir-Gruppe (in-group) und Fremdgruppe (out-group) durch den Konflikt gemacht wird. Coser fügt zu Simmels Gedanken jedoch hinzu, dass die Fremdgruppe nicht unbedingt in einer antagonistischen Beziehung zur Wir-Gruppe stehen muss. So kann die Außengruppe durchaus auch als Vorbild betrachtet und anerkannt werden. „Sehnt [man] sich [doch] heimlich nach dem, was man verurteilt.“ (Coser 2009: 41) Ein Wetteifern mit der out-group fällt beispielsweise nur in Systemen weg, die kaum soziale Mobilität aufweisen, wie zum Beispiel dem Kastensystem. (vgl. Coser 2009: 39)
Coser moniert, dass Simmel keine Unterscheidung zwischen feindlichen Gefühlen und Konflikt macht. So mag eine ungleiche Verteilung von Rechten und Privilegien zwar feindselige Gefühle in einem hervorrufen, sie muss aber nicht zwingend zum Konflikt führen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass eine Unterprivilegierung erst als solche wahrgenommen werden muss. Im indischen Kastensystem wurde die negative Privilegierung der niederen Kasten durchaus von allen Kasten als legitim angesehen. (vgl. Coser 2009: 42)
Coser hält eine derartige Unterscheidung zwischen feindlichen Gefühlen und tatsächlichem Konflikt allerdings für notwendig und wesentlich. Ist zwar feindliche Haltung eine Notwendigkeit, um überhaupt einen Konflikt einzugehen, so ist der Konflikt doch immer ein Verhalten. Coser unterscheidet also deutlich zwischen Haltung und Verhalten. (vgl. Coser 2009: 41)
Dieser „Fehler“ Simmels, wie Coser ihn bezeichnet, führt sich weiter fort. Simmel schreibt dem Konflikt reinigende und gruppenerhaltende Wirkung zu. Allerdings bezieht er sich nur auf den direkten Konflikt mit der direkten Quelle der Gegnerschaft. Auch fehlt, nach Coser, in Simmels Theorie, dass die oben genannte Wirkung von Konflikt auch anderen Verhaltensweisen zugeschrieben werden kann, so zum Beispiel bloßer Feindseligkeit. Auch muss sich diese Feindseligkeit nicht gegen ihren Ursprung richten, sondern kann sich auch gegenüber Ersatzobjekten entladen. (vgl. Coser 2009: 47)
Es folgten Simmels Überlegungen zwei Erkenntnisse nach. Zum Einen, dass feindliche Gefühle durchaus auf Ersatzobjekte umgelenkt werden können und zum Anderen, dass Ersatzbefriedigung durch das Nachlassen der Spannung erreicht werden kann. Beide machen es möglich, die ursprüngliche Beziehung zu erhalten. Coser spricht von einer „Sicherheitsventiltheorie“. Würden die feindlichen Gefühle nicht im Konflikt entladen werden, gegen das ursprüngliche oder ein Ersatzobjekt oder eine anderweitige Spannungserleichterung eintreten, so würde die Beziehung zwischen den Gegnern zerstört werden. (vgl. Coser 2009: 47)
In diesem Zusammenhang macht Coser eine bedeutende Unterscheidung. Er unterscheidet zwischen Verschiebung der Mittel und Verschiebung der Objekte. Bei der Verschiebung der Mittel wird kein Konflikt ausgetragen. Das Objekt bleibt das gleiche, aber anstatt es aktiv zu bekämpfen, wird versucht, sich eine Spannungserleichterung, zum Beispiel durch Witze über dieses Objekt, zu verschaffen. In ähnlichem Maß gilt dies für BoxKämpfe. Der Zuschauer entscheidet sich für eine Partei und identifiziert sich mit ihr. Diese passive Teilnahme am Kampfgeschehen macht es möglich, aggressive Triebe zu entspannen und Frustrationen abzubauen. Die Verschiebung der Objekte heißt, es wird ein Konflikt gegen ein Objekt ausgetragen, jedoch nicht gegen das Ursprungsobjekt, sondern gegen ein Ersatzobjekt. (vgl. Coser 2009: 51 f.) Eine der wohl am bekanntesten und dramatischsten Verschiebungen der Objekte fand im Dritten Reich statt. Anstatt sich gegen die politischen Führer zu stellen, die eigentlich für die Missstände in Deutschland verantwortlich waren, schob man die Schuld einer rassischen Minorität zu. Kurt Lewin, ein US- amerikanischer Psychologe, führte 1940 ein Experiment mit autokratischen und demokratischen Gruppen durch. Ähnlich wie die Bürger im damaligen Nazi-Deutschland, schlossen sich die Kinder in der autokratischen Gruppe nicht gegen ihren Anführer zusammen, sondern gegen eines der Kinder. Lewin erklärte dieses Verhalten damit, dass die Mitglieder der Gruppe, die keinen höheren Status erreichen konnten, diese Erhebung in der Unterdrückung eines Einzelnen erfuhren. (vgl. Coser 2009: 53)
In solchen starren Systemen, wie es das totalitär geführte Nazi-Deutschland war, werden aggressive Gefühle häufig mit Hilfe von Ventilinstitutionen kanalisiert. Durch die Institutionalisierung von Antisemitismus wurde die Spannung, die sich eigentlich gegen die politische Führung richten sollte, auf die Juden abgelenkt. Jeder Anflug von öffentlicher Aggression gegen den Diktator wurde sofort gewaltvoll unterdrückt. Konflikte wurden folglich nur in Bezug auf das Ersatzobjekt erlaubt. Talcott Parsons bezeichnete es sogar als gefährlich und falsch, sich offen gegen die in-group auszudrücken. (vgl. Coser 2009: 64) Anders ist dies in flexiblen Systemen, wie der Demokratie, hier sind Konflikte durchaus erlaubt, weil sie als Mittel der Entspannung dienen. (vgl. Coser 2009: 95) So gibt es in allen demokratischen Regierungen auch immer eine politische Opposition und auch das Recht auf freie Meinungsäußerung.
Simmel unterschied zwischen Konflikt als Mittel und Konflikt als Selbstzweck. Dies lieferte für Coser das Kriterium für seine Unterscheidung von echten und unechten Konflikten. Echte Konflikte sind also „Konflikte die durch Frustration einer bestimmten Forderung innerhalb einer Beziehung und durch Gewinnkalkulation der einzelnen Partner entstehen und sich auf das angenommene frustrierende Objekt richten.“ (Coser 2009: 58) Unechte Konflikte betreffen zwar auch die Interaktion von Personen, sind aber vom Bedürfnis Spannung zu entladen geprägt und entstehen nicht aus der Gegensätzlichkeit der jeweiligen Ziele. Wichtig ist beim unechten Konflikt auch, dass die Wahl des Streitobjekts nicht mit dem Streitpunkt zusammenhängt. So kann die Aggression, die aus einem Streitpunkt heraus entstanden ist, auf irgendein Objekt gelenkt werden. Man kann also den weiter oben erwähnten Antisemitismus im Dritten Reich, wenn dieser nicht durch Interessenoder Wertkonflikte, wie zum Beispiel zwischen Juden und Palästinensern, entstanden ist, als unechten Konflikt bezeichnen. Es wurde versucht, die entstandene Frustration durch ein Ersatzobjekt zu entspannen. Wer dieses Ersatzobjekt stellt, spielt keine große Rolle. In der Regel sind es die Minderheiten einer Gruppe. (vgl. Coser 2009: 58 f.)
Bei unechten Konflikten ist die Aggressivität, anders als bei echten Konflikten, nicht an ein bestimmtes Objekt gebunden, sie kann also leichter anderweitig kanalisiert werden. Folglich wird sie sich vermutlich andersartig zeigen, wenn das Ersatzobjekt nicht mehr existiert. Unechte Konflikte sind demnach weniger stabil als echte Konflikte. (vgl. Coser 2009: 59) Der echte Konflikt endet, wenn das Subjekt eine für sich zufrieden stellende Handlungsalternative findet, mit der das Ziel ebenso erreicht werden kann. Den Parteien stehen immer andere Mittel als der Konflikt zur Verfügung, ebenso wie verschiedene Formen des Konflikts. Die Handelnden haben also funktionale Alternativen in den Mitteln, während es beim unechten Konflikt funktionale Alternativen in den Objekten sind. (vgl. Coser 2009: 59 f.)
Anders als hier vielleicht der Eindruck entstehen könnte, sind unechte Konflikte nicht immer falsch. Und auch echte Konflikte werden nicht immer mit angebrachten Mitteln ausge- fochten. Arbeiter zum Beispiel, die streiken, um damit zu erreichen, dass ihre ausländischen Mitarbeiter entlassen werden, damit ihr eigener Arbeitsplatz und ihre Löhne nicht gefährdet werden, befinden sich in einem echten Konflikt. Sicher ist diese Vorgehensweise nicht adäquat, erscheint jedoch in den Augen der Arbeiter so. Sollte es andere Mittel geben, um das Ziel der Arbeiter in gleichem Maße zu erreichen, dann werden sie wahrscheinlich einen anderen Weg wählen. Ist dies trotz anderer Alternativen nicht der Fall, ist anzunehmen, dass „nicht-realistische Elemente wie .Vorurteil’ in dem Konflikt zutage treten“ (Coser 2009: 65) und es sich um einen unechten Konflikt handelt.
Forderungen nach größerer Macht oder höherem Status werden in jedem sozialen System von seinen Mitgliedern gestellt. Sie sind somit der Ursprung echten Konflikts und werden auch trotz Normen und Institutionen immer bestehen. Wenn sich die Forderungen und Erwartungen der Menschen nicht mit dem tatsächlich Eintreffenden decken bzw. durch Andere versagt werden, kann es immer zu echten Konflikten kommen, die sich gegen diejenigen richten, die für diese Versagung verantwortlich gemacht werden. Ziel ist es immerein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. (vgl. Coser2009: 66)
Bei unechten Konflikten ist das Ziel, Spannung durch aggressives Verhalten zu entladen. Das Zielobjekt ist dabei nicht festgelegt und kann wechseln. Eine andere Wahl als das Mittel der „aggressiven Handlung“ gibt es hier nicht. Schließlich ist es die Handlung selbst, die Befriedigung verschafft. Entstehen können unechte Konflikte zum Beispiel aus „Versagungen und Frustrationen durch den Sozialisierungsprozeß und später aus Verpflichtungen der Erwachsenenrolle.“ (Coser 2009: 66)
Coser unterscheidet nicht nur zwischen echten und unechten Konflikten, sondern auch wann ein Konflikt funktional und wann dysfunktional sein kann.
Ganz generell sind funktionale Konflikte als positiv zu bezeichnen. Sie fördern den Konsens; deshalb ist es ihnen möglich, die grundlegenden Probleme des Konflikts zu lösen und eine positive, strukturelle Veränderung herbeizuführen. Dysfunktionalen Konflikten hingegen ist dies nicht möglich. Ihre Folgen sind systemdesintegrierend. (vgl. Thiel 2003: 20)
Konflikte neigen dazu, für solche soziale Strukturen dysfunktional zu sein, in denen es an Institutionalisierung und Tolerierung von Konflikt mangelt. Also in jenen starren Systemen, wie zum Beispiel der Autokratie. Hier kann ein intensiver Konflikt ganze Systeme zerreißen. Dabei geht die Bedrohung nicht vom Konflikt selbst aus, sondern von der Starrheit. (vgl. Coser 2009: 186) Der Konflikt als Warnsignal wird unterdrückt und somit auch die Gefahr des Zusammenbruchs „überhört“. (vgl. Coser 2009: 183)
In flexiblen Systemen hingegen, in denen Konflikte toleriert werden, besteht dieses Problem nicht. Innere soziale Konflikte sind hier eher positiv funktional, weil sie eine „Wiederanpassung von Normen und Machtverhältnissen innerhalb der Gruppe“ erlauben. (Coser 2009: 180) Konflikte können also in flexiblen Systemen bestehende Normen erneuern bzw. an neue Bedingungen anpassen oder völlig neue Normen schaffen. Der Konflikt kann also hilfreich sein, um Beständigkeit bei veränderten Bedingungen zu garantieren. (vgl. Coser 2009: 183)
Ob Konflikte als funktional oder dysfunktional zu beschreiben sind hängt, nach Thiel, von der Perspektive des Beobachters ab. Selbst bei einer Festlegung von Normen, die für alle Parteien gleich gültig sind, ist die Beurteilung beobachterabhängig. Um eine Bewertung möglich zu machen, müssten der Standpunkt des Beobachters, der die Unterscheidung „funktional“ oder „dysfunktional“ vornimmt, sowie der zeitliche Hintergrund des Konflikts berücksichtigt werden.
Und selbst wenn diese Vorraussetzungen erfüllt wären, könnte eine genaue Bewertung immer noch nicht gemacht werden, weil die Funktionalität des Konflikts immer auch von der Funktion abhängt, die ein Konflikt in einer bestimmten Situation haben soll.
[...]
- Arbeit zitieren
- Markus Oswald (Autor:in), 2011, Der konstruktive Konflikt , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184443
Kostenlos Autor werden




















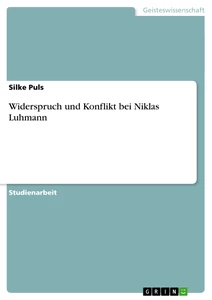


Kommentare