Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Grundlagen
2.1 Was ist Innovation
2.1.1 Innovationsbegriff
2.1.2 Pioniere der Innovationsforschung
2.1.3 Merkmale von Innovationen
2.1.4 Klassifikation von Innovationen
2.1.5 Wegweisende Innovationen
2.2 Der Medici Effekt
2.2.1 Grundthese des Medici Effektes
2.2.2 Grundlegende Paradigmen
2.2.3 Erweiterte Paradigmen
2.2.4 Hintergrund zum Buch
2.2.5 Verwandte Publikationen
2.3 Vergleichbare Prinzipien
2.3.1 Bionik im Architektur- und Bausektor
2.3.2 Hybrididee in der Automobilbranche
2.3.3 Open Innovation im Organisationsbereich
2.3.4 Cross-Industry-Innovation in der Industrie
2.3.5 Fusion und Crossover in der Musikbranche
3 Ist-Situation in Europa
3.1 Innovationen im Kontext
3.1.1 Weltweite Veränderungen
3.1.2 Innovationsstudien der EU
3.1.3 Europäische Visionen
3.2 Innovationskraft und Trendanalysen
3.2.1 Patente und Schutzrechte
3.2.2 Innovationscluster und Patentverteilung
3.2.3 Studienergebnisse von Beratungsunternehmen
3.3 Innovationsmanagement in Organisationen
3.3.1 Innovationsprozesse
3.3.2 Innovationsmanagement
3.3.3 Innovationskultur
3.3.4 Innovative Unternehmen
4 Europäische Beispiele zum Medici Effekt
4.1 Vorgehen
4.2 Produktentwicklung
4.2.1 Der Fußballschuh mit dem Tennisschläger (Adidas)
4.2.2 Die Nähmaschine mit der Computermaus (Bernina)
4.2.3 Der Ski mit der Geige (Fischer)
4.2.4 Der Milchaufschäumer aus dem Labor (Nespresso)
4.3 Materialien & Bauwesen
4.3.1 Der Sneaker mit der Klette (Velcro)
4.3.2 Die Fassade mit dem Lotoseffekt (Sto)
4.3.3 Das Haus nach dem Wind (Herzog)
4.4 Automobil, Beförderung & Medizin
4.4.1 Das Auto mit dem Joystick (BMW)
4.4.2 Der Aufzug aus den Bergen (Schindler)
4.4.3 Der Knochen mit der Autoantenne (Wittenstein)
4.4.4 Das Krebsrankl aus dem Knochenschwund (Penninger)
4.5 IKT & Organisation
4.5.1 Das Unterwassermodem der Delfine (EvoLogics)
4.5.2 Die Urinalplanung aus dem Kraftwerk (Geberit)
4.5.3 Der Werkzeugkasten in der Flotte (Hilti)
4.5.4 Der Rasenmäher mit dem Hitzeschild (ElringKlinger)
5 Ideenpool zur Anwendung des Medici Effektes
5.1 Kreativitätspool
5.1.1 Kreativität und Kreativitätstechniken
5.1.2 Assoziative Kreativitätstechniken
5.1.3 Modellgetriebene Kreativitätstechniken
5.2 Innovationspool
5.2.1 Planungs- und Analysetechniken
5.2.2 Strategische Innovationstechniken
5.2.3 Operative Innovationstechniken
5.3 Spielepool
5.3.1 Spiel- und Spielentwicklungstechniken
5.3.2 Innovationsspiele im weiteren Sinne
5.3.3 Innovationsspiele im engeren Sinne
5.4 Leitfaden Anwendungsmodell
6 Prototyp zur Umsetzung
6.1 Vorgehensprinzip
6.2 Exemplarische Umsetzung
6.3 Abschließende Bewertung
7 Conclusio
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Anhang
Dokumenteninformation
Historie
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ansprechpartner
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Innovationen stellen heute sowohl für Wirtschaft als auch Forschung oftmals entscheidende Treiber dar und sichern letztlich wesentlich die Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit von etablierten Tätigkeitszweigen. Neue Entwicklungen sind entgegen historischer Beispiele allerdings zunehmend weniger die Errungenschaft von herausragenden Einzelpersonen, sondern entstehen oft erst durch das Zusammenspiel von unterschiedlichen Denkhaltungen und durch das interdisziplinäre Aufbrechen von Grenzen.
Gerade in Europa haben Faktoren wie Diversität der Systeme und Strukturen, wechselnde Beschäftigungsgrade und unterschiedlichste Kulturwelten bis hin zu Globalisierungseffekten in den letzten Jahren zunehmend dazu beigetragen, ein besonders reichhaltiges Fundament für vielfältige Sichtweisen heranzubilden. Diese Unterschiede können, wie auch von Frans Johansson in seinem Buch „The Medici Effect: What Elephants and Epidemics Can Teach Us About Innovation“ beschrieben, eine wertvolle Chance darstellen, um die Entstehung radikaler Innovationen maßgeblich zu fördern.
Der Autor geht davon aus, dass wesentliche Voraussetzungen für das Entstehen von Innovationen durch das Zusammenspiel von verschiedenen Konzepten und Ideen in Form von Überschneidungspunkten geschaffen werden. Am Beispiel der Florentiner Bankendynastie der Medicis zeigt Johansson auf, dass das Zusammentreffen kreativer Menschen aus unterschiedlichsten Disziplinen zu besonders reichhaltigen und neuartigen Ideen führen kann, im Fall der Medicis zur Renaissance.
Im Zuge dieser Masterthese wird das Konzept des Medici Effektes dargelegt und seine Entstehung anhand ausgewählter europäischer Beispiele untermauert als auch in Relation zu gängigen Innovationsmechanismen gestellt. Darüber hinaus werden Ideen für die Entwicklung eines Spiels gesammelt und exemplarisch umgesetzt, um das Prinzip einem mittleren und oberen Management eines europäischen Unternehmens vermitteln zu können.
Kapitelaufbau
Nachfolgend wird ein grober Überblick zu jedem Kapitel gegeben. Darüber hinaus findet sich im Einleitungsbereich jedes (längeren) Kapitels ebenfalls eine kurze Zusammenfassung der jeweils behandelten Themenbereiche (s. d.). Die digitale PDF-Version dieser Arbeit verfügt außerdem über entsprechende PDF-Bookmarks um direkt zwischen den verschiedenen Kapiteln zu navigieren.
Kapitel 1 . Einleitung (S. 1 ff.)
Dieses kurze Kapitel gibt eine grobe Vorstellung zum Inhalt der vorliegenden Arbeit und – im Rahmen dieser Übersicht – auch einen Leitfaden zum Inhalt der jeweiligen Kapitel inklusive Seitenangaben.
Kapitel 2 . Grundlagen (S. 4 ff.)
Das einführende Grundlagenkapitel erläutert zentrale Begriffe wie Innovation, Invention oder Radikalität und zeigt den aktuellen Stand der Innovationsforschung auf. Darüber hinaus wird der Medici Effekt nach Johansson beschrieben und seine grundlegenden Prinzipien. Abschließend werden vergleichbare Prinzipien wie etwa die Bionik, Open Innovation oder alternative Methoden des Innovationsmanagements ausgeführt.
Kapitel 3 . Ist-Situation in Europa (S. 54 ff.)
Im Zuge dieses Kapitels wird die aktuelle Ist-Situation von radikalen Neuerungen in Bezug auf Unternehmen und Wissenschaften beschrieben und die besonderen Herausforderungen für gelungenes Innovationsmanagement. Trendanalysen und Statistiken zur Innovationskraft runden dieses Kapitel ab, wobei der Schwerpunkt der Ausführungen gesamthaft im europäischen Raum liegt.
Kapitel 4 . Europäische Beispiele zum Medici Effekt (S. 101 ff.)
Dieses Kapitel zeigt exemplarische Beispiele für die erfolgreiche Anwendung des Medici Effektes in Europa auf und erläutert ihren spezifischen Zusammenhang. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Rolle unterschiedlicher Wissens- und Marktdomänen gelegt als auch der jeweils beeinflussenden Rahmenbedingungen. Ziel ist es aufzuzeigen, wie radikale Innovationen entstanden und welche Hebelwirkung sie hatten.
Kapitel 5 . Ideenpool zur Anwendung des Medici Effektes (S. 126 ff.)
In diesem Kapitel werden Ideen zur Präsentation gesammelt und wie eine potentielle Umsetzung erfolgen kann. Darüber hinaus wird ein Leitfaden für den Einsatz eines Anwendungsmodells vorgelegt. Ziel ist die Erstellung eines Konzeptes mit dem mittlere und obere Managementebenen begeistert werden können, etwa mit Hilfe eines Brett- oder Würfelspieles, und das Aufzeigen jener Faktoren, welche zur kognitiven Vermittlung beitragen.
Kapitel 6 . Prototyp zur Umsetzung (S. 160 ff.)
Gemäß den vorangegangenen Kapiteln wird das entworfene Konzept prototypisch umgesetzt und anhand einer ausgewählten Zielgruppe in der Praxis erprobt. Die Erfahrungen aus der exemplarischen Umsetzung werden im Rahmen dieses Kapitels dokumentiert und analytisch bewertet.
Kapitel 7 . Conclusio (S. 164 ff.)
Abgeleitet von den beschriebenen Beispielen und dem aufgestelltem Vorgehensmodell wird zuletzt das Fazit zur aufgestellten Hypothese gezogen und sein Erfolgspotential für die praktische Anwendung. Außerdem wird aufgezeigt, welche weiteren Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, ergänzt um eine persönliche Einschätzung des Medici Effektes.
2 Grundlagen
Die Begriffswelt von Innovationen zeigt sich heute als diffuse Mischung zwischen enthusiastischem Modewort und ökonomischer Notwendigkeit und hat zwischenzeitlich wie kaum ein anderer sprachlicher Ausdruck breiten Einzug in zahlreiche managementorientierte Veröffentlichungen gehalten. In Gegenüberstellung zu historischen Auslegungen müssen sich Innovationen heute wesentlich stärker in der Praxis beweisen, um überhaupt erst als solche zu gelten – eine kreative Idee oder neues Wissen muss umgesetzt und erfolgreich in einem Zielsystem wie etwa einem ökonomischen Markt etabliert sein, um zur Innovation zu werden. Gleichzeitig tangieren Innovationen zunehmend eine Vielzahl an etablierten Domänen und überschreiten althergebrachte Grenzen: die Hebelwirkung von Innovationen wird umso größer, je mehr beteiligte Systeme eine Rolle spielen, wie auch Frans Johansson mit seinem Medici Effekt aufzeigt.
Im Rahmen dieses einführenden Kapitels sollen wesentliche Grundlagen von Innovation in theoretischer als auch praktischer Hinsicht erläutert werden. Beginnend bei einem definitorischen Rahmen des Begriffes in 2.1 (S. 4 ff.) werden insbesondere die Schlagwörter Innovation, Invention als auch Radikalität herausgegriffen und inhaltlich abgegrenzt. Im daran anschließenden 2.2 (S. 27 ff.) wird der dieser Arbeit zugrunde liegende Medici Effekt nach Frans Johansson beschrieben und der Bogen zu verwandten Veröffentlichungen der Gegenwart gespannt. Das Kapitel schließt in 2.3 (S. 45 ff.) mit einer Erläuterung vergleichbarer Prinzipien wie etwa der Bionik und anderen alternativen Ansätzen des Innovationsmanagements.
2.1 Was ist Innovation
Innovation ist nach Hauschildt et al. ein „ schillernder, ein modischer Begriff “ (Hauschildt & Salomo, 2007, S. 3). Um aus dieser bunten Vielfalt der Fachliteratur einen für diese Arbeit gültigen Begriffsrahmen heraus zu destillieren, wird nachfolgend zunächst das Verständnis von Innovation in seiner heute üblichen Bedeutung ausgeführt und gleichzeitig einem breiteren Bedeutungskontext gegenübergestellt. Ergänzt wird diese Betrachtung durch eine exemplarische Auswahl von Pionieren der Innovationsforschung und ihre Sichtweise auf den Innovationsbegriff. Im Anschluss werden typische Merkmale und Klassifikationen ergänzend vorgestellt und abschließend eine Auswahl an wegweisenden Innovationen nach dem heute üblichen Sprachgebrauch vorgestellt.
2.1.1 Innovationsbegriff
Innovation, Invention, Imitation
Der Begriff Innovation hat seine Wurzeln in den lateinischen Wörtern novus für „neu“ und innovatio für „etwas neu Geschaffenes“ und kann laut Duden mit der „ Einführung von etwas Neuem, Erneuerung, Neuerung “ (Duden) umschrieben werden. Im heutigen Sprachgebrauch wird mit Innovation meist eine Neuerung in technologisch-ökonomischem Sinn bezeichnet, d.h. die erfolgreiche Umsetzung einer Idee oder Erfindung in der Praxis und deren wirtschaftliche Nutzung (vgl. (Rammert, 2010, S. 20)). Obgleich sich der Begriff in den letzten Jahren zunehmend wieder zu weiten beginnt, wird Innovation demgemäß in der einschlägigen Fachliteratur derzeit primär unter dem Blickwinkel erfolgreichen Wirtschaftens betrachtet (vgl. (Hunneshagen, 2005, S. 15) bzw. (Hauschildt & Salomo, 2007, S. 6 f.)).
Im weiteren Sinn kann sich eine Innovation allerdings nicht nur auf Wirtschaft und Wissenschaften beziehen, sondern auch Politik und Gesellschaft im Allgemeinen, wie allein einige historische Beispiele zeigen: So sprach bereits Shakespeare von „innovate“ im Sinne einer politischen Erneuerung (vgl. (Weber, 2000, S. 4)), Vergil’s Aeneis „erneuert“ in beinahe jeder Zeile collagenhaft frühere literarische Werke (vgl. (Müller & Ungern-Sternberg, 2004, S. 46)) und Luther forderte mit Innovation gar eine religiöse Neubildung innerhalb des Christentums (vgl. (Makrides & N., 2004, S. 325)). Die heute weit verbreitete Auslegung als technologisch-ökonomische Neuerung wurde folgerichtig weniger durch die Antike oder Renaissance, denn vielmehr durch die nach dem zweiten Weltkrieg entstandene Innovationsforschung geprägt. Joseph A. Schumpeter sprach in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von einer „ Durchsetzung neuer Kombinationen “ (Joseph A. Schumepter nach (Walcher, 2007, S. 13)), während Jürgen Hauschildt gegen Jahrhundertende insbesondere den, dem Wort etymologisch innewohnenden Aspekt des Neuartigen hervorhob (“wie immer das zu bestimmen ist” (Hauschildt & Salomo, 2007, S. 4)) und Everett M. Rogers ergänzte diese Sicht etwa zeitgleich durch die Art und Weise wie sich Innovationen am Markt ausbreiten.
Diese drei Aspekte – Idee, Invention und Diffusion – bilden auch heute die prägenden Grundpfeiler des Innovationsbegriffes. Am Beginn einer Innovation steht demnach stets die kreative Idee bzw. neues Wissen. Die Idee wird in Form von Produkten, Dienstleistungen oder Verfahren praktisch umgesetzt und wandelt sich so zur Invention. Erst wenn die Invention jedoch erfolgreich angewendet und am Markt oder innerbetrieblich eingeführt wurde, ist der Aspekt der Diffusion erfüllt und die Innovation konstituiert. Müller-Prothmann et al. bringen dies auf die simple Formel “Innovation = Idee + Invention + Diffusion” (Müller-Prothmann & Dörr, 2009, S. 7) und Roberts verkürzt dies noch markanter in „ innovation = invention + exploitation “ (E.B. Roberts nach (Plönnes, 2008, S. 20)).
Eine Innovation ist demgemäß nicht mit einer Invention gleichzusetzen, auch wenn die Begrifflichkeiten miteinander durchwegs in Verbindung stehen. Unter Invention wird nach Brockhoff eine Erfindung oder Entdeckung als auch ihre erstmalige technische Umsetzung, etwa als Prototyp, verstanden (vgl. (Helbig & Mockenhaupt, 2009, S. 5)). Eine Innovation umfasst demgegenüber die wirtschaftliche Anwendung der Invention. Dementsprechend kann eine Innovation im Prinzip auch als am Markt umgesetzte Innovation verstanden werden (vgl. (Ili, 2010, S. 22)) und ist auch wesentlich stärker durch den schöpferischen Akt bzw. technische Problemlösung als solches gekennzeichnet, während die Innovation vor allem auch Aspekte zur kommerziellen Vermarktung integriert. Der Übergang zu einem außer- oder innerbetrieblichen Markt und die breite Durchsetzung in ebendiesem wird dabei auch häufig als Diffusion bezeichnet, was nach Ropohl nichts anderes meint als die gesellschaftliche Verwendung (vgl. (Ropohl, 2009, S. 259)). Der Zusammenhang zwischen Invention und Invention ist beispielhaft in Abbildung 1 dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Zusammenhang von Invention und Innovation nach Brockhoff[1]
Eine Innovation kann dabei grundsätzlich sowohl das entstandene Ergebnis als auch den eigentlichen Prozess bezeichnen. Der Innovationsprozess im engeren Sinne besteht primär aus der Einführung am Markt, während er im weiteren Sinne den gesamten Ablauf von der Ideenfindung bis zur Durchsetzung am Markt umfasst. Spätestens am Markt angekommen, muss sich eine Innovation darüber hinaus gegenüber der Imitation behaupten. Unter Imitation wird vordergründig Nachahmung verstanden, d.h. der Mitbewerb erkennt das mögliche Potential der Neuerung und möchte durch Kopieren der Idee bzw. Innovation am Erfolg partizipieren. Innovation als auch Imitation ist gemein, dass es sich um etwas Neues handelt und zumindest aus Sicht des imitierenden Unternehmens kann es sich zwar auch um eine Neuerung handeln, die Imitation unterscheidet sich jedoch grundlegend von der Innovation durch die fehlende Neuartigkeit aus unternehmensübergreifender Sicht (vgl. (Weise, 2007, S. 11)).
Dieser Aspekt tangiert gleichzeitig die Subjektivität des Innovationsbegriffes, welche heute als allgemein anerkannt gilt. Innovationen wohnt stets ein Systembezug inne, d.h. eine Neuerung kann jeweils von einem Unternehmen, Markt oder auch der ganzen Welt als „neuartig“ empfunden werden. Entsprechend dem jeweils betrachteten System wird eine Imitation folgerichtig auch vor allem dann als solche betrachtet, wenn sie im gleichen System auftritt, also beispielsweise am gleichen Markt (vgl. (Perl, 2007, S. 22)). Zahlreiche AutorInnen gehen davon aus, dass Innovationen per se primär den Markt als relevantes System sehen, da eine Objektivierung, d.h. Ausdehnung auf die gesamte Welt, nur schwer praktisch durchführbar scheint (vgl. (Kellerhals, 1999, S. 8 f.)). Im Mindestfall muss die Innovation jedoch neu für ein Unternehmen sein, d.h. es reicht nicht aus, nur dem Innovator als solches zu erscheinen (vgl. (OECD; Eurostat, 2005, S. 46)).
Zusammenfassend steht die moderne Innovationsforschung vor der Herausforderung einen mehr oder minder glücklichen Bogen zwischen radikalen Innovationen (s.u.), welche eine Gesellschaft nachhaltig verändern können und bis hin zu jahrzehntelangen Kondratieff-Zyklen reichen (vgl. (Debus, 2002, S. 92)), und „Innovatiönchen“, wie sie tagtäglich von Marketingabteilungen von Unternehmen platziert werden, zu spannen. Dies kann auch als symptomatisch für die veränderte „Schwerkraft“ des Begriffes Innovation in Gegenüberstellung zur Invention gesehen werden: wegweisende Erfindungen von Universalgenies, wie die Glühbirne von Edison, veränderten das Leben vieler Menschen einschneidend, finden zugleich aber wesentlich seltener statt, während ein optimiertes Leuchtverfahren ebenfalls hohe Auswirkungen haben kann, sich aber eher im irdischen Bereich eines bzw. einer UnternehmensmitarbeiterIn wiederfindet. Dadurch ist auch gleichzeitig die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Invention an sich im Sinne von Neuerung und Innovation als Erneuerung von etwas bereits Bestehendem erkennbar.
Durch den von Schumpeter und seinen Nachfolgern in der Neuzeit eingeführten Marktaspekt einer Innovation hat allerdings zugleich eine Veränderung des Begriffes in Gegenüberstellung zur Renaissance stattgefunden: wurde in der Begriffswelt des 15. und 16. Jahrhunderts Innovation im Sinne von etwas Neuen um seiner selbst willen geschätzt, wird Innovation heute vordergründig aus ökonomischen Aspekten betrachtet. Erhalten blieb der Begriff in seinem ursprünglichen Kontext in anderen Disziplinen wie beispielsweise den Geisteswissenschaften. So können im Bereich von Kunst und Kultur Neuerungen auch dann als innovativ gelten, selbst wenn sie keine hohe Resonanz erhalten. Ergänzend werden in diesen Bereichen oftmals alternative Begriffe wie Avantgarde angewendet. Darüber hinaus ist der Begriff in der Gegenwart ausnehmend positiv belegt: so weist etwa auch Globalisierung deutlich innovative Kennzeichen auf, wird jedoch selten als Innovation im eigentlichen Sinne bezeichnet.
Radikale Innovationen
Eine der wichtigsten Festlegungen im Zuge von Innovationen stellt der Grad der Innovation dar, also das Ausmaß der Neuartigkeit, welche den „ graduellen Unterschied gegenüber dem bisherigen Zustand mess- und bewertbar “ (Hauschildt & Salomo, 2007, S. 12) macht. Üblicherweise wird in diesem Kontext das Begriffspaar radikal (für Innovationen mit hohem Innovationsgrad) und inkrementell (für Innovationen mit niedrigem Innovationsgrad) als Skalenbereich verwendet, zwischen welchem gegebenenfalls noch weitere Differenzierungen unterschieden werden. Im herkömmlichen Sprachgebrauch werden radikale Innovationen meist dann als solches bezeichnet, wenn sich die mit ihr einhergehenden Auswirkungen dramatisch gestalten, also beispielsweise ein Markt ruckartig hinzugewonnen oder eine Vielzahl an Folgeinnovationen ermöglich wird (vgl. (Debus, 2002, S. 94)).
Eine insbesondere im Zuge des kombinatorischen Ansatzes von Innovationen als auch der Wirtschaftsinformatik geeignete Darstellung findet sich bei Henderson und Clark. Sie verwenden eine zweidimensionale Matrix aus der Betrachtung der Kernkomponenten („component knowledge“) als auch deren Zusammensetzung („architectural knowledge“) und spannen zwischen diesen die vier Varianten radikal, architektonisch, modular und inkrementell auf (siehe Abbildung 2). Aus dieser Sichtweise lassen sich zwar verstärkt Produkte betrachten, welche als Hierarchie von Subsystemen und Schnittstellen dargestellt werden können (vgl. (Weise, 2007, S. 16)), der Ansatz lässt sich im Kern aber auch relativ einfach auf andere Innovationsgebiete wie Prozesse oder Design übertragen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Radikale Innovationen nach Henderson und Clark[2]
Inkrementelle Innovationen knüpfen gemäß der Matrix von Henderson et al. am stärksten an bereits bestehendes Wissen an und weisen nur eine geringe Änderung bezüglich der bislang verwendeten Komponenten als auch deren Verbindung auf. Ein Großteil heutiger Innovationen fällt in diesen Bereich der „Innovatiönchen“ – so wird der Anteil der inkrementellen Innovationen im letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts auf rund 60-70% geschätzt (vgl. (Billing, 2003, S. 17)). Der Charakter des Neuartigen nähert sich in diesem Fall eher dem Begriff der Optimierung bzw. Verbesserung an. Sie werden zur modularen Innovation, wenn einzelne Komponenten bzw. Teilsysteme geändert werden (z.B. Multifunktionsgeräte) und zur architektonischen Innovation, wenn sich die Art und Weise des Zusammenspiels bereits vorhandener Komponenten ändert (z.B. Bluetooth). Treffen beide Aspekte zu, liegt eine radikale Innovation vor (z.B. Auto statt Kutsche).
Mitunter wird der Begriff der radikalen Innovation auch auf andere Betrachtungsszenarien angewendet. Je nach Schwerpunkt kann hierbei eine nach außen gerichtete Sicht in Richtung Kunde, Lieferant oder Markt bzw. nach innen in Richtung Einsparung, Knowhow oder Ressourcen zielführend sein (vgl. (Nikodemus, 2005, S. 20 f.), (Weise, 2007, S. 18), (Stieglitz, 2004, S. 197), (Billing, 2003, S. 10 ff.), (Debus, 2002, S. 93)). In der Regel findet sich jedoch mindestens auf einer Achse eine technologisch orientierte Sicht, um die eigentlichen Kernkompetenzen des Unternehmens zu unterstreichen. Alternativ kann auch das Verhältnis der Produkt- bzw. Prozessänderung in die Matrix aufgenommen werden (vgl. (Zweck, 2005, S. 274)) oder die relevanten Achsen werden auf mehrere Dimensionen ausgedehnt (vgl. (Lettl, 2004, S. 15 ff.)). Der am einfachsten anzuwendende Skalenaufbau betrifft darüber hinaus Mittel und Zweck: erreicht eine Innovation in beiden Dimensionen hohe Werte, liegt eine radikale Innovation vor. Eher seltener wird auch die Ausprägung selbst variiert: etwa kann in frühen Phasen des Innovationsprozesses Unsicherheit (statt Änderung bzw. Neuerung) als Gradmesser verwendet werden, um radikale Innovationen im Sinne von Hochrisikovorhaben besser hervorzuheben (vgl. (Walcher, 2007, S. 17)).
Beide Skalenenden stehen außerdem in der Regel auch sequentiell miteinander in Verbindung. Radikale Innovationen wie etwa der Computer oder die Dampfmaschine sind ohne schrittweise Annäherung kaum denkbar (vgl. (Hirsch-Kreinsen, 2010, S. 76)). Umgekehrt spielen inkrementelle Innovationen insbesondere in Reifungsphasen oftmals eine zentrale Rolle, da sie ein einmal etabliertes Produkt weiter verbessern und gegebenenfalls zu neuem Aufschwung verhelfen können (vgl. (Gerum, Sjurts, & Stieglitz, 2004, S. 29)). Zuletzt beeinflussen sich die Achsen in der Regel auch gegenseitig: neue Komponenten bedingen beispielsweise oftmals neue Architekturen und umgekehrt (vgl. (Scigliano, 2003, S. 22 f.)). In diesem Zusammenhang weist die Begrifflichkeit der radikalen versus inkrementellen Innovation durchwegs inhaltliche Nähe zur prozessorientierten Auffassung von Business Process Reengineering (BPR) versus Kaizen bzw. dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) auf: auch sie beschreiben unterschiedliche Auffassungen der sprunghaften oder schrittweisen Optimierung, allerdings primär aus Sicht des Qualitätsmanagements.
Gerade bei technologisch geprägten Innovationen spielen letztlich bei der Festlegung von Radikalität auch unterschiedliche Technologieklassen eine Rolle. Diese können nach Perl je nach Wettbewerbssituation und Systemintegration zwischen Basis-, Schlüssel-, Schrittmacher- und Zukunftstechnologie unterschieden werden (siehe Abbildung 3, vgl. (Perl, 2007, S. 49 ff.)). Der Branchenstandard wird durch die sogenannten Basistechnologien repräsentiert: Sie sind in der Regel primär für den Fortbestand am Markt von Bedeutung, bieten aber nur geringe Vorteile gegenüber dem Mitbewerb. Demgegenüber stehen Schlüsseltechnologien, durch welche sich eine Organisation gegenüber der Konkurrenz merklich abheben kann und welche sich in der beginnenden Mitte ihres Lebenszyklus mit einem starken Wachstumstrend befinden. Am anderen Ende der Skala finden sich Schrittmacher- und Zukunftstechnologien, welche sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befinden und deren Einsatz mit entsprechenden Unsicherheiten verbunden ist (vgl. (Hofmann, 2007, S. 10 ff.)).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Technologieklassen nach Perl[3]
Zusätzlich werden mitunter noch verdrängte Technologien angeführt, welche ähnlich wie Zukunftstechnologien nur über einen geringen Einfluss auf Wettbewerbsfähigkeit als auch Produkt- bzw. Prozessintegration verfügen und durch andere Technologien ersetzt werden oder wurden. Technologieklassen in Verbindung mit den eigenen Kompetenzen stellen in der Regel den zentralen Entscheidungsanker für richtungsweisende Plattformstrategien eines Unternehmens dar. Typische Haltungen betreffen beispielsweise Make-or-Buy Ansätze (siehe 2.1.4), welche festlegen ob eine Technologie selbst entwickelt oder von Dritten bezogen werden soll. Darüber hinaus wirken sie sich auch auf bestehende Organisationsstrukturen und die Unternehmensstrategie als solches aus (vgl. (Müller-Prothmann & Dörr, 2009, S. 35)).
Nach Kroy können Innovationen aus dieser Sicht auch anhand ihrer Technologieklassen in Verbindung mit der jeweiligen Marktsicht auf ihre Radikalität unterschieden werden (vgl. (Helbig & Mockenhaupt, 2009, S. 8)). Inkrementelle Innovationen beziehen sich dabei auf bestehende oder verwandte Märkte und agieren weitgehend auf bekannten Anwendungsgebieten (Basis- und Schlüsseltechnologien). Radikale Innovationen weisen demgegenüber einen weitaus höheren Neuheitsgrad auf (Schrittmachertechnologien) und agieren darüber hinaus auch auf neuen Märkten (siehe Abbildung 4). Demgemäß reicht die Bandbreite von Innovationen von Produktlinienergänzungen bis hin zu Weltneuheiten wie etwa dem Mobiltelefon Ende der 1990er Jahre (vgl. (Bergmann & Daub, 2006, S. 60)).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Radikale Innovationen nach Kroy[4]
Zusammenfassend bauen inkrementelle Innovationen verstärkt auf bisherigen Kernkompetenzen auf und sind daher tendenziell risikoärmer, näher am bisherigen Kerngeschäft und wirtschaftlicher leichter beurteilbar als auch mit den bestehenden Strukturen leichter vermarktbar bzw. verkaufbar (vgl. (Gassmann & Sutter, Praxiswissen Innovationsmanagement: Von der Idee zum Markterfolg, 2008, S. 9)). Radikale Innovationen beinhalten demgegenüber meist das höhere Potential, ermöglichen sprunghafte Kostensenkungen und können die wirtschaftliche Basis eines Unternehmens verändern, sind zugleich aber auch riskanter und binden in der Regel auch wesentlich mehr Ressourcen (vgl. (Pikkemaat, Peters, & Weiermair, 2006, S. 54 f.), (Krieger, 2005, S. 13)). Aus Unternehmenssicht bedeutet der hohe Innovationsgrad einer radikalen Innovation in jedem Fall auch eine markante Veränderung gegenüber der bisherigen Ist-Situation (vgl. (Scigliano, 2003, S. 15)). So können beispielsweise veränderte Strukturen, Maschinen oder Fähigkeiten und Kompetenzen notwendig sein (vgl. (Gresse, 2010, S. 84)) oder durch das geänderte Portfolio neue Marktsegmente gewonnen werden (vgl. (Köster & Wagner, 2009)). Vor allem anderen sind aber sowohl technologische Umsetzbarkeit als auch Marktakzeptanz bei radikalen Innovationen am wenigsten gut prognostizierbar. Da inkrementellen Innovationen insgesamt auf lange Sicht die Eigenschaft innewohnt, abnehmende Erträge zu erbringen, treten radikale Innovationen früher oder später allerdings letztlich in jedem Sektor auf (vgl. (Weilinger, 2008, S. 52)).
Welchen Innovationsgrad ein Unternehmen bereit ist einzugehen, hängt oftmals von zahlreichen Faktoren ab, beispielsweise der generellen Innovationsstrategie der Organisation als auch dem individuellen Wettbewerbsumfeld. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt stellt darüber hinaus das finanzielle Risikopolster des jeweiligen Unternehmens dar, da gerade bei radikalen Innovationen häufig die dafür notwendigen Infrastrukturen anfangs fehlen: so gab es beispielsweise bei Einführung des Autos kaum Tankstellen, bei Videokassetten fehlten Videotheken (vgl. (Debus, 2002, S. 101)). Organisationen sind demnach gefordert, nicht nur die Kosten für die Entwicklung der Innovation zu tragen, sondern auch deren Einbindung am Markt durch entsprechende Vertriebsmaßnahmen sicherzustellen, um kein Video2000-Schicksal zu erleiden. Das damit verbundene Risiko kann dabei ebenso zum „radikalen“ Sieg wie auch Verlust führen. Wie wichtig insbesondere radikale Innovationen für Europa werden könnten, zeigt auch eine Veröffentlichung der EU aus dem Jahr 2005:
„ Die gesamte europäische Wirtschaftslandschaft befindet sich im Umbruch. Zum einen verändert der globale, wissensbasierte Wettbewerb das Umfeld der europäischen Industrie von Grund auf, zum anderen können Europa und die übrige industrialisierte Welt ihre Führung auf technologischem Gebiet nicht länger als selbstverständlich betrachten. … Das gegenwärtige Wachstum, die Produktivität und die Schaffung von Arbeitsplätzen, reichen nicht aus, um den gewohnten Wohlstand auch in Zukunft zu sichern. Darüber, dass Forschung, Ausbildung und Innovation die Hauptelemente jeder Reaktion auf diese Herausforderungen sein müssen, besteht breiter Konsens. Dazu sollten radikale bzw. grundlegende Innovationen und risikobehaftete Forschung verstärkt unterstützt werden. “ (Europäische Kommission nach (Mandl, 2005, S. 1))
Im Kontext des Medici Effektes wird nachfolgend der Schwerpunkt insbesondere auf radikale und weniger auf inkrementelle Innovationen gelegt, da diese im vordergründigen Fokus der Arbeit von Frans Johansson stehen. Demgemäß kann eine radikale Innovation aus Ergebnissicht dann als solche gesehen werden, wenn möglichst unterschiedliche Ansätze miteinander zielführend verknüpft werden und in einem marktwirtschaftlich orientierten Ergebnis münden.
2.1.2 Pioniere der Innovationsforschung
Die Entwicklung der Innovationstheorie
Die Innovationstheorie stellt ein relativ junges Gebiet dar und datiert in ihrer Entstehung im Wesentlichen auf Veröffentlichungen von Joseph A. Schumpeter Anfang des 20. Jahrhunderts zurück (vgl. (Ili, 2010, S. 25 ff.)). Er legte das Fundament zur grundlegenden Auffassung von Innovation, welche beinahe ein halbes Jahrhundert lang wegweisend bleiben sollte und Innovationen primär als notwendigen Prozess des Fortschritts definiert.
Untermauert wurden Schumpeter’s Ansichten in der Nachkriegszeit durch Publikationen des amerikanischen Nobelpreisträgers Robert M. Solow, welcher durch Beobachtungen der US-Wirtschaft rund 88% des amerikanischen Wirtschaftswachstums auf technologische Fortschritte zurückführte (vgl. (Disselkamp, 2005, S. 16)). Sein makroökonomischer Ansatz zum technischen Fortschritt wurde insbesondere durch Arbeiten von David J. Teece in den 1980er Jahren um einen mikroökonomischen Ansatz erweitert. Teece identifizierte zwei Faktoren, die wesentlich entscheiden, ob Innovationen einem Unternehmen zum Erfolg verhelfen können oder nicht: Mechanismen zum Schutz von geistigem Eigentum („appropriability regime“) und Komplementärgüter, die die Nutzung der Innovation erst möglichen („complementary asset“).
Mit Teece begann auch eine lebhafte Diskussion um den Stellenwert von Innovationen für Unternehmen. In den 1990er Jahren blühte die Innovationstheorie schließlich zur Gänze auf und eine wahre Flut an Publikationen zum Thema erörterten Durchführung, Sinnhaftigkeit und Auswirkungen von Innovationen. Neuen Input brachten allerdings insbesondere Arbeiten von Henry W. Chesbrough Anfang des 21. Jahrhunderts. Er definierte den Begriff der Open Innovation und schlug vor, die bisherigen F&E-Aktivitäten über die Unternehmensgrenzen hinweg zu öffnen. Aktuelle Publikationen zur Innovationstheorie beziehen sich meist auf den Ansatz von Chesbrough, welcher derzeit umfassend diskutiert wird. Eine Übersicht zu relevanten Arbeiten gibt Abbildung 5, wobei Johansson mit dem Medici Effekt entsprechend nachgetragen wurde.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Entwicklung der Innovationstheorie nach Ili[5]
Nachfolgend werden insbesondere zwei Pioniere der Innovationstheorie herausgegriffen und exemplarisch näher beschrieben: Schumpeter und Hauschildt. Der Ansatz der Open Innovation nach Chesbrough wird darüber hinaus unter 2.3.3 näher beschrieben. Ergänzt werden die Ausführungen darüber hinaus durch das Diffusionsmodell von Rogers.
1911/1934: Innovation als „schöpferische Zerstörung“ nach Schumpeter
Im Bereich der Wirtschaftsinformatik wurde der heute übliche Begriff von Innovation im Sinne einer technisch-ökonomischen Entwicklung wesentlich durch den österreichisch-amerikanischen Ökonomen Joseph A. Schumpeter (1883-1950) geprägt, welcher heute als Vater der Innovationstheorie gilt. Er grenzte in seinen stark wirtschaftswissenschaftlich orientierten Arbeiten, insbesondere der „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ (1911) und den „Business Cycles“ (1939) den Begriff Innovation von der Erfindung selbst strikt ab und sah ihn primär als Durchsetzung einer technischen oder organisatorischen Neuerung im Produktionsprozess selbst.
Demnach tritt Innovation genau dann ein, wenn neue Produktionsfunktionen definiert und infolge dieser, auf einer neuartigen Kombination von bestehenden Produktionsfaktoren basierenden Neuerung, sowohl Wirtschaft als auch Gesellschaft einem Wandel unterzogen werden. Für diese „neuen Kombinationen“, später als Innovationen bezeichnet, sieht Schumpeter im Wesentlichen fünf mögliche Ausprägungen (vgl. (Borbély, 2008, S. 401 f.)):
- Herstellung eines neuen Produktes oder einer neuen Qualität des Produktes (auch kurz als Produktinnovation bezeichnet)
- Einführung einer neuen, noch unbekannten Produktionsmethode (muss nicht auf einer Erfindung basieren und wird auch kurz als Verfahrensinnovation bezeichnet)
- Erschließung eines neuen Absatzmarktes, auf dem ein Industriezweig noch nicht „eingeführt“ war (unabhängig davon, ob dieser Markt schon vorher existierte oder nicht)
- Erschließung einer neuen Bezugsquelle von Rohstoffen oder Halbfabrikaten
- Neuorganisation einer Marktposition (etwa durch Schaffung oder Lösung eines Monopols)
Da durch Einführung einer solchen Kombination gleichzeitig bestehende Prozesse und Praktiken verdrängt werden, spricht Schumpeter auch von einer „schöpferischen Zerstörung“. Sie findet unaufhörlich statt und ermöglicht durch das Aufbrechen von alten Strukturen das laufende Schaffen von neuen. Als wesentliche Grundlage des Kapitalismus verläuft die wirtschaftliche Entwicklung nach Schumpeter je nach Anzahl der von einem System hervorgebrachten Innovationen demgemäß in entsprechenden Wellen zwischen Hochkonjunktur und Krisen, den sogenannten „Konjunkturzyklen“: Innovation ist nach Schumpeter die „ überragende Tatsache in der Wirtschaftsgeschichte der kapitalistischen Gesellschaft “ (Schumpeter, Konjunkturzyklen: Eine theoretische, historische und statistische Analyse des kapitalistischen Prozesses, 2010, S. 93).
Schumpeters breiter Ansatz und seine Auffassung von Neuem als Kombination von Bestehendem wurde nicht nur von Johansson aufgegriffen, sondern findet sich in ähnlicher Form auch bei Comenius‘ bzw. Bouldings‘ „Wissensbaum“ oder Weitzmans „rekombinierendem Wachstum“ (vgl. (Kurz, 2008, S. 18)). Wissen wird dabei als ständig wachsendes Konstrukt verstanden, welches sich über kombinatorische Rückkopplungen mit sich selbst ständig erweitert und damit neue Varianten ausbildet. Da die dadurch entstehenden Kombinationsmöglichkeiten (zumindest theoretisch) unendlich sind, liegt die besondere Herausforderung in der Wartung des Ideenpools und Auswahl von besonders ergiebigen Ideen, welche das Potential für Innovationen inne haben.
Schumpeter sah in seinen frühen Arbeiten stets den „dynamischen“ Unternehmer selbst als wesentlichen Treiber für diese Neuerungen bzw. Auswahl und Durchsetzung von Innovationen und widmete ihm entsprechend viel Aufmerksamkeit in seinen Publikationen. Später nivellierte er diese Ansicht vor dem Hintergrund wachsender Großkonzerne, welche in Gegenüberstellung zu früheren Jahrhunderten zunehmend weniger durch singuläre Einzelführer mit Eigentümerinteressen gekennzeichnet sind und sah die Rolle durch die neuen, durch Manager geprägten Organisationsstrukturen, letztlich sogar als soziologisch obsolet (Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, 2005, S. 513 ff.).
Obwohl seine grundlegenden Aussagen zwischenzeitlich beinahe ein Jahrhundert zurückreichen, beeinflusst Schumpeter bis heute die einschlägige Fachliteratur und hat in den letzten Jahren insbesondere im Kontext von Leitbildern der Globalisierung zu einer regelrechten Schumpeter-„Renaissance“ in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften geführt (vgl. (Ebner, 2007, S. 2 ff.)). Das breite Wiederaufleben von Schumpeters Auffassung zur Innovation seit den 1990er Jahren kann vermutlich vor allem darauf zurück geführt werden, dass die vorgestellten Leitbilder in hohem Ausmaß mit den Vorstellungen global agierender Unternehmen korrelieren, gemäß derer eine Innovation primär unter marktrelevanten Aspekten als solche zu betrachten ist (vgl. (Weber, 2000, S. 8 ff.)). Innovationen werden dabei nicht selten zum Überlebensfaktor weltweiter Konzerne hoch stilisiert, getrieben von immer kürzer werdenden Entwicklungs- bzw. Produktlebenszyklen als auch verdichteten Arbeitsabläufen und begleitet von mitunter radikalen gesellschaftlichen Änderungen.
Das schumpeter’sche Vokabular einer „schöpferischen Zerstörung“ fügt sich dabei jedoch nur scheinbar nahtlos in die aggressive Rhetorik von Modernisierungsbefürwortern. Übersehen wird dabei meist, dass Schumpeter selbst die Entwicklung als terminiert sah und letztendlich die Ablöse des Kapitalismus durch den Sozialismus bis etwa zur Wende des letzten Jahrhunderts prophezeite, nicht zuletzt deshalb, weil die bisherigen Innovationsraten nicht auf Dauer gehalten werden können (vgl. (Faulhaber, 2006, S. 83)). Auch wenn Schumpeter mit der politischen Wende an sich nicht recht behielt, traten zahlreiche andere, von ihm prognostizierten Auswirkungen zwischenzeitlich ein, wie etwa erhöhte Arbeitslosigkeit durch sinkendes Wirtschaftswachstum, weltweite Fusionswellen oder die damit verbundene Bildung von Großunternehmen, die zunehmend durch hoch bezahlte Topmanager mit verstärkten Eigen- (statt Betriebs-) Interessen geprägt sind.
1999: Innovationsdimensionen nach Hauschildt
Einen etwas variierten Ansatz neben dem Klassiker der Innovationsliteratur, Joseph Schumpeter, verfolgt der insbesondere im deutschsprachigen Raum breit zitierte Wirtschaftswissenschaftler Jürgen Hauschildt (1936-2008) mit seiner Betrachtungsweise von Innovation als etwas grundsätzlich „Neuem“. Nach Hauschildt kann es sich bei einer Innovation um ein neues Produkt, neue Märkte, neue Verfahren, neue Vorgehensweisen, Prozesse, Vertriebswege, Werbeaussagen oder anderes mehr handeln, sie sind jedoch in jedem Fall in ihrem Ergebnis wesentlich vom Charakter des „Neuartigen“ geprägt und unterscheiden sich stark von einem vorhergehenden Zustand:
„ Innovationen sind qualitativ neuartige Produkte oder Verfahren, die sich gegenüber einem Vergleichszustand ‚merklich‘ – wie auch immer das zu bestimmen ist – unterscheiden. … Die Neuartigkeit besteht darin, dass Zweck und Mittel in einer bisher nicht bekannten Form verknüpft werden. Diese Verknüpfung hat sich auf dem Markt oder im innerbetrieblichen Einsatz zu bewähren. “ (Hauschildt & Salomo, 2007, S. 4 f.)
Ähnlich wie Schumpeter geht auch Hauschildt hierbei von einer bislang unüblichen Verknüpfung aus, deren „neue“ Ausprägung jedoch in jedem Fall auch wahrgenommen werden muss. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass sich die Innovation inner- oder außerbetrieblich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewähren und sich damit durch Verkauf bzw. Nutzung von der alleinigen Hervorbringung einer Idee in Form einer Invention abgrenzt. Mit diesem kombinatorischen Ansatz reiht sich Hauschildt in eine lange Tradition in der Innovationstheorie ein. Bereits Schumpeter ging von einem ähnlichen Ansatz aus und fasste dies mit der Phrase „ the doing of new things or the doing of things that are already done in a new way “ (Schumpeter nach (Freudenberger & Mensch, 1975, S. 14)) zusammen.
Aus formaler Hinsicht definierte Hauschildt fünf Dimensionen die je nach Ausprägung den Begriff einer Innovation enger oder breiter fassen (vgl. (Hauschildt & Salomo, 2007, S. 5 ff.), (Litschauer, 2007, S. 18 ff.), (Gerber-Balmer, 2000, S. 25 ff.), (Hunneshagen, 2005, S. 33 ff.)):
- Inhaltliche Dimension: Was ist neu an der Innovation?
- Intensitätsdimension: Wie neu ist die Innovation?
- Subjektive Dimension: Für wen ist die Innovation neu?
- Prozessuale Dimension: Wo beginnt, wo endet die Innovation?
- Normative Dimension: Ist neu gleich erfolgreich?
Interessant sind hierbei insbesondere im Kontext von Johansson die zweite und letzte Dimension, welche nachfolgend herausgegriffen werden. So ist die Intensitätsdimension insbesondere aus betriebswirtschaftlicher Sicht von besonderer Bedeutung, da mit einem höheren Neuerungsgrad in der Regel auch höhere Risiken als auch Kosten einhergehen. Hauschildt unterscheidet in der Intensität grundsätzlich zwischen inkrementellen und radikalen Innovationen (siehe 2.1.1), wobei letztere Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen (und gegebenenfalls auch darüber hinaus) haben und dementsprechend gesamthaft koordiniert werden müssen. Aufgrund des fließenden Überganges zwischen den beiden Skalenbereichen schlägt er zur Messung ein Scoring-Modell vor, welches den Grad der Neuerung auf einzelne Aspekte zurückführt und in Relation zu bestehenden Produkten bzw. Verfahren setzt.
Eine wesentliche schwierigere Eingrenzung birgt die normative Dimension, welche eine Innovation in Relation zum Erfolgsgrad setzt. Aufgrund der unscharfen Festlegung des Begriffes „Erfolg“ geht Hauschildt von einer engeren und weiteren Auslegung aus. Aus der rein betriebswirtschaftlichen Sicht kann eine Innovation etwa dann als erfolgreich gelten, wenn finanzielle Größen wie beispielsweise Gewinne, Umsätze bzw. Einsparungen als Vergleichsinstrument herangezogen werden. In einer umfassenderen Betrachtung spielen zunehmend schwieriger zu messende Aspekte wie der Nutzen für einen angepeilten Zielmarkt eine Rolle, welche allerdings insbesondere im Bereich von Innovationen meist entweder nicht bekannt oder schwer vergleichbar sind. Dementsprechend merkt Hauschildt auch kritisch an, dass diese Dimension realistischerweise meist erst im Nachhinein ermittelt werden kann und zumindest im Bereich der frühen Einstufung einer Innovation von untergeordneter Rolle ist (vgl. (Hauschildt & Salomo, 2007, S. 22)).
2003: Diffusionsmodell nach Rogers
Einem speziellen Aspekt von Innovation widmete sich der etwa zeitgleich mit Hauschildt tätige amerikanische Kommunikationsforscher und Soziologe Everett M. Rogers (1931-2004) mit seiner Diffusionstheorie zur Innovation, auch Adopter- oder Adoptorenmodell genannt. Nach Rogers werden durch die Einführung und Verbreitung von Innovationen in sozialen Systemen spezifische Prozesse ausgelöst, durch welche Benutzer in verschiedene Käufergruppen unterschieden werden können. Der Begriff der Diffusion beschreibt dabei den Ausbreitungsprozess auf Ebene des Marktes, während jener der Adoption sich auf das Verhalten des einzelnen Kunden (Akzeptanz oder Ablehnung) bezieht. Wird eine Invention im Markt eingebracht, stellt sich stets die Frage wie und ob potentielle Kunden die Neuerung ablehnen oder annehmen (vgl. (Zotter, 2007, S. 79 ff.)).
Zu Beginn der Markteinführung wird eine Innovation nach Rogers von einer relativ kleinen Gruppe angenommen, den sogenannten Innovatoren. Sie machen nur etwa 2,5% der Bevölkerung aus und kennzeichnen sich durch eine relativ hohe Risikobereitschaft als auch einen ebensolchen sozioökonomischen Status. Ähnliche Eigenschaften weist die darauf folgende Gruppe der Frühadaptoren (engl. early adopter) mit etwa 13,5% auf, wobei sie tendenziell über weniger Risikobereitschaft verfügen und den Kauf vor allem aus Prestigegründen tätigen. Zusammen mit den Innovatoren zählen sie zur wichtigsten Gruppe aus Marketingsicht, da sie eine hohe meinungsbildende Funktion ausüben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Auf sie folgt eine frühe und im Anschluss späte Minderheit mit je 34%. Während erstere eher sorgfältig den Kauf von neuen Produkten abwägt und etwas über dem sozioökonomischen Durchschnitt liegt, steht die späte Minderheit Neuerungen generell eher skeptisch gegenüber und ist parallel dazu etwas unter dem sozioökomischen Durchschnitt einzuordnen. Beiden Käufergruppen ist gemein, dass sie keine Führungsposition als solche inne haben, sich tendenziell spät und (vor allem letztere Gruppe) unter dem zunehmenden Druck der Umgebung zum Kauf entscheiden. Die verbleibende Gruppe mit 16% wird von Rogers als Zauderer beschrieben und kennzeichnet all jene Käufer die eher an bestehenden Traditionen orientiert sind und Innovationen generell skeptisch gegenüberstehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Rogers Diffusion von Innovationen[6]
Dieser Prozess der Marktausbreitung über die Zeit stellt sich nach Rogers wie eine Glockenkurve dar und kann darüber hinaus in Relation zum gängigen Produktlebenszyklus in S-Form gestellt werden (siehe Abbildung 6): erreicht eine Innovation den Break-Even, geht sie zugleich über in den Arbitragestatus und kann von dort durch Evolution weiter entwickelt werden oder in eine rückläufige Phase übergehen (aus welcher jedoch eventuell wieder eine neue Innovation entsteht). Innovation hat damit einen stark vergänglichen Charakter und steht auch relativ zur Zeit: so mögen Galileo-Fernrohre Anfang des 17. Jahrhunderts als innovativ gegolten haben, heute sind sie eher als Antiquität einzustufen.
Rogers benennt im Zuge seines Modells fünf Eigenschaften einer Innovation, die wesentlichen Einfluss auf die Kaufentscheidung und damit auch die Geschwindigkeit der Ausbreitung insgesamt haben können (vgl. (Rogers, 2003, S. 15 f.)):
- Der subjektive Vorteil einer Innovation (z.B. Prestigegewinn)
- Die Kompatibilität mit einem vorhandenen Wertesystem (z.B. Kundenbedürfnisse)
- Die Komplexität bzw. die beim Erstkontakt gefühlte Einfachheit
- Die Probierbarkeit (Möglichkeit des Experimentierens mit der Innovation)
- Die Sichtbarkeit der Innovation (für andere, zur Vereinfachung der Nachahmung)
Am einflussreichsten sieht Rogers dabei den subjektiven Vorteil, welcher sich in Relation zu vergleichbaren Alternativen für den bzw. die individuelle/n KäuferIn zeigt. Nach dieser Auffassung bestimmt vor allem der jeweilige Zielmarkt, ob ein Produkt oder ein Prozess innovativ ist und nicht ein objektives Begriffsmodell.
2.1.3 Merkmale von Innovationen
Merkmale nach Thom
Innovationen manifestieren sich über die ihnen innewohnenden Merkmale. Nach dem deutschen Wirtschaftswissenschaftler Norbert Thom weisen sie grundsätzlich vier dominante Merkmale auf: sie sind neu, riskant, komplex und darüber hinaus konfliktreich (vgl. (Thom & Ritz, Public Management: Innovative Konzepte zur Führung im öffentlichen Sektor, 2007, S. 131 ff.)). Insbesondere der Neuigkeitsgrad als auch die mit Innovationen verbundene Komplexität stellen dabei besondere Herausforderungen für alle Beteiligten des Innovationsprozesses dar und können sowohl Risiko als auch Konfliktpotential erheblich erhöhen (siehe Abbildung 7).
Wie auch in anderen Modellen gilt auch hier als wesentlichstes Merkmal grundsätzlich der Neuheitsgrad von Innovationen. Je nach betrachtetem Horizont, beispielsweise eine Branche oder die ganze Welt, wird ein Innovationsprozess, welcher initial die Innovation einführt, erstmalig und zugleich einmalig in ebendiesem durchgeführt. Der Innovationsprozess für eine bestimmte Neuerung kann demnach im jeweiligen Umfeld nur einmal abgewickelt werden, um auch als solches zu gelten, kann aber für verwandte Klassen eines Horizontes wie beispielsweise Konsumprodukte, durchwegs ähnlich verlaufen. Darüber hinaus haben Innovationen stets einen Zeitbezug: sie stellen immer in Relation zur aktuell betrachteten Zeit und Menge an bereits vorhandenen Elementen eine Neuheit dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Dominante Merkmale von Innovationen nach Thom[7]
Mit steigendem Innovationsgrad erhöhen sich darüber hinaus das damit verbundene Risiko und die Unsicherheit bei der Einführung. Letztlich werden nur wenige Ideen zu erfolgreichen Innovationen und können sich am Markt bewähren. Die Gründe für die hohe Ausfallquote bei Innovationen sind vielfältig und reichen von fehlender Akzeptanz beim Zielpublikum bis hin zu organisatorischen bzw. technischen Mängeln oder schlichtweg einem unzureichenden Kosten-Nutzen-Verhältnis. Während Risiken in technischer, wirtschaftlicher oder zeitlicher Hinsicht durch Wahrscheinlichkeiten des Eintritts quantifiziert werden können, sind Ungewissheiten nicht-quantifizierbar und dementsprechend schwieriger zu handhaben.
Des Weiteren sind an Innovationen in der Regel eine Vielzahl an Personen und Organisationen beteiligt, was wiederum zu einer hohen Komplexität führt. Zahlreiche Entscheidungen wie auch repetitive und gleichzeitig parallele Handlungen sind im Normalfall notwendig, um eine erfolgreiche Innovation zu bewerkstelligen. Gleichzeitig sind die Sichten der jeweiligen Stakeholder in der Regel sehr unterschiedlich und von mitunter schwer vereinbaren Zielen und Vorstellungen zur Vorgehensweise geprägt. Da Innovationsmanagement nicht nur eine interne Querschnittsaufgabe darstellt, sondern auch i.d.R. Verbindungen außerhalb des Unternehmens aufweist, können Aspekte wie Gesetzgebung oder Technologieänderungen von Dritten ebenfalls zu einer erheblichen Erhöhung der Komplexität beitragen (vgl. (Perl, 2007, S. 36)).
Steigende Komplexität geht letztlich auch mit einer erhöhten Konfliktwahrscheinlichkeit einher. Dies kann ursächlich mit den unterschiedlichen Stakeholdern in Verbindung gebracht werden, ist allerdings auch oftmals durch die mit Innovationen bedingte Unsicherheit geprägt. Ideengeber können Angst vor der aus ihrer Sicht unzulässigen Änderung der Neuerung haben, beteiligte Organisationseinheiten bzw. ihre MitarbeiterInnen können die Innovation als bedrohlich für ihre Position empfinden oder Kapitalgeber können bei geringsten Verzögerungen ihr Einschreiten als notwendig erachten. Neben personenbezogenen Konflikten können darüber hinaus allerdings noch weitere Rivalitäten entstehen, beispielsweise zu bestehenden Produkt- und Prozesslandschaften, der aktuellen Rechtslage oder allgemein moralischen Bedenken (z.B. Gentechnologie). Nicht immer muss der Konflikt hierbei negativ sein, oftmals ergeben sich dadurch auch Ansätze für weitere Innovationen oder wichtiger Input für das aktuelle Vorhaben.
Merkmale nach Heesen
Marcel Heesen führte neben den von Thom etablierten Merkmalen noch zwei weitere Aspekte in die Merkmalsbildung von Innovationen ein, welche vor allem für die Praxis des Innovationsmanagements von Bedeutung sind und nachfolgend ergänzend angeführt werden: jenen der Irreversibilität und des Spillover (vgl. (Heesen, 2009, S. 17 ff.)).
Als Spillover-Effekte werden nach Heesen grundsätzlich Auswirkungen auf andere Objekte bezeichnet, wobei es sich dabei um Produktsynergien, Folgeprojekte oder auch generelle Auswirkungen auf Infrastruktur und Lerneffekte handeln kann. Diese Eigenschaft ist nach Heesen vor allem aus Sicht des praktischen Innovationsmanagements von Bedeutung, da sie in der Regel unmittelbaren Einfluss auf die jeweilige Innovationauswahl hat. Vorhaben mit hohen Synergieeffekten für bereits bestehende Produkte oder Märkte wird demgemäß beispielsweise der Vorzug gegeben vor Innovationsprojekten mit wenig Zusammenhang zum bestehenden Portfolio.
Unter Irreversibilität versteht Heesen im Kontext von Innovationen den Umstand, dass eine einmal getroffene Entscheidung als auch deren Konsequenzen nicht oder nur mit unverhältnis hohen Aufwänden rückgängig gemacht werden kann. Dies betrifft im konkreten Fall von Innovationsvorhaben vor allem die investierten Aufwände, welche durch die hohe Spezialisierung und den Neuartigkeitscharakter meist nicht oder nur teilweise in anderen Zusammenhängen wiederverwendet werden können. Erweist sich eine Innovation beispielsweise im Verlauf der Entwicklung als nicht zielführend oder wurde sie bereits von einer anderen Innovation überholt, steht die Organisation in der Regel vor der Entscheidung eines Abbruchs und dem potentiellen Verlust des investierten Kapitals.
Spillover wie auch Irreversibilität werden, zumindest in Teilen, durch das Risikomerkmal von Thom abgebildet. Ihre explizite Merkmalshervorhebung kann allerdings im praktischen Innovationsmanagement durchwegs sinnvoll sein und insbesondere im Bereich des Portfoliomanagements bei der Auswahl von Innovationsvorhaben hilfreich sein.
2.1.4 Klassifikation von Innovationen
Klassifikationsvarianten
Innovationen können nach unterschiedlichsten Aspekten klassifiziert werden. Dies ist einerseits aus formaler Sicht von Bedeutung und wirkt sich umgekehrt auch unmittelbar auf den Umgang mit den im Zuge dieser Arbeit relevanten Innovationsbereichen aus. Nachfolgend wird eine Übersicht zu unterschiedlichen Klassifikationen gegeben in Richtung Art, Herkunft, Auslöser und Markteintritt. Zwei weitere Klassifikationen – nämlich den Grad (radikal/inkrementell, siehe 2.1.1) als auch Beteiligtenform (open/closed, siehe 2.3.3) finden sich an anderer Stelle und werden hier nicht mehr aufgeführt. Darüber hinaus sei ergänzend erwähnt, dass die nachfolgenden Klassifikationen, mit Ausnahme der Innovationsart, grundsätzlich auch als Innovationsstrategien betrachtet werden können.
Klassifikation nach Art (Produkt vs. Prozess)
Innovationsmanagement kann sich grundsätzlich auf die unterschiedlichsten Bereiche beziehen, wird allerdings meist im Kontext von Produkten und Prozessen betrachtet. Produktinnovationen bezwecken meist einen höheren Kundennutzen und steigern in erster Linie die Effektivität, vor dem Hintergrund eine neue Leistung entstehen zu lassen, „ die (es) dem Benutzer erlaubt, neue Zwecke zu erfüllen bzw. vorhandene Zwecke in einer völlig neuartigen Weise wahrzunehmen “ (Walcher, 2007, S. 14). Prozessinnovationen streben hingegen vordergründig eine höhere Effizienz an und zielen insbesondere darauf ab, „ die innerbetriebliche Faktorkombination hinsichtlich Kosten, Zeit, Sicherheit und Qualität zu optimieren “ (Walcher, 2007, S. 14). Dementsprechend werden Produktinnovationen tendenziell eher im außer- und Prozessinnovationen verstärkt im innerbetrieblichen Kontext auf ihre Durchsetzungsfähigkeit hin geprüft.
In der Praxis sind die beiden Innovationsarten nicht immer klar voneinander zu trennen; insbesondere Hauschildt weist in diesem Kontext darauf hin, dass beispielsweise Dienstleistungsinnovationen, welche in der Regel zu Produktinnovationen zählen, meist sowohl Produkt- als auch Prozessinnovationen involvieren (vgl. (Hauschildt & Salomo, 2007, S. 8)). Eine ähnliche Verkettung kann auch bei marktgetriebenen Produktinnovationen auftreten, welche ggf. eine neuartige Umsetzung von innerbetrieblichen Prozessen nach sich ziehen, etwa wenn neue Früchte in der Landwirtschaft eine veränderte Form des Anbaus notwendig machen (vgl. (Jünger, 2008, S. 70)). Unabhängig davon besteht oftmals ein Zusammenhang zwischen dem Reifegrad eines Unternehmens und seinen Innovationsaktivitäten: junge Organisationen investieren demgemäß primär in Produktinnovationen, während sich dies in späteren Phasen zunehmend hin zu Prozessinnovationen verlagert (siehe Abbildung 8).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Produkt- und Prozessinnovationen in Relation zum Reifegrad[8]
Innovationen im Bereich Produkt bzw. Dienstleistung als auch Prozess weisen darüber hinaus einige Besonderheiten auf, die nachfolgend etwas näher beleuchtet werden (vgl. (Müller-Prothmann & Dörr, 2009, S. 39 ff.)). Die Entwicklung eines neuen Produktes geschieht primär über die Etappen Machbarkeit, Prototyp und Serienreife. Im Zuge der technisch orientierten Machbarkeit werden grundsätzliche Fragen der Umsetzung geklärt, welche in der Regel durch wirtschaftlich orientierte Daten ergänzt werden. Erst bei einem Go aus diesen Gesichtspunkten heraus erfolgt die Erstellung eines Prototyps (bzw. Produktmusters), der (bzw. das) nach positiven Tests in die Serienreife überführt wird. Besondere Herausforderungen bei der Produktentwicklung stellen in der Regel der Umgang mit Änderungserfordernissen als auch die Verkürzung der Entwicklungszeiten dar. Zur Bewältigung dieser Aspekte haben sich insbesondere Verfahren des Rapid Prototyping etabliert (RPD): Ziel des RPD ist es, die Produktentwicklungszeiten durch evolutionäres Vorgehen bereits in frühen Entwicklungsphasen möglichst zu reduzieren und zeitnahe kundenoptimierte Entwürfe zu produzieren. Dazu werden beispielsweise alternative Produktkonzepte parallel entwickelt, zeitlich enge iterative Schleife für Anforderung / Umsetzung / Bewertung vorgesehen als auch kontinuierliche Feedback-Loops eingeplant.
Im Bereich der Dienstleistung gestaltet sich die Entwicklung durch den Prozesscharakter durchwegs mit etwas veränderten Schwerpunkten. Da Dienstleistungen grundsätzlich immateriell und damit nicht „konservierbar“ sind (außer sie sind an materielle Güter gekoppelt), fallen Produktion und Konsumption in der Regel zusammen („Uno-actu-Prinzip“). Die Implementierung der Dienstleistung im Sinne eines Prototyps geschieht deshalb meist erstmalig beim Kunden und unterscheidet sich hierdurch von der reinen Produktinnovation.
Je nach AutorIn können darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Innovationsarten unterschieden werden, wobei diese meist entweder einen speziellen Bereich attributiv hervorheben oder kompensatorisch das Gegenstück zu nicht-technologischen Innovationen umfassen. Eine dieser Ausprägungen stellt die sogenannte Strukturinnovation dar, welche die „ Entwicklung eines neuen Geschäftssystems bzw. eines Geschäftsmodells “ (Jünger, 2008, S. 71) bezeichnet. Dieses kann im konkreten Fall die Funktionalität einer Arbeitsstruktur betreffen, aber auch Optimierungen im Bereich Vertrieb, Marketing, Organisation oder Logistik. Hauschildt führte demgegenüber den Ausdruck der „ postindustriellen Systeminnovation“ (Hauschildt & Salomo, 2007, S. 11) ein, welche für die unterschiedlichsten Branchen anwendbar ist und sich primär durch einen nicht-industriellen Charakter kennzeichnet. In diesen Bereich fallen beispielsweise Innovationen wie Leasing, Kreditkarten, Franchising usf.
Eine ähnliche Denkhaltung verfolgt Thom, welcher zwischen der Triade Produkt-, Verfahrens- und Sozialinnovation unterscheidet. Letztere betreffen den Humanbereich und können sich beispielsweise durch neuartige Salärsysteme oder Weiterbildungskonzepte manifestieren (vgl. (Thom, Grundlagen des betrieblichen Innovationsmanagements, 1980, S. 32 ff.)). Da sich die Auffassung von Thom weitgehend durchgesetzt hat, wird, sofern nicht anders erwähnt, stets diese Form der Bereichsgliederung in vorliegender Arbeit eingesetzt.
Klassifikation nach Herkunft (make vs. buy)
Organisationen sind im Zuge von Innovationen stets gefordert sich weiter zu entwickeln. Gleichzeitig muss das dafür notwendige Knowhow nicht zwangsweise den Unternehmensstrukturen selbst entstammen (Neuentwicklung), sondern kann auch von Dritten erworben werden (Akquisition). Dies wird oft kurz mit der Floskel make-or-buy beschrieben.
Bei einer Akquisition werden nach Bergmann et al. grundsätzlich drei mögliche Formen unterschieden (vgl. (Bergmann & Daub, 2006, S. 59 f.)): die Organisation kann Lizenz- oder Franchiseabkommen mit Dritten schließen, sie kann Patente und Schutzrechte erwerben oder aber sie kann ganze Unternehmen zukaufen. Gerade letztere Strategie wurde in den letzten Jahren durch zahlreiche Großkonzerne wie Oracle oder Nestle umfassend ausgelebt. Das Unternehmen ist in diesen Fällen in der Regel zwar nicht mit den Aufwänden und Risiken der Neuentwicklung konfrontiert, sie muss das zugekaufte Innovationswissen allerdings in weiterer Folge erst in die eigenen Strukturen integrieren und an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
Alternativ kann sich eine Organisation auch zu einer Neuentwicklung entschließen. Hierbei werden nach Bergmann vordergründig die zwei Varianten der Entwicklung in der eigenen F&E-Abteilung oder durch Dritte unterschieden. Letztere Ausprägung hebt sich vor allem dadurch von einer klassischen Buy-Lösung ab, dass die Organisation unmittelbaren Einfluss in den Erstellungsprozess hat und dadurch die Innovation bereits frühzeitig an die eigenen Bedürfnisse anpassen als auch zwischenzeitlich eigenes Knowhow aufbauen kann. Mögliche Gründe für eine Neuentwicklung im Innovationsbereich können aus Unternehmenssicht beispielsweise die strategische Bedeutung im Sinne von Kernkompetenzen oder auch die fehlende Lieferantenstruktur sein (siehe Abbildung 9).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 9: Make-buy Entscheidungsmatrix nach Strategie/Lieferant[9]
Obwohl sich Unternehmen auch hier meist zu einer strategischen Vorgangsweise entscheiden und eine der beiden Varianten (oder Mischformen) im Grundsatz präferieren, wird die jeweilige Entscheidung letztlich jedoch meist anlassfallbezogen getroffen. Da gerade bei Innovationen auch rechtliche Aspekte eine bedeutsame Rolle spielen, setzen große Unternehmen heute nicht selten auf die Akquisition kleinerer Unternehmen oder gliedern umgekehrt Spin-offs aus, um die Schwerfälligkeit des eigenen Apparates zu umgehen. Umso wichtiger werden in diesem Fall Trendscouts bzw. gut vernetzte InnovationsmanagerInnen im eigenen Unternehmen.
Klassifikation nach Auslöser (push vs. pull)
Einen insbesondere aus Sicht des Innovationsmanagements wichtigen Aspekt stellen auslösende Faktoren dar. Nach Perl kann hierbei primär zwischen „technology push“ und „demand pull“ unterschieden werden (vgl. (Perl, 2007, S. 41 f.)), je nachdem ob der Anstoß für die Innovation vom Unternehmen oder Markt heraus erfolgt (siehe Abbildung 10).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 10: Wechselspiel zwischen technology-push und demand-pull[10]
Bei „demand pull“ spricht man auch von nachfrageinduzierten Innovationen. In diesem Fall verlangt der Markt, bzw. konkret die Kunden, nach einer Innovation im Sinne eines neuen oder verbesserten Produktes, beispielsweise aufgrund von veränderten Lebensbedingungen oder neuen Anwendungsmöglichkeiten. In eher seltenen Fällen kann auch eine Prozessinnovation gefordert werden. Da der Absatzmarkt in diesem Fall bereits vorhanden ist, verlaufen Innovationen dieser Art meist erfolgreich. Demgegenüber stehen „technology push“ oder technologieinduzierte Innovationen, welche vom Unternehmen ausgelöst werden und sich i.d.R. sowohl auf Produkte als auch Prozesse beziehen. Ursachen liegen meist in technischen Fortschritten oder technologischen Entwicklungen, welche nicht zwangsweise mit einem konkreten Zielmarkt in Verbindung stehen, gleichzeitig aber die langfristige Position des Unternehmens stärken. Da in diesen Fällen die notwendigen Zielgruppen erst gefunden bzw. das Bedürfnis beim Kunden erst geweckt werden muss, sind Innovationen dieser Art i.A. mit einem wesentlich höheren Risiko verbunden.
Beide Ansätze sichern letztlich auf lange Sicht die Wettbewerbsfähigkeit einer Organisation, weshalb Unternehmen in der Regel einen Ausgleich zwischen der eher kurzfristigen Kunden- und langfristigen Technologieperspektive wählen. Dies ist nicht zuletzt darin begründet, da ein demand-pull viel eher auf bestehende Märkte fokussiert und meist über eine geringere Erfindungshöhe verfügt, während ein technology-push grundsätzlich stärker neue Märkte adressiert und eher radikalere Auswirkungen mit sich bringt. In vielen Fällen stehen die beiden Ansätze auch indirekt miteinander in Verbindung, etwa wenn eine Forderung seitens des Marktes eine technologische Neuerung innerbetrieblichen Charakters zwingend notwendig macht. So kann ein demand-pull in Form eines umweltfreundlicheren Kfz-Motors beispielsweise unternehmensintern zu einem technology-push in Form neuer Herstellungsverfahren oder Fertigungsroboter führen (vgl. (Jünger, 2008, S. 70)).
Darüber hinaus sind Pull- und Push-Ansätze auch durchwegs branchenabhängig: so spielt ein technology-push bei dienstleistungszentrierten Branchen wie etwa dem Tourismus eine untergeordnete Rolle, während hier viel eher der demand-pull in Form von verändernden Kundenanforderungen anzutreffen ist (vgl. (Pikkemaat, Peters, & Weiermair, 2006, S. 56 ff.)). In diesem Bereich spricht man deshalb auch häufiger allgemein von Push- und Pull-Ansätzen (bzw. etwas pleonastisch von supply-push bzw. demand-pull), welche sich nicht gezwungenermaßen auf Technologien beschränken, sondern sich generell aus der Angebots- und Nachfragesituation ergeben.
Klassifikation nach Markteintritt (Pionier vs. Folger)
Betrachtet man den Markteintritt einer Innovation können nach Corsten et al. primär zwei Positionen differenziert werden: Pionierstrategie („first to market“) oder Folgestrategie („follow the leader“ oder „second to market“), je nachdem ob ein Unternehmen eine Innovation als erstes am Markt einbringt oder einem anderen Unternehmen folgt (vgl. (Müller-Prothmann & Dörr, 2009, S. 14 f.), siehe Abbildung 11).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 11: Markteintrittspunkte nach Corsten[11]
Im Bereich von Innovationen stellt die Pionierstrategie die Markteinbringung im ursprünglichen Sinne dar. Ein Unternehmen strebt in diesem Fall an, eine Innovation als erstes in einen Markt einzubringen und sich dadurch ein temporäres Quasi-Monopol zu verschaffen. Die offensichtlichen Vorteile dieser Vorgangsweise liegen vordergründig in der Möglichkeit Wettbewerbsbarrieren zu schaffen und durch den Knowhow-Vorsprung höhere Gewinne zu erzielen als auch Standards zu etablieren. Als nachteilig können sich allerdings das damit verbundene Risiko und die hohen Aufwände der Markteinführung zeigen. Durch die geringen Erfahrungen mit der neuen Technologie und der eventuell fehlenden Infrastruktur können sich darüber hinaus weitere Gefahren zeigen.
Möchte ein Unternehmen nicht die mit einer Pionierstrategie verbundenen Risiken eingehen, wählt es in der Regel eine Folgestrategie, wobei hierbei meist zwischen frühen und späten Folgern unterschieden wird. In diesem Fall wird die Innovation des Konkurrenten mehr oder minder kopiert und eventuell verbessert nach ebendiesem auf dem Markt eingebracht. Mitunter spricht man deshalb auch von Imitationsstrategie. In diesem Fall sind die Risiken gegenüber dem Pionier zwar abgeschwächt, gleichzeitig kann der Folger allerdings auch i.d.R. nicht alle Vorteile des Pioniers in gleichem Ausmaß wahrnehmen.
Welche Strategie ein Unternehmen bezüglich des Markteintritts wählt, hängt oft von zahlreichen Faktoren ab. Nach Golder und Tellis muss eine Pionierstrategie nicht zwangsweise besser als eine Folgestrategie sein, da der frühe Folger in vielen Fällen über eine gute Kosten-Nutzen-Rechnung verfügt und im Durchschnitt sogar dreimal höhere Marktanteile als der Pionier erreicht (Golder und Tellis nach (Gassmann & Sutter, Praxiswissen Innovationsmanagement: Von der Idee zum Markterfolg, 2008, S. 67)). Andere Autoren wie beispielsweise Debus stellen dem Ansatz jedoch auch langfristige Nutzenaspekte gegenüber und empfehlen tendenziell eher Pionierstrategien (vgl. (Debus, 2002, S. 100)). Letztlich hängt die Markteintrittsstrategie stark mit der jeweiligen Branche und dem potentiellen Schutz der Innovation zusammen. Ist diese leicht zu imitieren, wird eine Folgestrategie eventuell zu bevorzugen sein, während bei hohem Schutz wie etwa im Pharmabereich vor allem Pionierstrategien gute Erträge zeigen (siehe Abbildung 12).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 12: Praktische Beispiele zu Pionier- und Folgerstrategien[12]
2.1.5 Wegweisende Innovationen
Wichtige Innovationen aus Erfindungssicht …
Im Zuge von Umfragen für die wichtigsten Innovationen der Menschheit werden in der Regel wegweisende Erfindungen wie Rad, Glühlampe, Buchdruck, Schrift oder Computer genannt (vgl. (FOCUS Online, 2005)). Sie alle hatten bzw. haben in der Regel die Gesellschaft massiv verändert und zu zahlreichen Folgeneuerungen geführt.
Der Umstand, dass diese Nennungen weltweit ziemlich ähnlich ausfallen, liegt vermutlich nicht zuletzt darin, dass i.d.R. EndkonsumentInnen befragt werden und diese nicht nur auf ihr individuelles Erfahrungs- und Wissensspektrum zurück greifen, sondern auch mehr oder minder bewusst Innovationen nach dem Grad der Auswirkungen beurteilen. Dies führt naturgemäß dazu, dass Innovationen der letzten Dekaden (mit Ausnahme des Internets) eher eine untergeordnete Rolle spielen und der gesamte Innovationshorizont der Menschheit auf einige wenige radikale Neuerungen geschrumpft wird.
Interessanterweise verschmelzen die Begriffe Innovation und Erfindung dabei weitgehend: so gilt Edison heute als Erfinder der Glühlampe, obwohl erste Varianten bereits über ein halbes Jahrhundert zuvor bekannt sind. Edison patentierte 1881 letztlich eine Glühbirne, deren vordergründige Erfindungstatsache in einer Verbesserung bereits vorhandener Systeme zu sehen war und weniger in der Erfindung des gesamten Systems an sich. Die Verdrängung von damals üblichen Gaslampen durch die Glühbirne als auch Durchsetzung gegenüber den zahlreichen Konkurrenten erreichte Edison weniger durch den verbesserten Bambusdraht der Birne, denn mittels einer geschickten Vernetzung und Kooperation mit bestehenden Partnern.
[...]
[1] Quelle: Brockhoff nach (Helbig & Mockenhaupt, 2009, S. 6)
[2] Quelle: Henderson und Clark nach (Weise, 2007, S. 17), verändert von Weise
[3] Quelle: (Perl, 2007, S. 51), Perl lehnt sich in der Darstellung lt. Eigenangaben an Servatius an
[4] Quelle: Kroy nach (Helbig & Mockenhaupt, 2009, S. 8), von Helbig et al. verändert
[5] Quelle: (Ili, 2010, S. 32), ergänzt um den Medici Effekt von Johannson
[6] Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Diffusionofideas.PNG, ergänzt
[7] Quelle: (Perl, 2007, S. 37). Das ursprüngliche Modell von Thom wurde nach Vahs/Burmester dahingehend ergänzt, dass Risiken nicht nur Konflikte fördern, sondern auch umgekehrt.
[8] Quelle: (Krieger, 2005, S. 10)
[9] Quelle: http://einkauf.oesterreich.com/bm2/Strat-BM/MakeBuy2.htm
[10] Quelle: (Perl, 2007, S. 42)
[11] Quelle: (Müller-Prothmann & Dörr, 2009, S. 15)
[12] Quelle: (Scheff, 2010, S. 16)
- Arbeit zitieren
- Daniela Bliem (Autor:in), 2011, Der Medici Effekt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175175
Kostenlos Autor werden



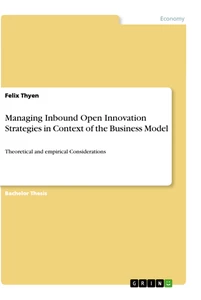










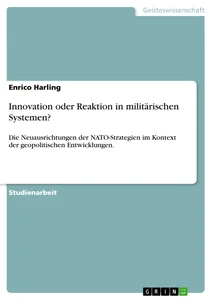







Kommentare