Leseprobe
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2. Die Bedingungen von Tod und Sterben in unserer Gesellschaft
2.1 Demographische Entwicklung von Tod und Sterben
2.2 Medikalisierung und Institutionalisierung des Sterbens
2.3 Veränderungen von Tod und Sterben im gesellschaftlichen Wandel
2.4 Zusammenfassung und Fazit
3. Die Institution Hospiz als Sterbeort
3.1 Begriffsbestimmung Hospiz
3.2 Der Ursprung der Hospizbewegung
3.3 Übersicht und Struktur der deutschen Hospizlandschaft
3.4 Grundprinzipien und Qualitätsmerkmale des Hospizes
3.5 Rechtliche Rahmenbedingungen und Finanzierung von Hospizen
3.6 Zusammenfassung und Fazit
4. Grundsätzliche Aspekte des Qualitätsmanagements
4.1. Definitionen und Begriffe
4.1.1 Qualität
4.1.2 Das Qualitätsmanagement (QM)
4.1.3 Das Total Quality Management (TQM)
4.1.4 Qualitätssicherung
4.1.5 Qualitätsstandards
4.2.Qualitätsmanagementkonzepte
4.2.1 DIN EN ISO 9001:2000
4.2.2 EFQM Modell
5. Spezielle Aspekte des Qualitätsmanagement in der stationären Hospiz-arbeit
5.1 Gesetzliche Grundlagen
5.2 Der aktuelle Stand des Qualitätsmanagements in der Hospizarbeit
5.3 Qualitätsdimensionen in der Hospizarbeit
5.4 Vorbehalte, Vor- und Nachteile des Qualitätsmanagements im Hospizbereich
5.5 Ehrenamtliches Engagement und professionelle Anforderung - ein Widerspruch in der Hospizarbeit?
5.6 Perspektiven der Umsetzung von Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement im Hospizbereich
5.7 Zusammenfassung und Fazit
6. Das Qualitätshandbuch „Sorgsam“
6.1 Hintergründe des Qualitätshandbuches „Sorgsam“
6.2 Erfahrungen mit dem Qualitätshandbuches aus der Praxis
6.3 Die Bewertung des Qualitätshandbuches „Sorgsam“ -Vor- und Nachteile bei der Umsetzung
6.4 Zusammenfassung und Fazit
7. Implementierung eines Qualitätsmanagementsystem in der stationären Hospizarbeit in Anlehnung an das EFQM-Modell
7.1 Grundlagen des EFQM-Modells
7.2 Der inhaltliche Aufbau des EFQM-Modells
7.3. Die Anwendung der Grundelemente des EFQM im stationären Hospizbereich
7.3.1 Voraussetzungen und Vorlaufphase der Implementierung eines QM-Systems
7.3.2. Die Anwendung der EFQM-Kriterien im stationären Hospizbereich
7.3.2.1 Kriterium 1: Führung
7.3.2.2 Kriterium 2: Politik und Strategie
7.3.2.3 Kriterium 3: Mitarbeiterorientierung
7.3.2.4 Kriterium 4: Partnerschaften und Ressourcen
7.3.3.5 Kriterien 5. Prozesse
7.3.3.6 Kriterium 6: Kundenbezogene Ergebnisse
7.3.3.7 Kriterium 7: Mitarbeiterbezogene Ergebnisse
7.3.3.8 Kriterium 8: Gesellschaftsbezogene Ergebnisse
7.3.3.9 Kriterium 9: Schlüsselergebnisse
7.3.3 Der Bewertungsprozess im stationären Hospizbereich
7.4 Zusammenfassung und Fazit
8 Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Glossar
Anhang
Abkürzungsverzeichnis:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Der Tod stellt unvermeidlich das Ende des Lebens eines jeden Menschen dar. Der Dichter Johann Gottfried von Herder verdeutlicht mit seinem Zitat, „ der Faden des Lebens hängt stets am Faden des Todes“ Verknüpfung zwischen Leben und Sterben.
Im privaten Bereich, durch das Begleiten meines Vaters im Sterbeprozess wurde ich das erste Mal mit dieser Thematik konfrontiert und erlebte das Sterben und den Tod unter den strukturellen und ideellen Rahmenbedingungen eines Krankenhauses.
Der Tod, so war mein Eindruck, gehörte nicht zum Krankenhausalltag. Der sterbende Patient wurde zwar behandelt, aber das Recht auf Sterben wurde letztlich missachtet, ebenfalls auch seine Menschenwürde: Zeitmangel, schnelles Abfertigen des Patienten, das Vermeiden von Kontakten und ein kalter und unfreundlicher Umgang mit dem sterbenden Patienten waren Ausdrucksformen der überforderten und überlasteten Mitarbeiter und prägten das Bild des Krankenhausalltages. Der qualitative Umgang mit dem Patienten war der Situation nicht angemessen, es wurde kein Wert auf die Zufriedenheit der Patienten oder der Angehörigen gelegt. Darüber hinaus klagte, z.B. eine Krankenschwester über den Krankenhauszustand und berichtete von der desolaten Situation auf dieser Station. Sie sprach unter anderem von psychischen und physischen Überforderungselementen, dem akuten Zeitdruck und ihrem Gefühl, als Mitarbeiterin nicht gehört und ernst genommen zu werden. Diese belastenden und negativen Erfahrungen gaben mir Anlass dazu, intensiver über eine würdige Unterstützung des betroffenen Menschen auf seiner letzten Reise nachzudenken. Um meinen eigenen Standpunkt zu finden, beschäftigte ich mich eingehend mit der Literatur zu dem Thema Sterben und Tod. Mir wurde deutlich, dass das einsame Sterben im Krankenhaus nicht untypisch ist, allerdings nicht sein muss, da andere Institutionen wie beispielsweise das Hospiz, eine gute Alternative des würdevollen Sterbens bieten. Die Hospizidee legt Wert auf die Achtung der Wünsche und Bedürfnisse sterbender Menschen und schlägt eine Brücke zum gesellschaftlichen System. Das rasante Entwicklungstempo der Hospizbewegung macht deutlich, wie wichtig ein menschenwürdiger Ort des Sterbens in unserer Gesellschaft ist.
Jedoch auch im Hospizbereich ist der ganzheitliche und humanitäre Umgang mit den Patienten nicht selbstverständlich und auch vor dem Hintergrund des knapper werdenden Budgets, beschäftigt man sich immer häufiger mit der Frage, wie sich eine gute, allerdings auch zeitaufwendige Betreuungsqualität herstellen und rechtfertigen lässt. Das im vergangenen Jahr veröffentlichte Qualitätshandbuch „Sorgsam“, das in erster Linie für den stationären Hospizbereich entwickelt wurde, lässt erkennen, dass auch dieses Arbeitsfeld sich vermehrt mit diesem Thema auseinandersetzt und das Qualitätsmanagement in diesem Bereich der sozialen Arbeit kein Fremdwort mehr ist. Erste Schritte in Richtung Qualitätsmanagement werden unternommen, nicht allein um dem Legitimationsdruck, den Neuerungen des Heimgesetzes, dem SGB XI und dem Pflegeversicherungsgesetz nachzukommen. Allerdings stehen die gesetzlichen Rahmenvereinbarungen und der Kostendruck häufig im Mittelpunkt aller Diskussionen. Es geht weniger darum, die Behandlung und Versorgung des Patienten zu optimieren und die Erfahrungen des Hospizalltages zu nutzen, um eine qualitative Verbesserung zu erreichen. Darüber hinaus erschweren Vorbehalte aus den Reihen der dort Tätigen die Implementierung und häufig fehlt eine einheitliche Kultur des Qualitätsmanagements in der Hospizeinrichtung. Ziel dieser Arbeit ist es, den aktuellen Stand des Qualitätsmanagements im stationären Hospizbereich zu ermitteln, um die Frage zu klären, welche Schwierigkeiten bei der Umsetzung vorherrschen und welche Möglichkeiten es gibt, Qualitätsmanagement und stationäre Sterbebegleitung zu vereinen.
Als Einstieg in das Thema werde ich die gesellschaftlichen Bedingungen von Tod und Sterben deutlich machen. Die demographischen Fakten und Entwicklungen werden aufgezeigt, sowie auf Medikalisierungs- und Institutionalisierungstendenzen des Sterbens hingewiesen, um den Wandel von Tod und Sterben im gesellschaftlichen Kontext deutlich zu machen und Anhaltspunkte dafür zu liefern, dass der Tod aus unserer Gesellschaft verdrängt wird. Im dritten Kapitel dieser Arbeit werde ich die Institution Hospiz als Sterbeort beschreiben. Nachdem die Klärung des Begriffes Hospiz vorgenommen wird, werde ich auf den Ursprung der Hospizbewegung eingehen und eine Übersicht über die deutsche Hospizlandschaft geben. Auch werden die wichtigsten Prinzipien und Qualitätsmerkmale von Hospizen verdeutlicht und der rechtliche Rahmen sowie die Finanzierung von Hospizen veranschaulicht. In Kapitel 4 mache ich die grundsätzlichen Aspekte des Qualitätsmanagements zum Thema. Um ein einheitliches Verständnis zu schaffen und einen Überblick zu geben, werden zunächst die Begrifflichkeiten Qualität, Qualitätsmanagement, Qualitätsstandard, Qualitätssicherung und das Total Quality Management erklärt, um folgend auf die speziellen Aspekte des Qualitätsmanagements in der stationären Hospizarbeit einzugehen. Hier werden die gesetzlichen Grundlagen, die stationäre Hospize zum QM verpflichten aufgezeigt, der aktuelle Stand veranschaulicht und die bestehenden Vorbehalte sowie die Vor- und Nachteile des Qualitätsmanagements aufgezeigt. In diesem Rahmen wird auch darüber diskutiert, ob es sich beim ehrenamtlichen Engagement und dem Thema Qualitätsmanagement um einen Widerspruch handelt und welche Perspektiven und Möglichkeiten dieses Arbeitsfeld mit sich bringt, um das Qualitätsmanagement umzusetzen. Ein erster Versuch sich den Herausforderungen des Themas Qualitätsmanagement im stationären Hospizbereich zu stellen, veranlasste einige stationäre Hospize, ein eigenes Handbuch zu entwickeln. Im Kapitel 6 soll dieses Qualitätshandbuch vorgestellt, die bisherigen Erfahrungen aus der Praxis beschrieben und im Anschluss daran eine eigene Bewertung dieses Werkes vorgenommen werden.
Den Abschluss dieser Arbeit bildet die Vorstellung eines Qualitätsmanagementsystems im stationären Hospizbereich. Hierfür wird das EFQM-Modell hinzugezogen und die Umsetzung anhand dieser Kriterien fiktiv dargestellt.
Die eigenen aus der Hospizarbeit gewählten Beispiele sollen der Nachvollziehbarkeit dienen und stellen einen beispielhaften Verlauf dar.
Ich weise darauf hin, dass ich aus Gründen der Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit am Ende jedes Kapitels eine Zusammenfassung vorgenommen und ein Fazit gezogen habe. Die Schlussbetrachtung dient dazu Rückschlüsse zu ziehen und die Leistungskraft des QM in stationären Hospizbereich deutlich zu machen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die maskuline Form verwendet.
2. Die Bedingungen von Sterben und Tod in unserer Gesellschaft
Durch die demographische Entwicklung[1] wird die aktuelle Situation von Tod und Sterben in unserer heutigen Gesellschaft veranschaulicht. Fortschritte in der Medizin und die immer besser werdenden medizinischen Interventionsmöglichkeiten haben den Sterbeort aus dem familiären Umfeld, das lange Zeit die soziale Funktion der Sterbebegleitung übernommen hat, in Institutionen verlagert. Man spricht in diesem Zusammenhang von der „Medikalisierung und Institutionalisierung“ von Tod und Sterben. Einhergehend mit den demographischen Veränderungen und den Erneuerungen in der Medizin hat sich die Einstellung der Menschen in unserer Gesellschaft im Hinblick auf Sterben, Tod und Trauer gewandelt. In diesem Kapitel wird die Relevanz der hospizlichen Versorgung deutlich, die für die Sicherung der Lebensqualität eines sterbenden Menschen eine wichtige Rolle spielt.
2.1 Demographische Entwicklung von Tod und Sterben
Die kulturelle und soziale Einstellung zum Sterben, Tod und zur Trauer wird durch die demographischen Entwicklungen einer Gesellschaft beeinflusst (vgl. Canine, 1996, S. 56)[2].
In den letzten Jahrhunderten hat sich das Krankheitsspektrum (Morbidität), das Spektrum der Todesursachen sowie das Sterbealter der Menschen (Mortalität) verändert (vgl. R. Spree, 1994, S. 101f; Feldmann, 1990, S. 25f).
Die Veränderungen der Morbidität und der Mortalität in der Bevölkerung erfolgten aufgrund von Verbesserungen und Fortschritten in der Medizin, des Ausbaus des Gesundheitssystems, der Zunahme des Lebensstandards, der geringeren Geburtenrate, der verbesserten Ernährung, Hygiene und Arbeitsbedingungen (vgl. Feldmann, 1990, S. 25f, Stanjek, 2001, S. 185f; Mai, 2003, S- 26f).
Prävention und medizinische Behandlung ist in unserer Zeit besser als je zuvor, sodass ein großes Spektrum an Krankheiten -besonders jener, die einst zu einer Epidemie führten, wie Pest, Cholera, Fleckfieber, Malaria und Pocken- in den westlichen Industrieländern nicht mehr auftritt (vgl. Elias, 2002, S. 14f). Andere Krankheiten haben sich in ihrer Eigenschaft modifiziert. An Krankheiten wie Masern, Röteln Diphtherie und Keuchhusten, die sonst in allen Altersschichten zu finden waren, erkranken heutzutage überwiegend Kinder. Stattdessen treten Krebs- und Herz-Kreislauferkrankungen seit Mitte des 19. Jahrhunderts vermehrt auf (vgl. Statistisches Bundesamt, 2004, S. 10ff; Spree, 1994, S. 101f; Schipperges, 1982, S. 19; Imhof, 1981, S. 14).
Imhof, der erste Historiker, der sich mit den aus Frankreich stammenden Methoden der historischen Demographie wissenschaftlich auseinandersetzte, betonte schon Anfang der 80er Jahre, dass die moderne, hoch entwickelte Medizin dazu führe, dass die Menschen in einem immer höheren Alter sterben (vgl. Imhof, 1981, S. 14).
Stanjek (2001, S.185) und der Medizinhistoriker Winau (1984, S. 202) untermauern diese These und fügen darüber hinaus noch an, dass einhergehend mit der Veränderung der Mortalität sich auch die Altersschichten verschoben haben (vgl. Spree, 1994, S. 101ff). Stanjek bestärkt diese These anhand einer Tabelle, woran deutlich wird, dass der Anteil, der immer älter werdenden Bevölkerung in Deutschland ansteigt, während der Anteil der Alterklassen unter 20 Jahren eine abnehmende Tendenz aufzeigt.
Tab. 1: Anteile an der Bevölkerung [%] (nach K. Stanjek 2001, S.185, verändert)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tod und Sterben haben sich weitestgehend aus dem Kindheits- und Jugendalter und aus den Altersstufen bis zum 70. Lebensjahr zurückgezogen, während sich die durchschnittliche Lebenserwartung in den westlichen Industrieländern in den letzten hundert Jahren verdoppelt hat[3] (vgl. Höhn/ Schwarz, 1994, S. 183; Spree, 1994, S. 101). Mai (2003, S. 11) prognostiziert in seiner vom BMFSFJ in Auftrag gegebenen bevölkerungsstatistischen Datenanalyse, dass der Prozentanteil von 23% (1999) der über 60-Jährigen an der Gesamtbevölkerung auf 36% im Jahre 2050 ansteigen wird.
Augenmerkliche Wandlungen gibt es außerdem im sozialen Familiensystem. Die Zahl der Menschen, die nicht mehr über ein familiäres Netzwerk verfügen, steigt, die Familie wird immer kleiner und besteht im Alter häufig nur noch aus einem Mitglied (vgl. Feldmann, 1990, S.49; BMFSFJ, 2003, S. 33f; Imhof, 1994, S. 15f; Zulehner et al., 1991, 22f; Gronemeyer, 2002, S. 4). Der Wandel der Familienstrukturen wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Haushalte mit einer Person im Westen Deutschlands seit den 70er Jahren mit über 30 Prozent den größten Anteil der Bevölkerung bilden (vgl. Abb.1 im Anhang) (vgl. Mai, 2003, S. 125ff).
Die Begleitung von Sterbenden im häuslichen Umfeld ist durch die sozialen Veränderungen in der Gesellschaft für Verwandte und Angehörige zunehmend schwieriger geworden. Angesichts der Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit, der gesellschaftlichen Individualisierungstendenzen, der gestiegenen Mobilitätsanforderungen sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich, hat sich das Sterben zunehmend in Institutionen verlagert (vgl. Zulehner, et al., 1991, S. 22f.). In diesem Zusammenhang wird auch von einer Institutionalisierung des Sterbens gesprochen, was im folgenden Kapitel näher dargestellt wird.
2.2 Medikalisierung und Institutionalisierung des Sterbens
Wie bereits erwähnt, hat sich mit den Fortschritten und den Wandlungsprozessen in der Medizin zugleich die gesundheitliche Versorgung in unserer Gesellschaft modifiziert (vgl. Deutscher Bundestag, 2005, S. 5; Schmitz- Scherzer, 1992, S. 29; Zulehner et al., 1991, S. 24). Man spricht in Hinsicht darauf von der Medikalisierung der Medizin.
Dem Arzt wurde zu Beginn der Medizin bis ins ausgehende Mittelalter eine gewichtige und priesterliche, nahezu dämonische Rolle beigemessen und die Bevölkerung nahm an, dass er durch allmächtige und übernatürliche Kräfte auf Erkrankungen und auf Heilungsprozesse einwirken könne. Die Menschen akzeptierten Krankheiten und Leiden und nahmen die begrenzte Lebensdauer schicksalhaft hin. Gleichwohl einer Erfolg versprechenden Medizin ermöglichten die Ärzte in dieser Zeit, dem kranken, alten und sterbenden Menschen eine Anteil nehmende Begleitung, wobei die Beziehungsarbeit von großer Wichtigkeit war. In der Zeit der Aufklärung erhielt der Heilauftrag einen neuen Inhalt und eine andere Bedeutung. Es entstand eine zunehmend kritische Haltung in Hinblick auf Unerklärbares und Unbegreifliches und die Anspruchshaltung der Menschen gegenüber der Medizin stieg an (vgl. Becker, 1992, S. 30; Silomon, 1983, S. 9f; Schipperges, 1982, 39ff; Frewer, 2002, S. 25). Sie wurde verwissenschaftlicht und schulmedizinische Methoden wurden etabliert; Krankheiten bekam man in den Griff oder sie wurden ausgerottet und das Lebensalter der Menschen nahm zu (vgl. Becker, 1992, S.30f; Zulehner et al., 1991, S. 24).
Der schulmedizinische, kurative[4] Therapieansatz fokussiert die Zielsetzung, eine Krankheit zu heilen, wobei das Wohlergehen und die Befindlichkeit des Patienten eine untergeordnete Rolle spielt (vgl. Deutscher Bundestag, 2005, S. 5). Zulehner (1991, S. 25) stellt diesen Sachverhalt überspitzt dar, indem er behauptet, dass das Krankenhauspersonal nur noch „…für die Bedienung der medizinisch-technischen Apparate hochkompetent…“, aber für die Sterbebegleitung unvorbereitet sei und er geht sogar soweit zu behaupten, dass der Mensch hinter den Apparaten verschwindet und es in erster Linie um die Behandlung einer Krankheit geht. In den Grundsätzen der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung von 1998, wird die Rolle des Mediziners zwar neu definiert, indem es heißt, dass es die Aufgabe eines Arztes sei, „unter Beachtung des Selbstbestimmungsrechtes des Patienten Leben zu erhalten, Gesundheit zu schützen und wieder herzustellen sowie Leiden zu lindern und Sterbenden bis zum Tod beizustehen“, doch von diesen theoretischen Ansprüchen und Forderungen weicht der praktische Krankenhausalltag häufig ab (Deutsches Ärzteblatt, 2004, S. 1; Deutsches Ärzteblatt, 1998, S. 17). Der Krankenhausauftrag, nämlich Gesundheit wieder herzustellen, steht im Widerspruch mit der Sterbebegleitung und oft wird der Tod eines Patienten vom Mediziner wie eine „…verlorene Schlacht…“ angesehen (vgl. Schweidtmann, 1991, S. 22, 33; Feldmann, 1997, S. 67; Weingarten, 1984, S.351).
Zugleich führt die zunehmende Differenzierung und Segmentierung der Medizin dazu, dass der ganzheitliche Umgang mit Kranken und Sterbenden immer schwerer wird. Der Körper wird in Bereiche aufgeteilt, die von eigenständigen Professionen behandelt werden (vgl. Feldmann, 1997, S. 63; Becker, 1992, S. 32). Der Mensch wird nicht mehr als Ganzes gesehen und „…Teile des Körpergeschehens werden voneinander abgeschieden und speziellen Professionen zugeordnet“ (Feldmann, 1997, S. 63). Die Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen ist oftmals mühselig, weil die gemeinsame Sprache fehlt (vgl. Becker, 1992, S. 32).
Ausgehend der Tatsache, dass 70 bis 80 % der Menschen in Institutionen sterben, wird deutlich, dass der der alltägliche Umgang und die Konfrontation mit Tod und Sterben in unserer Gesellschaft selten geworden sind (vgl. Deutscher Bundestag, 2002, S. 273; Schmitz-Scherzer, 1992, S.22; Student, 2004, S. 135)[5]. Während Anfang des 19. Jahrhunderts noch 80 % der Menschen zu Hause in der vertrauten Umgebung starben, sterben heute etwa 70 bis 80% der Menschen in Institutionen (vgl. Deutscher Bundestag, 2002, S. 273; Student, 2004, S. 135).
2.3 Veränderungen von Tod und Sterben im gesellschaftlichen Wandel
Aus den historischen Entwicklungen und den medizinischen Errungenschaften haben sich Veränderungen hinsichtlich der gesellschaftlichen Einstellungen und Auseinandersetzungen bezüglich Sterben, Tod und Trauer ergeben. Näheres wird in diesem Kapitel dargestellt.
Sterben, Tod und Trauer geschehen im kulturellen Kontext (vgl. Morgan, 2003, S. 14). Betrachtet man die Einstellung unserer Kultur bezüglich des Todes über die Jahrhunderte der europäischen Geschichte, so wird sichtbar, dass sich die Entwicklungen nur sehr langsam und schleichend vollziehen, wobei sich besonders augenfällige Veränderungen in den letzten Jahrhunderten ergeben haben (vgl. Winau, 1984, S. 15). Das Ansteigen der Lebenserwartung hat das Bewusstsein gegenüber dem Tod beeinflusst (vgl. Morgan, 2003, S. 17). Sterben, Tod und Trauer sind aus dem gesellschaftlichen Blickwinkel und aus der Privatsphäre der Menschen verschwunden (vgl. Winau, 1984, S.15). Einst war der Tod Teil des alltäglichen Lebens der Menschen und wurde in Form von Zeremonien und Riten ausgelebt (vgl. Winau, 1984, S.15; Feldmann, 1990, S. 35). Die Rituale hatten entlastenden Charakter, indem sie dafür sorgten, dass die trauernde Person in die Gesellschaft reintegriert wurde und auch die Auseinandersetzung mit dem Tod war einfacher, weil die Menschen noch direkten Kontakt zu Sterbenden und Schwerkranken hatten (vgl. Feldmann, 1990, S. 35; Becker, 1992, S. 27). In modernen Gesellschaften schwanden die Riten und Zeremonien und sind heute nur noch „...periphere Ereignisse“ einer Industriegesellschaft (Feldmann, 1990, S. 73). Die traditionellen Betreuungspersonen, wie Verwandte, Nachbarn und Priester verloren ihre Funktion (Feldmann, 1990, S. 54, 73).
Viele Autoren haben sich mit historischen Untersuchungen hinsichtlich der Entwicklung der westlichen Geschichte des Todes beschäftigt, wobei die bekanntesten Studien vom französischen Historiker Ariés stammen (vgl. Feldmann, 1990, S. 39). Um die historischen Veränderungen zu verdeutlichen, fasste Ariés (1980, S. 39) seine Erkenntnisse theoretisch in Epochen der Sterbekultur zusammen, die er „ der gezähmte Tod “, „ der Tod des Selbst “, „ der Tod des anderen “ und „ den verneinten Tod “ betitelte (vgl. Winau, 1984, S. 16ff; Morgan, 2003, S. 21). Hier wird geschildert, wie sich der gesellschaftliche Umgang mit Tod und Sterben vom Mittelalter bis in die Moderne verändert hat. So gehörte der Tod im Mittelalter zum Alltag der Menschen und wurde ausgelebt, während er sich im Laufe der Zeit zum Einzelschicksal des Menschen entwickelte. Erst mit der zunehmenden Industrialisierung wurde die Verantwortung für den Sterbenden oder Schwerkranken auf Professionen übertragen und in Einrichtungen verlagert (vgl. Winau, 1984, S. 16ff; Morgan, 2003, S.21ff; Feldmann, 1990, S. 39f; Ariés, 1980, S. 774ff). Die Aussagen Ariés werden in aktuellen Diskussionen angeführt, um den friedlichen und gesellschaftlichen Umgang mit Sterben und Tod in der Vergangenheit zu demonstrieren und einen Vergleich zum heutigen „institutionellen und kalten“ Sterben der Gegenwart zu ziehen (vgl. Feldmann, 1990, S. 40f; Bednarz, 2003, S. 56f).
Feldmann (1990, S. 72f) teilt diese Auffassung nicht ganz und legt hinsichtlich dieser These treffender dar, dass der Tod in der gegenwärtigen Zeit „…realitätsgerechter betrachtet und erfolgreicher „bearbeitet“ wird, als es in traditionellen Kulturen und in früheren Jahrhunderten der Fall war…“. Zum einen weist er darauf hin, dass der Mensch in unserer heutigen Zeit den natürlichen Tod nicht mehr als tragisches Ereignis ansieht und dass das übertriebene Begräbnisritual und der Totenkult abgenommen haben, weil der Tod als etwas Natürliches, weniger Illusionäres gesehen wird. Dies wird auch durch die öffentlichen Menschenrechtsdiskussionen und den kritischen Auseinandersetzungen mit Themen wie Sterben im Krankenhaus, Euthanasie und Selbstmord deutlich (vgl. Feldmann, 1990, S.73f).
Um das Sterberisiko zu minimieren, geben sich die Menschen im Vergleich zu traditionellen Kulturen nicht mehr schicksalsgläubig hin, sondern sorgen vor, indem sie zum Beispiel Versicherungen abschließen. Sinnfragen im Leben werden nicht mehr durch die Kultur abgenommen, was einerseits zu Verunsicherungen führen kann, andererseits jedoch auch Entscheidungsfreiheit und Verselbständigung der individuellen Gestaltung des Todes bedeutet (vgl. Feldmann, 1990, S. 73f; Bednarz, 2003, S. 55f).
So umstritten die Ergebnisse Ariés auch sein mögen, so sind doch einige genannte Faktoren zu bestätigen. Vergleicht man die heutige mit der damaligen Sozialstruktur (vgl. Kap. 2.1) wird deutlich, dass die Menschen heute zwar mehr Zeit haben, sich auf den Tod einzustellen, sich darauf vorzubereiten und dass das Thema Tod und Sterben in der Wissenschaft und in den Medien vermehrt behandelt wird, gleichwohl ist festzuhalten, dass der Tod und das Sterben immer mehr aus unserem Alltag verschwinden und in Krankenhäuser und Institutionen (vgl. Kap. 2.2) verlagert werden (vgl. Student, 2004, S. 11; Imhof; 1981, S. 25; Zulehner, 1991, S. 21f; Schmitz-Scherzer, 1992, S. 22). Selten hat man mit dem Tod zu tun, er ist nicht mehr allgegenwärtig und es vergehen im Durchschnitt eines menschlichen Lebens, 10-15 Jahre, ohne dass in der Familie ein Todesfall eintritt (vgl. Imhof, 191, S. 25; Schmeling, 1982, S. 7f; Feldmann, 1990, S. 46f). Diese Problematik beschreibt Elias (2002, S. 50f) wie folgt:
In einer Gesellschaft mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von fünfundsiebzig Jahren liegt der Tod für einen zwanzigjährigen, selbst für einen dreißigjährigen Menschen ganz erheblich ferner als in einer Gesellschaft mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von vierzig Jahren. Es ist leicht verständlich, daß im ersteren Falle ein Mensch den Gedanken an den eigenen Tod für den größeren Teil seines Lebens von sich zu weisen vermag (…). Der Tod liegt für einen beträchtlichen Sektor dieser Gesellschaft in verhältnismäßig großer Ferne.
Mit diesem Thema beschäftigt sich in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten die Hospizbewegung (vgl. Kap. 3.2). Die Hospize sind bestrebt, dem gesellschaftlichen Verdrängungsprozess invertierend entgegenzuwirken und den Patienten und seine Angehörige im Terminalstadium[6] zu unterstützen, um somit seine letztmögliche Lebensqualität sicherzustellen (vgl. Becker, 1994, S. 65; Student, 2004, S. 136; Student, 1991, S. 28f).
2.4 Zusammenfassung und Fazit
Demographische Prognosen besagen, dass unsere Bevölkerung immer älter wird. Die Lebenserwartung der Bevölkerung ist bedeutend gestiegen und die Zahl der älteren im Vergleich zu den jüngeren Menschen hat deutlich zugenommen. Als Gründe für diese Entwicklung werden unter anderem der medizinische Fortschritt und die Bevölkerungsentwicklung angesehen. Infektionskrankheiten führen aufgrund der verbesserten medizinischen Versorgung viel seltener zum Tod als in früheren Zeiten und Menschen erkranken nunmehr vermehrt an chronisch-regenerativen Erkrankungen, die erst nach langer Leidenszeit zum Tode führen, wie bspw. Krebs, Demenzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Infolge der Zunahme von Single-Haushalten, den erhöhten Mobilitätsanforderungen im Berufsleben und der Zunahme der Erwerbstätigkeit der Frauen, wird es immer unwahrscheinlicher, dass die Menschen künftig im Kreise ihrer Familie sterben werden. Demnach hat sich der Sterbeort verlagert und man spricht vermehrt von einer Institutionalisierung und Medikalisierung von Sterben und Tod. Obwohl die Mehrzahl der Todkranken im Krankenhaus versorgt wird, widerspricht diese Aufgabe dem Selbstverständnis der Institution, die auf Heilen und Genesung ausgerichtet ist.
Hiermit hat sich der Umgang mit Sterben und Tod nachdrücklich verändert. Der Mensch muss sich selten mit dem Tod auseinandersetzen, Verdrängungsprozesse sind zu verzeichnen, Menschen sammeln im Leben seltener oder immer später Erfahrungen mit dem Tod, verbindliche Rituale und Umgangsformen mit Sterben und Tod gehen verloren.
Die benannten Motive für die Verlagerung des Sterbeortes weisen auf, dass eine Institutionalisierung nicht ganz und gar rückgängig zu machen ist. Mit diesen Entwicklungen verändern sich die Anforderungen an die Gesellschaft, an das Gesundheitswesen, an das Sozialsystem, sowie an die Soziale Arbeit. Genauer gesagt muss es darum gehen, unter den vorherrschenden Bedingungen neue Methoden und Möglichkeiten zu einem angemessenen und qualitativen Umgang mit Sterben und Tod zu finden. Aus diesem Grund hat die Hospizbewegung das Anliegen, einen Ort zu schaffen, an dem so gut wie möglich die letzte Phase des Lebens bewältigt werden kann.
3. Die Institution Hospiz als Sterbeort
Ausgehend von den dargestellten Entwicklungen in unserer Gesellschaft will die Hospizbewegung, als Reaktion auf die bestehenden Herausforderungen unserer Gesellschaft, dem unheilbar Kranken und seiner Familie jeden möglichen materiellen und ideellen Beitrag bieten, damit sich ein würdevolles Leben bis zum Tode vollziehen kann.
Eingangs wird der Begriff „Hospiz“ bestimmt, um anschließend auf die Ursprünge der Hospizbewegung einzugehen. Die Betreuung von Sterbenden und deren Angehörigen gestaltet sich in unterschiedlicher Form und deshalb wird in diesem Kapitel eine Übersicht über die bundesdeutsche Hospizlandschaft gegeben. Nachfolgend werden dann die Grundprinzipien des Hospizes dargestellt und abschließend beschrieben, unter welchen rechtlichen Rahmenbedingungen die Hospize finanziert werden.
3.1 Begriffsbestimmung Hospiz
Nach der Erklärung des Fremdwörterlexikons, versteht man unter Hospiz „ein großstädtisches Gasthaus od. Hotel mit christlicher Hausordnung“ beziehungsweise eine, „von Mönchen errichtete Unterkunft für Reisende od. wandernde Mönche im Mittelalter“ (Duden, 1982, S. 315). Das Wort Hospiz geht auf die lateinische Wortfamilie „hospitium“ zurück und bedeutet so viel wie Gastfreundschaft, Bewirtung oder Herberge (vgl. Duden, 2001, S. 347).
Obwohl immer noch die Mehrheit der Menschen beim Begriff „Hospiz“ ein Gebäude oder ein Haus assoziiert, sind primär die Zielsetzung und das Konzept gemeint. Die gesamte medizinische, pflegerische, soziale und spirituelle Betreuung steht im Zentrum des Handelns (vgl. Student, 2004, S. 86; Flensburger Hefte, 1997, S. 150; Skalsky, 1996, S. 246).
3.2 Der Ursprung der Hospizbewegung
Hospize gab es bereits zu Beginn des Christentums im Römischen Reich. Sie waren im gesamten europäischen Raum verbreitet und verstanden sich als Zufluchtsstätte für Menschen, die sich auf einer Reise befanden. Häufig wurden sie von Ordensmönchen geleitet und dienten den Pilgern als Raststätte[7]. Diese erhielten an jenem Ort Verpflegung, Hilfe und Unterkunft (vgl. Flensburger Hefte, 1997, S. 150; Deutscher Bundestag, 2005, S. 9; Aichmüller - Lietzmann, 1998, S. 16; Student, 1996, S. 121f; Gronemeyer, 2002, S. 4).
Diese Tradition aufgreifend soll das Hospiz auch in unserer Zeit dem Sterbenden auf seiner „…Reise zu einem letzten Ziele Pflege, Stärkung, Herberge…“(Student/ Busche, 1994, S. 30) zusichern.
Die Verwendung des Wortes Hospiz wurde erstmalig in Verbindung mit der Pflege und Begleitung Sterbender, Mitte des 19. Jahrhunderts benutzt. Im 19. Jahrhundert und in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelte sich eine kleine Anzahl an Hospizinitiativen in Deutschland, Frankreich, Irland, England und den USA. Dabei wurden viele dieser Einrichtungen von Frauen[8] ins Leben gerufen und geführt (Deutscher Bundestag, 2005, S. 9f; Howarth/ Leaman, 2001, S. 245).
Das Entstehen dieser Einrichtungen kann als eine Voraussetzung für das durch Cicely Saunders gegründete „St. Christopher`s Hospice“ in England und als Vorbild für weitere Entwicklungen in der Hospizbewegung und Palliativmedizin[9] gesehen werden (vgl. Deutscher Bundestag, 2005, S. 9; Feldmann, 1997, S. 72; Student, 1996, S. 121). Nach langjährigen Erfahrungen in der Hospizarbeit gründete die Krankenschwester, Sozialarbeiterin und Ärztin, Saunders 1967 das „St. Christopher`s Hospice“ im Londoner Randgebiet. Forschung und wissenschaftliches Arbeiten waren neben der Betreuung Sterbender grundlegende Aufgaben des Hospizes.
Folglich setzte sich das Hospizkonzept in England durch und verbreitete sich in vielen anderen Ländern (vgl. Deutscher Bundestag, 2005, S. 10; Student, 2004, S. 138; Godzik, 1992, S.5f).
Ein weiterer Impuls für die Entwicklung der Hospizbewegung kam zeitgleich von der Schweizer Ärztin Kübler-Ross, die in Krankenhäusern und Universitäten das Verhalten sterbender und todkranker Menschen untersuchte und mit dem 1969 veröffentlichten Buch „Interviews mit Sterbenden“[10] bekannt wurde (vgl. Flensburger Hefte, 1997, S. 150; Student, 2004, S. 138; Kübler-Ross, 1971, S. 26ff). Weitere Veröffentlichungen folgten und bildeten den theoretischen Diskurs der deutschen Hospizbewegung (vgl. Deutscher Bundestag, 2005, S.10; Schmitz-Scherzer, 1992, S. 120).
Allerdings hatte es die Hospizbewegung in Deutschland schwer und fasste, im Vergleich zu den Entwicklungen in England, erst später Fuß. Zwar wurde bereits 1971 der unglücklich betitelte Dokumentarfilm[11], „Noch 16 Tage …- Eine Sterbeklinik in London“ im deutschen Fernsehen ausgestrahlt, der Wortlaut „Sterbeklinik“ stieß jedoch auf Kritik und Hospize wurden mit dem geschichtlichen Hintergrund der NS-Euthanasie von der Bevölkerung abgelehnt. „Gettoisierung“ und „Institutionalisierung“ der Sterbenden waren die Befürchtungen vieler Menschen (vgl. Student, 2004, S. 144; Cachandt, 2000, S. 124; Wermter, 1997, S. 224; Schara, 1997, S. 15).
Erst 15 Jahre später wurde durch den Ordensgeistlichen Türks das erste Hospiz „Haus Hörn“ in Aachen ins Leben gerufen und weitere Hospizeröffnungen folgten in dieser Zeit, wobei es sich vor allem um stationäre Hospize handelte (vgl. Student, 2004, S. 145; Student, 1999, S. 43; Wiedemann, 1999, S. 37ff).
In den nachfolgenden Jahren entwickelten sich weitere Hospizvereine und -initiativen und es bildete sich ein vielfältiges Hospizangebot heraus, wobei anzumerken ist, dass sich die Hospizbewegung und die Palliativmedizin in Deutschland, im Vergleich zu anderen Ländern getrennt voneinander entwickelt haben (vgl. Deutscher Bundestag, 2005, S. 9). Grund hierfür bestand darin, dass sich die Hospizbewegung vor den Medikalisierungstendenzen bewahren wollte. Zahlreiche Hospizinitiativen setzten den Schwerpunkt auf die ganzheitliche, psychosoziale und spirituelle Betreuung von Sterbenden und betrachteten das Einbeziehen von Ärzten in das Hospizgeschehen mit Skepsis (vgl. Deutscher Bundestag, 2005, S.9). Somit entwickelten sich die „…ärztliche Palliativmedizin und die eher psychosoziale und spirituell ausgerichtete und maßgeblich von Laien getragene Hospizbewegung…“ getrennt voneinander (Deutscher Bundestag, 2005, S.9).
3.3 Übersicht und Struktur der deutschen Hospizlandschaft
Die Hospizbewegung in Deutschland hat zwei Dachorganisationen, einerseits die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Hospiz e.V. und andererseits die Deutsche Hospiz Stiftung (DHS). Der Deutschen Hospiz Stiftung obliegt, als unabhängige, überparteiliche und unkonfessionelle Stiftung, die Aufgabe der Spendenverteilung, der Puplic Relations[12] und der wissenschaftlichen Forschung zu den Themen Tod, Sterben und Trauer (vgl. DHS, Stand:09.09.2005).
Der eingetragene Verein BAG Hospiz übernimmt die Funktion der Interessensvertretung aller Hospize gegenüber Politik und Verbänden. Ebenso sieht die BAG Hospiz ihre Aufgaben in der Entwicklung eines Hospiznetzwerkes, in der Verbesserung der Lebensqualität Sterbenskranker, in der Fort- und Weiterbildung aller maßgeblichen Berufsgruppen, in der Öffentlichkeitsarbeit, etc. (vgl. BAG Hospiz, Stand: 30.09.2005). Weiterhin hat die BAG Hospiz Qualitätsstandards für den Kern hospizlichen Handelns im stationären Hospizbereich erarbeitet und im Qualitätshandbuch „Sorgsam“ zusammengefasst. Deutlich wird hier, dass sich die Zuständigkeitsbereiche der DHS und der BAG Hospiz partiell überschneiden.
Der Dachverband BAG Hospiz integriert 16 Landesarbeitsgemeinschaften (LAG), die auf Länderebene die Weiterentwicklung der Hospizbewegung unterstützen. Zu seinen Mitgliedern zählt die BAG Hospiz die ambulanten, teilstationären und stationären Hospize, die Palliativstationen und ebenso überregionale Organisationen, wie die Deutsche Aidshilfe, die Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand (IGSL Hospiz), einige Wohlfahrtsverbände und den Verein Omega –Mit dem Sterben leben e.V. (vgl. BAG HOSPIZ, Stand: 14.06.05; Student, 2004, S. 146f).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Organisation der deutschen Hospizbewegung (nach Student, 2004, S. 147, verändert).
Die Hospizidee hat sich in den letzten Jahren vermehrt im bundesdeutschen Raum etabliert und unterschiedliche Betreuungs- und Organisationsformen der Sterbebegleitung haben sich entwickelt, wobei man zwischen vier Grundformen unterscheiden kann (vgl. Student, 1999. S. 31; Gronemeyer, 2002, S. 4) Hospizliche Unterstützungsangebote organisieren sich als selbständig agierende, stationäre und ambulante Hospize, als abhängige stationäre und ambulante Einheit eingebunden in einer Klinik (Palliativstation), als ausschließlich ambulant arbeitende Institution und in der Form einer Hospizinitiative bzw. eines Beratungsteams (vgl. Student, 1999. S. 31).
Die BAG Hospiz registrierte im August 2004, 1320 ambulante Hospize, 112 stationäre Hospize und 90 Palliativstationen, wobei die Angaben über die Zahl der Hospizeinrichtungen differieren (vgl. BAG, Stand: 14.06.05; DHS, Stand: Januar 2004). Dennoch ist festzuhalten, dass der Bedarf in Deutschland noch nicht gedeckt ist und nur ein geringer Prozentsatz[13] der Menschen in hospizlichen Versorgungseinrichtungen stirbt (vgl. Jaspers/ Schindlers, 2004, S. 102; BAG Hospiz, Stand: 30.09.05; Deutscher Bundestag, 2005, S. 5f).
Obgleich sich das Hospizangebot in den letzten Jahren erheblich verbessert und erweitert hat (vgl. Abb. 2, 3 im Anhang) sind auch immer noch Schwächen im Hospizsystem zu verzeichnen. Um die Mängel in der hospizlichen Versorgungsstruktur sichtbar zu machen, werden in der Öffentlichkeit aktuell Diskussionen geführt und neue Ansätze und Konzepte für verschiedene hospizliche Versorgungsangebote vorgestellt (vgl. Deutscher Bundestag, 2005, S. 5f).
Ungeachtet konzeptioneller Veränderungen im Hospizbereich weisen verschiedene Hospizeinrichtungen einheitliche Kennzeichen auf, die als Grundprinzipien und Qualitätsmerkmale des Hospizes bezeichnet werden können (vgl. Kap. 3.4).
3.4 Grundprinzipien und Qualitätsmerkmale des Hospizes
Die Hospizidee impliziert weit mehr, als einen Raum und formale Strukturen für Tod und Sterben zu schaffen. Hospize sehen es als ihre Aufgabe, dem sterbenskranken Menschen mit physischer und psychischer Unterstützung beizustehen, um ihm in der letzten Zeit seines Lebens höchste Zufriedenheit und Lebensqualität zukommen zu lassen. Dabei soll der Tod weder beschleunigt, noch hinausgezögert werden. (vgl. Student, 2004, S. 27; Student, 1999, S. 24, Student, 1991, S. 22). Entgegengesetzt anderer Betreuungseinrichtungen, wie vergleichsweise dem Krankenhaus, liegt die substantielle Arbeit primär in der intensiven und der persönlichen Begleitung des Menschen mit progredienter[14] Erkrankung (vgl. Feldmann, 1990, S. 160).
Nicht nur Student (Student, 1999, S. 24ff; Student, 2004, S. 27ff; Student, 1991, S. 22ff) auch die BAG Hospiz (Satzung der BAG Hospiz, Stand: 30.09.2005) formulieren die besonderen inhaltlichen Kennzeichen des hospizlichen Handelns, die sich in vielen Aspekten überschneiden. Diese Kennzeichen können auch als „Qualitätskriterien“ gesehen werden und werden im Folgenden vorgestellt (vgl. Student, 2004, S. 27; Student, 1999, S. 24).
1. Um das gesamte soziale Umfeld mit einzubeziehen, rechnet man zu den Adressaten der Hospizarbeit den sterbenden Menschen, aber auch seine Angehörigen.
2. Die Hospizbewegung berücksichtigt die ganzheitliche Betrachtungsweise des sterbenden Menschen, vom Beginn seines Lebens bis hin zu seinem Tod.
3. Die Hospizarbeit richtet sich nach dem Prinzip „ambulant vor stationär“, um dem Menschen die Möglichkeit zu geben, zu Hause zu sterben. Teilstationäre und stationäre Versorgungsstrukturen greifen nach dem Subsidiaritätsprinzip nachrangig ein, wenn die Betreuung im häuslichen Umfeld nicht mehr möglich ist.
4. Ehrenamtlich Tätige haben für den Hospizbereich eine beachtliche Relevanz. Indessen sollten die Ehrenamtlichen nicht dort Funktionen übernehmen, wo professionelle Kräfte benötigt werden, sondern vielmehr über ihren eigenen Zuständigkeitsbereich verfügen.
5. Der Sterbende und seine Familie werden durch verschiedene Fachleute eines Hospizteams unterstützt und begleitet. Ärzte, Krankenschwestern, Sozialarbeiter, Seelsorger, Ehrenamtliche u.a. arbeiten interdisziplinär im Hospiz und decken somit den Anspruch des ganzheitlichen Ansatzes, da vielfältige Lebensbedürfnisse des Patienten abgedeckt werden. Der Aus-, Fort- und Weiterbildung kommt hierbei ein hoher Stellenwert zu.
6. Grundlegende Bedingung für die Hospizarbeit sind Fertigkeiten und Kenntnisse in der Schmerzbehandlung und Symptomkontrolle.
7. Die Arbeit im Hospiz ist durch ein hohes Maß an Kontinuität geprägt und schließt eine „Rund um die Uhr- Betreuung“ ein.
8. Die Sterbebegleitung beinhaltet ebenfalls im erforderlichen Umfang eine Trauerbegleitung der Angehörigen.
9. Dem Hospiz kommt die Möglichkeit zu, Aufgaben zu übernehmen, die andere Dienste nicht erfüllen. Um eine konstante Betreuung zu gewährleisten, ist die Arbeit mit anderen Institutionen jedoch vorteilhaft und zu empfehlen (vgl. Satzung der BAG Hospiz, Stand: 30.09.2005; Student, 1999, S. 24ff; Student, 2004, S. 27ff; Student, 1991, S. 22ff; Feldmann, 1997, S. 71f).
Hier wird deutlich, dass das Handlungsziel der hospizlichen Arbeit, nämlich den sterbenden Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und alle hospizlichen Tätigkeiten an der Person zu orientieren, realisierbar ist, jedoch auch der sorgsamen Planung und der Organisation bedarf. Für eine gründlich geplante Durchführung der Versorgung unheilbar kranker Menschen ist ein angemessenes Budget erforderlich und finanzielle Mittel müssen bereitgestellt werden.
3.5 Rechtliche Rahmenbedingungen und Finanzierung von Hospizen
Amerikanische Untersuchungen haben ergeben, dass die Kosten stationärer Hospize trotz des erhöhten Personalaufwandes unter denen einer Pflegeeinrichtung liegen (vgl. Student, 1991, S. 133f, Student, 2004, S. 35). Das ist darin begründet, dass die Hospizarbeit das Augenmerk weniger auf die teure Erhaltung des Lebens durch medizinisch-technische Geräte richtet, sondern vielmehr eine qualitative und humane Zuwendung garantiert (vgl. Student, 2004, S. 35).
Die Kosten stationärer und teilstationärer Hospize werden durch ein Konglomerat der Sozialversicherung (SGB V), der Pflegeversicherung, des Eigenanteils der Patienten und des Trägers, wie z. B. Spendengelder zusammengesetzt (vgl. Student, 2004, S. 33; Klie, 1999, .204ff, 206f). In vielen Fällen werden stationäre Hospize und Hospizinitiativen aufgrund ihres hohen Ansehens im Social Sponsoring vorrangig begünstigt[15] (vgl. Klie, 1999, S. 204). Die Mischfinanzierung stationärer Hospize, insbesondere das des Spendenwesens, ist insofern opportun, als dass die Möglichkeit, sich zu einem Gewinnunternehmen zu entwickeln, nicht besteht und die Einbindung in das Gemeinwesen durch das Sicherstellen und das Sammeln von Spenden erleichtert wird (vgl. Student, 2004, S. 89). Deutlich wird in diesem Zusammenhang, dass den Hospizen zur Finanzierung keine einfachen Lösungswege zur Verfügung stehen und es sich für sie um immer wiederkehrende Aushandlungs- und Anstrengungsprozesse handelt. Die Kostendeckung über eine Spendenfinanzierung erfordert inhaltliche Klarheit und Zuverlässigkeit (vgl. Klie, 1999, S. 207).
In welchen Dimensionen die Quellen der Sozialversicherung bzw. der öffentlichen Mittel für die Finanzierung von Hospizen zuständig sind, ist abhängig von den entsprechenden Gesetzen (vgl. Schoepffer, 1991, S. 135). Die finanzielle Grundlage für stationäre Hospize wurde erst 1997 mit der Einführung der Gesetzesgrundlage (vgl. gesetzliche Regelungen im Anhang) des § 39 a Sozialgesetzbuch des Krankenversicherungsrechts (SGB V) geschaffen (vgl. Klie, 1999, S. 204). Allerdings müssen Hospize, um anteilig sozialstaatliche Zuschüsse zu erhalten, die „Rahmenvereinbarungen nach § 39 a, Satz 4 SGB V zur Sicherung der Qualität der stationären Hospizversorgung“ (vgl. gesetzliche Regelungen und Rahmenvereinbarungen im Hospiz im Anhang) erfüllen (vgl. Student, 2004, S. 33; SGB V, 2002, S. 45). Demzufolge müssen, laut Gesetzgeber, bestimmte räumliche, personelle und sachliche Merkmale erfüllt und ebenfalls eine palliativ-medizinische Behandlung, die Grund- und Behandlungspflege, die soziale Betreuung, die Sterbe- und Trauerbegleitung sowie die Unterkunft und Verpflegung gewährleistet sein (vgl. Student, 2004, S.33).
Der hospizliche Alltag ist, wie auch andere soziale Bereiche, durch deutliche „Rationalisierungs- und Rationierungstendenzen“ zum Sparen gezwungen und selbst hier ist der immer härter werdende Verteilungskampf um die Ressourcen zu diagnostizieren (vgl. Klie, 1999, S. 205). Stationäre Hospize mit ihrem hohen Personalschlüssel und ihrem materiellen und finanziellen Mehrbedarf können nur dann dauerhaft Anerkennung finden, wenn auch hier die Verbesserung der Qualität im Fokus des Handelns steht. In Anbetracht dessen und aus dem Interesse des Patienten heraus, seine Lebensqualität in den letzten Stunden zu sichern, ist auch der hospizliche Bereich gefordert, Leistungs- und Qualitätsnachweise zu erbringen.
3.6 Zusammenfassung und Fazit
Die Bedeutung des Wortes „ Hospiz“ steht gestern wie heute dafür, dem Menschen auf seinem letzten Lebensweg Unterstützung zukommen zu lassen und ihm eine hochwertige Begleitung zu gewähren. Diese Idee wurde schon am Anfang der Hospizbewegung verfolgt, und die Wegbereiterinnen und Avantgardistinnen Saunders und Kübler-Ross verbreiteten diese Idee, indem sie Konzepte entwickelten, die in aller Welt Anklang fanden und zum Vorbild vieler neuer Hospizeinrichtungen wurden.
Die deutsche Hospizbewegung hingegen hatte anfangs große Mühe sich zu etablieren und erst 15 Jahre später entstanden auch in Deutschland die ersten Einrichtungen. Mittlerweile gibt es ebenfalls bei uns ein vielfältiges Spektrum an Angebotsformen, die von den übergeordneten Dachorganisationen Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz (BAG Hospiz) und Deutsche Hospizstiftung (DHS) vertreten werden.
So unterschiedlich die verschiedenen Versorgungsstrukturen der Hospize auch sein mögen, so sind dennoch immer wiederkehrende Gemeinsamkeiten zu erkennen, die häufig auch zu Grundprinzipien und Qualitätskriterien zusammengefasst werden und den Versorgungsauftrag ausmachen. Im Interesse des hospizlichen Handelns stehen jedoch als oberste Priorität der sterbende Mensch und seine zu erhaltende Lebensqualität. Aber eine qualitativ hochwertige und auf den Patienten ausgerichtete Arbeit kostet Geld und um eine sichergestellte Finanzierung erwarten zu können, müssen gesetzliche Voraussetzungen erfüllt und - insbesondere in einer Zeit der Rationalisierungstendenzen - die Relevanz der Einrichtung transparent gemacht werden. Das Qualitätsmanagement ist an dieser Stelle eine geeignetes Instrument, die Einrichtungsstrukturen sowohl nach außen, der Öffentlichkeit, als auch nach innen, den Beteiligten der Einrichtung, durchschaubar zu machen.
4. Grundsätzliche Aspekte des Qualitätsmanage- ments
Qualitätsmanagement findet auch vermehrt in sozialen Bereichen statt und nicht zuletzt die gesetzlichen Änderungen (vgl. Kap. 3.5, 5.2) und die in den vergangenen Jahren immer enger werdenden finanziellen Spielräume bewegen soziale Einrichtungen zusehends dazu, sich mit dem Qualitätsmanagement auseinanderzusetzen. Im Folgenden werden zunächst durch eine kurze, theoretische Einführung die wesentlichen Aspekte des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung dargestellt: Es werden die grundlegenden Termini erklärt und die relevanten Qualitätsmanagementkonzepte vorgestellt und verglichen.
4.1 Begriffsbestimmung
Viele Autoren haben sich mit dem Thema Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung auseinandergesetzt und nicht selten sieht man sich aufgrund des Literaturüberflusses und des „Wörterwaldes“ mit der Schwierigkeit konfrontiert, eine einheitliche Beschreibung hinsichtlich der Begriffsdefinitionen und der Erläuterungen zu finden. Um einen Einblick zu gewähren und einen Orientierungsrahmen zu schaffen, werden im Folgenden die wesentlichen Aspekte, die im Zusammenhang mit dem Qualitätsmanagement und der Qualitätssicherung stehen, zusammengefasst und anhand einiger Beispiele aus der Praxis dargestellt.
4.1.1 Qualität
Das Wort „Qualität“ entspringt dem lateinischen Wort „qualitas“, das für Beschaffenheit, Verhältnis und Eigenschaft steht. Der Begriff „Qualität“ lässt sich allerdings nicht allgemeingültig definieren, ist vielschichtig und somit unterschiedlich auslegbar (vgl. Knon, 2005, S. 13; Merchel, 2004, S.33ff; Knorr/ Halfar, 2000, S. 16, Escher, 1997, S. 48). Verschiedene Beteiligte bringen unterschiedliche Vorstellungen von Qualität in den Prozess und richten ihre Handlungsweise danach aus (vgl. Merchel, 2004, S. 34; Knorr /Halfar, 2000, S. 17). Aufgabe ist es nach Merchel (2004, S.34), die verschiedenen Qualitätsanforderungen zu definieren und aufzudecken, um einen Einklang zwischen der verschiedenen Vorstellungen zu schaffen (vgl. Knorr/ Halfar, 2000, S. 17). Schädler (2001, S.26) formuliert Qualität in diesem Zusammenhang auch als „...das Maß an Übereinstimmung zwischen den fachlichen Anforderungen an eine Dienstleistung und ihren tatsächlichen Merkmalen“. Als Beispiel aus der hospizlichen Betreuung kann angeführt werden, dass Hospize zumeist das Ziel verfolgen, dem sterbenden Menschen ein Gefühl des „Zuhauseseins“ möglich zu machen. Dagegen spricht allerdings der zeitlich strukturierte Tagesablauf mit der durchgeplanten Handlungsreihe. In diesem Sinne ist es elementar, die Hospizarbeit „vom Patienten her“ auszurichten. So wird die Möglichkeit geschaffen, auf verschiedene Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner einzugehen. Nicht mehr die Tagesstruktur der Bewohner steht im Mittelpunkt des Tagesablaufes, sondern die Tätigkeiten der Beteiligten werden organisiert, um den Forderungen der Patienten nachzukommen.
Hinzuzufügen ist im Weiteren, dass gewisse Erklärungsansätze zur Qualität, zum einen die objektiven Kriterien, also die betriebswirtschaftlichen und physikalischen Inhalte, wie die Bettenbelegung, und zum anderen die subjektiven Kriterien wie die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit im Hospiz beschreiben (vgl. Knon, 2005, S. 13; Schädler, 2001, S. 26). Bei hospizlichen Dienstleistungen umfasst die Qualität nicht allein den Aspekt der Dienstleistung, z.B. dass ein Gesprächskreis für Angehörige im Hospiz angeboten wird, sondern beinhaltet auch den Prozess, also wie das Angebot durchgeführt wird (vgl. Knorr, 2000, S. 17).
Des Weiteren handelt es sich bei der Qualität nicht um ein beständiges Element. Es unterliegt der ständigen Veränderung der Faktoren und sollte deshalb stets geprüft und weiterentwickelt werden (vgl. Knon/ Halfar, 2000, S. 17). Besonders der Hospizalltag ist durch Qualitätsaspekte gekennzeichnet, die der ständigen Veränderung unterliegen. Eine über längeren Zeitraum erfolgreich wirkende Therapie eines Patienten kann innerhalb kürzester Zeit, bei Veränderung des Gesundheitszustandes nicht mehr adäquat sein. Als gutes Beispiel sei hier die Schmerztherapie angeführt . Eine Medikation kann über einen bestimmten Zeitraum die Symptome des Patienten lindern, bei einer Verschlechterung des Befindens ist die medikamentöse Neueinstellung jedoch notwendig.
4.1.2 Das Qualitätsmanagement (QM)
Die dynamischen Organisationsprozesse in ihrer Gesamtheit unter Einschluss aller Dokumentationsverfahren und der gesamten Organisation machen das Qualitätsmanagement aus (vgl. Knorr, 2000, S. 17, BAG Hospiz, 2004, S. 12; Schubert/ Zink, 1997, S. 239f). Qualitätsmanagement soll die Abweichungen zwischen dem „angestrebten Soll“ und dem „tatsächlichen Ist“ demonstrieren, die Ursachen untersuchen und Verbesserungsmöglichkeiten einer Qualität aufzeigen (vgl. Allert, 2003, S. 11). Die Standards (vgl. Kap. 4.1.5) werden den Voraussetzungen der Organisation angepasst, bei Bedarf weiterentwickelt und die Einrichtungsaktivitäten werden so gesteuert, dass die im Voraus festgesetzten Ziele nach Möglichkeit zu realisieren sind. Es handelt sich hierbei um einen Managementansatz, der sowohl darauf zielt, die Zufriedenheit der Kunden und die Leistungsqualität zu verbessern, als auch den wirtschaftlichen Rahmen zu sichern (vgl. Escher, 2000, BAG Hospiz, S. 18; 2004, S. 12; Schubert/ Zink, 1997, S. 239). Das Qualitätsmanagement bezieht sich somit nicht nur auf die Mitarbeitertätigkeit, sondern richtet den Blickwinkel auf die Gesamtorganisation und nimmt gleichermaßen die Leitungsebene in die Verantwortung.[16]
4.1.3 Total Quality Management (TQM)
Bei dem Total Quality Management handelt es sich um eine Unternehmensphilosophie und eine organisatorische Führungsmethode, die den Qualitätsaspekt und die stetige Qualitätsverbesserung in den Mittelpunkt des Interesses rückt. Dabei wird der Blick nicht ausschließlich auf das Endprodukt gerichtet, sondern auch die „Wege“ dorthin sind ausschlaggebend. Diese Denkweise dient sowohl der Zufriedenstellung der internen, als auch der externen „Kunden“[18] (vgl.Schubert/ Zink, 1997, S. 242; Engelhardt, 2001, S. 37f). Hierbei werden die Mitarbeiter an dem Qualitätsmanagementprozess beteiligt und in den Ablauf eingebunden (vgl. Engelhardt, 2001, S. 37). Während das Qualitätsmanagement primär die internen Belange einer Einrichtung aufgreift, bezieht sich das TQM angesichts der „Umweltorientierung“ auch auf den externen Kundenkreis (vgl. Engelhardt, 2001, S. 37f). In der Hospizpraxis werden demnach nicht nur die direkten Beteiligten, wie die Patienten, deren Angehörige oder die Mitarbeiter berücksichtigt, auch der gesellschaftliche Aspekt (vgl. Kap. 2) spielt bei der Planung und Durchführung des Qualitätsmanagements eine maßgebliche Rolle.[17]
4.1.4 Qualitätssicherung
Wird von der Qualitätssicherung gesprochen, dann geht es in erster Linie darum, dass die Qualität bzw. die Qualitätsaspekte für den Kunden garantiert sind, indem die erforderliche Dienstleistung bereitgestellt und durchgeführt wird (vgl. Knorr/ Halfar, 2000, S. 34). Die einzelnen Arbeitsabläufe werden standardisiert aufgeführt und dienen als roter Faden bei der Erledigung einzelner Arbeitsleistungen. Das bedeutet für die Hospizarbeit, dass dem Patienten die versprochene Leistung, wie die Schmerztherapie sichergestellt wird, indem z.B. die erforderlichen Medikamente verabreicht werden.
Gegenüber dem Qualitätsmanagement ist hier die Weiterentwicklung der Standards nicht von Relevanz, hier geht es vielmehr darum, dass die Leistung vollzogen wird. Zur Umsetzung der Qualitätssicherung werden Methoden wie Verfahrensanweisungen, Checklisten, Befragungen und Dokumentationen herangezogen, die nicht selten integrierend zu einem Qualitätshandbuch zusammengefasst sind (vgl. Schubert /Zink, 1997, S. 240). Die Qualitätssicherung kann als Bestandteil des Qualitätsmanagements gesehen werden (vgl. Krönes, 1998, S. 77; Engelhardt, 2001, S. 21).
[...]
[1] „Demographie ist eine Bevölkerungswissenschaft…“, „…die sich mit der Beschreibung der Bevölkerungsstruktur einer Gesellschaft befasst“ (vgl. Stanjek, 2001, S. 184).
[2] Um eine eindeutige und übersichtliche Zuordnung der Literaturquellen für die einzelnen Zitate zu gewährleisten, werde ich nach dem Harvard-Verfahren bei Zitaten jeweils einen vollständigen Beleg anführen. Angaben wie „ebd.“ oder „a.a.O.“ werden nicht benutzt.
[3] Der enorme Rückgang der Sterblichkeit wurde als epidemiologischer Übergang bezeichnet, weil er begleitet war von massiven Veränderungen der Krankheitsformen und Todesursachen. http://www.bbr.bund.de/raumordnung/bevoelkerung/lebenserwartung.htm
[4] Kurativ, [lat.] curare = heilen, kurieren (vgl. Duden, 2000, S. 774).
[5] Das Statistische Bundesamt veröffentlicht zwar jährlich Todesstatistiken, die Angaben zu den Todesursachen und zu den demographischen Variablen enthalten, aber es gibt weder national noch international umfassende Sterbestatistiken im Hinblick auf Sterbeorte. Statistische Belege werden aus den Meldungen der Krankenhäuser eingesetzt, wobei es sich hier nur um Schätzungen handelt (vgl. Deutscher Bundestag, 2002, S.273).
[6] Terminal [Adj., o. Steig.] ,[lat.] terminalis = die Grenze, das Ende betreffend, zum Ende gehörend (vgl. Duden, 2000, S. 1325).
[7] Hospize wurden insbesondere an Pilgerwegen errichtet, wie zum Beispiel an dem bekannten, spanischen Pilgerweg nach „Santiago de Compostela“.
[8] 1842 gründete Jeanne Garnier in Frankreich, 1879 Mary Aikenhead in Dublin und London und 1899 Rose Hawthorn in New York das erste Hospiz (vgl. Deutscher Bundestag, 2005, S. 9f; Howarth/ Leaman, 2001, S. 245).
[9] Man versteht unter Palliativmedizin (lat. pallium = Mantel) das Behandeln und Pflegen von Patienten, die an einer unheilbaren Krankheit leiden. Angestrebt werden die Linderung der Beschwerden und das würdevolle Weiterleben bis zum Tod. Daher steht die Linderung der Symptome, nicht die Ursachenbekämpfung im Fokus der Palliativmedizin (vgl. Duden, 2000, S. 977).
[10] Die Originalausgabe ist unter dem Titel „On Death and Dying“ 1969 erschienen.
[11] Der Film wurde von Iblacker und Braun im St. Christopher`s Hospice gedreht (vgl. Student, 2004, S. 144).
[12] Public Relations [engl.] = Öffentlichkeitsarbeit (vgl. Langenscheidt, 2001, S. 891).
[13] Auf eine Mio. Einwohner in Deutschland kommen 17 Palliativ- und Hospizbetten. Nach Berechnungen der BAG Hospiz liegt der tatsächliche Bedarf im stationären Bereich bei 50 Palliativ- und Hospizbetten pro eine Mio. Einwohner (BAG Hospiz, Stand: 30.09.2005).
[14] Progredienz = das Fortschreiten, die zunehmende Verschlimmerung einer Krankheit, progredient [lat.] = fortschreiten (vgl. Duden, 2000, S. 1092).
[15] Daimler-Benz setzt sich seit geraumer Zeit im Rahmen des Social Sponsorings für den Hospizbereich ein (vgl. Klie, 1999, S. 204).
[16] Beim Begriff „Qualitätsmanagement“ (QM) handelt es sich um einen neuen Begriff, der erst im März 1992 von der International Standard Organisation (ISO) eingeführt wurde. Vorher stand der Oberbegriff „Qualitätssicherung“ für alle Umsetzungsstrategien, um die Erhaltung und Weiterentwicklung der Dienstleistungsqualität zu gewähren (vgl. Engelhardt, zit. Kaminske, 2001, S. 21).
[17] Total= die Berücksichtigung aller Beteiligten an der Leistungserstellung, Quality= die Orientierung an der Qualität vor Beginn und während des Prozessablaufes einschließlich der externen und internen Beziehungen, Management = das Management übernimmt eine Vorbildfunktion und ist auf Verbesserung der Leistungsqualität ausgerichtet (vgl. www.quality.de/lexikon/tqm.htm; Hummel/ Malorny, 2002, S. 7).
[18] Im Zentrum der Kundenorientierung steht in erster Linie der externe Kunde, (Patienten, Angehörige, Kostenträger, zusammenarbeitende Institutionen) aber auch die internen Kunden (Mitarbeiter, Verwaltung) sind an diesem Prozess beteiligt (vgl. Schubert/ Zink, 2001, S. 185).
- Arbeit zitieren
- Susanne Arzinger (Autor:in), 2006, Qualitätsmanagement am Beispiel der stationären Hospizarbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136037
Kostenlos Autor werden




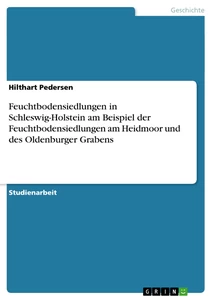

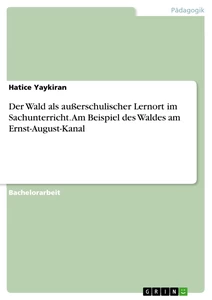















Kommentare