Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Teil
1.1. Einleitung
1.2. Das Gedächtnis
1.3. Das Nervensystem
1.4. Sprache
1.5. Kognition
1.6. Die Welt im Kopf
1.7. Wahr heit
1.8. Emotionen und Gefühle
1.9. Spiegelzellen – der Schlüssel zur Literatur
1.10. Das Bewusstsein
2. Teil
2.1. Textlinguistik und Kognition
2.1.1. Gestaltpsychologischer Ansatz der Textlinguistik
2.1.2. Linguistischer Ansatz der Textlinguistik
2.1.2.1. Konzept einer „Story Grammar“
2.1.2.2. „Structural-Affect-Theory“
2.1.2.3. „Action-Theory“
2.1.2.4. „Construction-Integration-Modell“
2.2. Empirische Literaturwissenschaft
2.2.1. Die NIKOL-Konzeption
2.2.2. Die Neu-Definition des Literaturbegriffs
2.2.3. Die elementaren Handlungstypen (Produktion/ Vermittlung/ Rezeption/ Verarbeitung)
2.2.4. Text-Bedeutungen
2.3. Empirische Forschungen von Stadler und Wildgen
3. Teil
3.1. Eigene empirische Untersuchungen
3.1.1. Die Texte
3.1.2. Die Testpersonen
3.1.3. Die Vorgangsweise
3.1.4. Auswertung
3.1.4.1. Serienreproduktion
3.1.4.2. Einzelne Reproduktionen der selben Geschichte
3.1.4.3. Aktantenkontinuität
3.1.4.4. Prozessuale/Inhaltliche Kontinuität
3.1.4.5. Reproduktion eines sprachexperimentellen Textes
3.2. Schlussbemerkungen
Zusammenfassung
Literatur- und Quellenangaben
Anhang
I Der Knabe fischte mit dem Netz
II Das Postamt
III Der Knabe
IV L ie be
V (Curcios) Schnittkunde
1. Teil
1.1. Einleitung
Die traditionelle Aufteilung der Wissenschaften in Natur- und Geisteswissenschaften wird durch die Unterschiede in den Gegenständen und den Verfahren legitimiert. Natur- und Biowissenschaften wollen Naturgesetze aufdecken unter Ausschluss von allem Geschichtlichen, dem menschlichen Denken, Wünschen, Glauben und Fühlen. Die Geisteswissenschaften hingegen befassen sich mit den Erscheinungsformen der geistigen Welt, wie es Wilhelm Dilthey formuliert hat. Die Methode der Geisteswissenschaften ist das hermeneutische Verstehen, während die Naturwissenschaften empirische Überprüfbarkeit fordern. Empirische Überprüfbarkeit wird von vielen Vertretern der Geisteswissenschaften vehement abgelehnt. Man geht von zwei Wahrheitsbegriffen aus, einem analytisch-erklärenden und einem hermeneutisch-verstehenden. Obwohl heute diese Zweiteilung des Wahrheitsbegriffes nicht mehr akzeptabel ist und auch die Geisteswissenschaften aus Gründen der Eindeutigkeit und Anschlussfähigkeit ebenfalls der Forderung nach Überprüfbarkeit nachkommen müssen, um als wissenschaftlich anerkannt zu werden, hinkt die Realität dennoch in gewisser Hinsicht der Theorie nach. Dies gilt auch für die Literaturwissenschaft. Viele literaturwissenschaftliche Arbeiten vermitteln den Eindruck, dass diese selbst ebenfalls zur Textsorte Literatur gehören, da die literarisch-ästhetischen Komponenten oft stärker als die wissenschaftlichen in den Vordergrund treten. Natürlich müssen die Methoden der empirischen Überprüfung dem Sachgebiet angepasst sein. In der vorliegenden Diplomarbeit befasse ich mich mit empirischen Methoden, die man auf dem Gebiet der Literaturwissenschaft anwenden kann.
Wenn man interdisziplinäre Narratologie betreibt, heißt das, dass man berücksichtigt, „dass l iterarische Erzählungen nicht nur auf dem Papier stehen, sondern von Menschen, und das heißt: von menschlichen Psychen mit teils bewussten, teils unbewussten Absichten und Bedürfnissen hervorgebracht bzw. aufgenommen werden“. Texte sind erst im Augenblick der „mentalen, psychischen Aktualisierung existent“, wenn man einer nicht nur text-immanent-deskriptiven Anschauung Rechnung trägt, sondern auch einer handlungsbezogenen Betrachtungsweise. Leider sehen bis dato die Geistes- und Literaturwissenschaften großteils von dieser psychischen Grundvoraussetzung von Geist, von Kunst und Erzählungen weitgehend ab, doch nicht nur von der psychischen Verfassung der an den Literaturprozessen beteiligten Menschen und der wichtigen psycho- und handlungslogischen Dimension von Erzählen, sondern auch von dessen psycho-affektiven Funktionen (vgl.: Weilnböck 2006). Das menschliche Erzählen ist ein komplexes Phänomen, was der geisteswissenschaftliche Mainstream nicht anerkennen will. Die Pioniere einer interdisziplinären Erzähl- und Kulturforschung, vor allem im deutschsprachigen Raum, sind teilweise auf die Medien- und Kommunikationswissenschaften ausgewichen, da die deutsche Philologie davon nicht so recht etwas wissen will, während die Anglistik eine viel offenere Haltung zu diesem interdisziplinären Ansatz einnimmt. Vereinzelt wird im deutschen Sprachraum sogar von einer Rephilologisierung der Geisteswissenschaften gesprochen (vgl.: Weilnböck 2006).
Umgekehrt wird es aber auch immer wichtiger, auf dem Gebiet der Naturwissenschaften eine Theorie des Erfassens von Bedeutung zu entwickeln, ein Thema das bislang für die Geisteswissenschaften zentral war. Die Hirnforschung ist ein geeigneter Wissenszweig, um Brücken zu schlagen zwischen „bedeutungsfreien und bedeutungshaften, erklärenden und verstehenden Prozessen“. Erklären und Verstehen dürfen keine Gegensätze bleiben, denn Verstehen kann eine „kontext- und erfahrungsabhängige Form von Erklärung sein“ (Roth 2003: 205). Die Trennung der Wissenschaft in „zwei Welten“ war nur solange sinnvoll, als man annahm, dass sich die nichtmenschliche Natur mit ihrer unwandelbaren Gesetzmäßigkeit von der des Menschen, die historisch und individuell zu sein schien, grundsätzlich unterscheidet. Neue Erkenntnisse der Biologie, der Hirnforschung und der Psychologie zeigen uns jedoch, dass dieses Lager-Denken nicht mehr erklärungsgemäß ist. Man muss aber auch betonen, dass eine objektive Erkenntnis nicht möglich ist, da jede Erkenntnis von der menschlichen Wahrnehmungsfähigkeit und vom Denken abhängig ist. Daraus kann man also folgern, dass es keinen grundsätzlichen Gegensatz zwischen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Aussagen gibt. Dennoch zeichnen sich die menschlichen Wahrnehmungsprozesse durch eine gewisse Verlässlichkeit und eine Verallgemeinerbarkeit von Aussagen aus. Da Wissenschaft selbstreferentiell ist, kann man nur aufgrund allgemein akzeptierter Definitionen und mithilfe anerkannter Methoden empirische Forschungen durchführen und Regelmäßigkeiten aufzeigen. Der Begriff der wissenschaftlichen Tätigkeit unterliegt, wie auch die Denk- und Handlungsweisen der Menschen, dem Wandel der Zeit (vgl.: Roth 2003: 202- 209), aber natürlich ist sie auch vom jeweiligen Kulturkreis determiniert. Ich werde nun den Versuch unternehmen, die Anwendungsmöglichkeiten einiger dieser Auffassungen und Forderungen, aber auch deren Grenzen auf dem Gebiet der Empirischen Literaturwissenschaft aufzuzeigen. Vor allem geht es mir dabei um den empirischen Leser, mit all seinen biologisch-psychischen, historisch-kulturellen Voraussetzungen, der den impliziten Leser ablöst. Zu diesem Zweck möchte ich zunächst einmal einen kleinen Exkurs auf das Gebiet der kognitiven Psychologie, der Neurobiologie und der Hirnforschung unternehmen.
1.2. Das Gedächtnis
Bei der Rezeption und Reproduktion von narrativen Texten bedarf es zunächst einmal eines funktionierenden Gedächtnisses. Der Mensch ist – man könnte sagen - eine nicht-triviale Maschine, im Gegensatz zu einer trivialen Maschine. Eine triviale Maschine basiert auf einem Input-Output-Prinzip, bei dem sie unveränderlich durch Operationen gewisse Ursachen mit gewissen Wirkungen verbindet, während eine nicht-triviale Maschine selbst wieder von den vorangegangenen Operationen beeinflusst und verändert wird (vgl.: Förster 1992: 41-88).
Man kann also von einem aktiven Gedächtnis und einer eigenständigen Organisationsleistung des Gedächtnisses von Menschen ausgehen. Dadurch werden Bedeutungskomplexe generiert, die durch Resonanz den Charakter des „Wiedererkennens“ haben, umso mehr, je konsistenter die konstruierten Bedeutungskomplexe sind. Auf dieses Phänomen werde ich im Kapitel „gestaltpsychologischer Ansatz der Textlinguistik“ noch zu sprechen kommen, und im 3. Teil der vorliegenden Arbeit werden wir die Relevanz dieses Phänomens für die Reproduktion narrativer Texte beobachten können.
Einer der Begründer der kognitiven Psychologie war der britische Psychologe Frederic C. Bartlett (1886 – 1969). Er ließ Menschen Geschichten und Bilder lernen und bewies damit, wie fragil das Gedächtnis eigentlich ist.
„Remembering is not the re-excitation of innumerable fixed, lifeless and fragmentary traces. It is an imaginative reconstruction, or cnstruction, built out of the relation of our attitude towards a whole active mass of organized past reactions or experience, and to a little outstanding detail which commonly appears in image or in language form.” (Squire 1999, 2000: 6) Schön langsam erkannten dies auch andere Psychologen.
“… perception and memory depend not only on information in the environment but also on the mental structure of the perceiver or the rememberer. … internal representations of mental processes were tenuous theoretical constructs, difficult to approach experimentally. Reaction time measurements, for example, yielded insights about the order in which these hypothetical mental operations are carried out.” (Squire 1999, 2000: 6-7) Da also diese Vorgänge nur indirekt untersuchbar waren, mussten die Psychologen sich mit Biologen zusammenschließen, um die black box zu öffnen (vgl.: Squire 1999, 2000: 7).
„Wir können ohne Übertreibung sagen, dass bei komplexen Wahrnehmungen unser Gedächtnis das wichtigste Wahrnehmungsorgan ist.“ (Roth 2003: 84) Im Laufe meiner Arbeit werde ich noch öfter auf das Gedächtnis bzw. die verschiedenen Formen des Gedächtnisses zu sprechen kommen, da es natürlich bei Literaturprozessen eine ganz wesentliche Rolle spielt. Auch meine empirischen Untersuchungen auf dem Gebiet der Rezeption literarischer/ narrativer Texte stützen sich auf Reproduktionen aus dem Gedächtnis nach einmaligem Hören.
Die Revolution der Molekularbiologie am Ende des 19. Jhdts. bzw. am Beginn des 20. Jhdts. durch die Arbeiten von Gregor Mendel, William Bateson und Thomas Hunt Morgan und die Entdeckung der Gene, die Erforschung der DNA und RNA durch James Watson und Frances Crick, aber auch die Entwicklung von PET und anderen bildgebenden Methoden, mit denen die Vorgänge im Gehirn sichtbar gemacht werden können, haben seither die Erforschung des Gedächtnisses vorangetrieben, und zwar auf dem Gebiet der mulekularen Mechanismen des Gedächtnisses, als auch auf dem Gebiet der neuronalen Vorgänge im Gehirn während der Gedächtnisleistungen.
Das Ergebnis war, dass man feststellen musste, dass das Gedächtnis nicht auf eine bestimmte Gehirnregion beschränkt ist, sondern dass es vielmehr viele Regionen sind, die in den Prozess involviert sind, wobei aber jede einzelne für andere Aspekte zuständig ist. Und jede leistet ihren Beitrag zur Aufbewahrung aller Erinnerungen als Gesamtheit.
Abgesehen vom Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, kann man auch zwischen einem deklarativen und einem nicht-deklarativen Gedächtnis unterscheiden, wobei die Daten des letzteren nicht abrufbar sind, sondern sich nur in einem allgemeinen Verhalten äußern. Dieses Gedächtnis wäre mit Freuds Unbewusstem zu vergleichen, mit dem Unterschied, dass es nie bewusst gemacht werden kann (vgl.: Squire 1999, 2000: 1-21).
1.3. Das Nervensystem
Die vorliegende Diplomarbeit hat den Anspruch, eine interdisziplinäre Arbeit zu sein. Daher möchte ich mich etwas ausführlicher mit dem menschlichen Nervensystem befassen.
Franz Joseph Gall, ein Wiener Anatom des 19. Jhds., meinte, dass es 27 Eigenschaften und Fähigkeiten wären, die den Menschen zum Menschen machten. Jeder dieser Fähigkeiten wäre ein Teil der Gehirnrinde reserviert. Teilweise hatte er recht. Allerdings ging er etwas zu weit, wenn er z. B. glaubte, sogar dem dichterischen Talent eine bestimmte Region der Gehirnrinde zuordnen zu müssen. Auch dachte er, dass die Schädelform die Form des Gehirns wiedergäbe, was sich als Irrtum erwies. Doch, wie es Stefano F. Cappa formuliert: „Gall must thus be credited with the introduction of a materialistic point of view in the study of mental life.” (Cappa 1999: 25) Unser Geist ist nämlich körperlicher als wir bislang annahmen.
Das Nervensystem besteht aus neuralem Gewebe, das sich also aus Nervenzellen (= Neuronen) zusammensetzt. Neuronen werden von Gliazellen gestützt und bestehen aus drei Teilen: dem Zellkörper, einem Axon (= Outputfaser) und Dendriten (= Inputfasern). Neuronen bilden Schaltkreise. Die Kontaktstellen heißen Synapsen (= die Verbindungen zw. einem Axion und den Dendriten eines anderen Neurons).
Bei der Geburt sind fast alle Nervenzellen bereits vorhanden, über verzweigte Axone nehmen sie zu anderen Nervenzellen Kontakt auf. Chemische Wachstumsstoffe leiten sie dabei.
„Ein Neuron kann einerseits über seine axonalen Verzweigungen mit bis zu 10.000 anderen Nervenzellen verbunden sein und erhält andererseits einen synaptischen Eingang von 10.000 präsynaptischen Neuronen.“ (Luhmann 2006: 36) Während der kindlichen Entwicklung werden jedoch viele dieser Verbindungen wieder abgebaut, wenn nicht durch gemeinsame und gleichzeitige elektrische Aktivität der synaptische Konsolidierungsprozess gefördert wird. „Use it or loose it“ ist dabei die Devise.
Konkret passiert bei der Kommunikation zweier Nervenzellen Folgendes: Wenn Neuronen „feuern“ (= aktiv werden) breitet sich entlang des Axons elektrischer Strom aus. Stößt dieser auf eine Synapse, werden chemische Stoffe freigesetzt. Der elektrische Impuls bewirkt nämlich, dass sich mit Chemikalien gefüllte Bläschen öffnen (Botenstoffe = Neurotransmitter, ca. 50 verschiedene). Diese überqueren den einige Bruchteile eines Millimeters großen Spalt, erreichen dort eine Membran, die Rezeptoren enthält und die Neurotransmitter haken sich daran fest. Dadurch ändert sich die elektrische Spannung der Membran und die Nervenzelle kann wieder ein elektrisches Signal weiterfeuern. Jedes der etwa zehn Milliarden Neuronen hat ca. 1000 Synapsen, also insgesamt gibt es zehn Billionen teils schwache, teils starke Synapsen. Ein Signal kann aber auch blockiert werden und den Spalt nicht passieren dürfen (vgl.: Damasio 1999: 19).
Interessant ist auch die Tatsache, dass es keine neuronale Aktivität, keine speziellen neurochemischen Vorgänge an den Synapsen gibt, die zum Beispiel für das Sehen, Hören, Tasten, Denken, Vorstellen oder Erinnern spezifisch wären (vgl.: Roth 2003: 81-83). Somit legt also nicht die Art der neuronalen Aktivität, sondern „[d]er Ort der Erregung […] den Inhalt fest, und zwar unabhängig davon, woher die Erregung stammt.“ (Roth 2003: 82) Das Nervensystem unterteilt man in ein zentrales und ein peripheres. Der Hauptteil des Zentralnervensystems ist das Zerebrum (= Großhirn). Das Großhirn ist in zwei Hemisphären (= Hälften) gegliedert und durch Nervenfasern miteinander verbunden. Jede Gehirnhälfte besteht aus einem Frontallappen (= Stirnlappen), einem Partiallappen (= Scheitellappen), einem Temporallappen (= Schläfenlappen) und einem Okzipitallappen (= Hinterhauptslappen). Im Hinterhaupts-, Scheitel- und Schläfenlappen l iegen die Bereiche des Gehirns, die mit Wahrnehmungen zu tun haben, z. B. der Gleichgewichtssinn (vestibuläres System), Körperempfindungen (somatosensorisches System), das Sehen (visuelles System), Hören (auditorisches System), die Sinnessysteme für Geschmack und Geruch (gustatorisches und olfactorisches System), wobei das olfactorische System das einzige Sinnessystem ist, das nicht den Umweg über den Thalamus zur Großhirnrinde nimmt, sondern gleich direkt in das limbische System eindringt. Deshalb haben Gerüche eine unbewusste Wirkung auf Gefühle und Erinnerungen (vgl.: Roth 2003: 25-29). Die Großhirnrinde (= Kortex) fungiert als „Mantel des Großhirns“ (Damasio 2002: 394). Der Kortex, oder auch Neokortex genannt, ist für komplexe Denk-, Lern- und Sprachprozesse zuständig. In der Mitte des Gehirns liegt der Thalamus, der die zentrale Schaltstelle für alle sensorischen Impulse darstellt. Der darunter liegende Hypothalamus ist für Stoffwechselvorgänge verantwortlich und einige Emotionen. Im Hirnstamm befindet sich die Formatio reticularis, die für Reaktionen auf Impulse höherer Zentren zuständig ist. Die vegetativen Funktionen, biologische Grundbedürfnisse und Affekte sind im Hirnstamm (besonders im Zentralen Höhlengrau), im Hypothalamus und Teilen des Mandelkerns angesiedelt (vgl.: Roth 2003: 25-29). Im Reptiliengehirn befindet sich das limbische System, in welchem vor allem emotionelle Prozesse stattfinden (vgl.: Alfes 1995: 58). Das Großhirn ist über den Hirnstamm mit dem Rückenmark, hinter dem das Kleinhirn (= Zerebellum) liegt, verbunden (vgl.: Damasio 2002: 389-402). Im Mittelhirn, im Verlängerten Mark und im Rückenmark werden die Körperbewegungen gesteuert (motorisches System). Auch einige der außerhalb der Großhirnrinde liegenden motorischen Zentren sind an der Willkürmotorik beteiligt, z.B. die Basalganglien. Im sogenannten assoziativen Cortex, d.h. in den Teilen der Großhirnrinde, die nicht sensorische oder motorische Hirnrindenareale sind, finden sich die Hirnfunktionen, die kognitive Leistungen, komplexe Wahrnehmungen, Vorstellungen, Erinnerungen und Handlungsplanung umfassen, so auch die Sprache. Komplexe Sehleistungen finden im vorderen Hinterhauptslappen, im mittleren und unteren Schläfenlappen sowie im unteren Scheitellappen statt. Geräusche, Musik und Sprache werden im oberen und mittleren Schläfenlappen verarbeitet. Der hintere Scheitellappen ist für die Raumwahrnehmung, die Orientierung und Augen- und Greifbewegungen zuständig. Der präfrontale Cortex im Stirnhirn und Bereiche des Scheitellappens sind mit bewusster Handlungsplanung und Handlungsvorbereitung befasst. In der assoziativen Großhirnrinde ist auch unser bewusstseinsfähiges Gedächtnis, welches vom Hippocampus gelenkt wird. Die getroffenen Entscheidungen werden in Zusammenarbeit mit dem limbischen System an das motorische System weitergeleitet. Das limbische System beinhaltet alle Zentren, die mit einer emotionalen Bewertung befasst sind. Neben dem Hypothalamus gehören auch vor allem der Mandelkern (Amygdala), das mesolimbische System mit dem ventralen Striatum, dem Nucleus accumbens und dem Ventralen Tegmentalen Areal, der insuläre, cinguläre und orbitofrontale Cortex sowie der Hippocampus und die umgebende Hirnrinde (entorhinaler, parahippocampaler und perirhinaler Cortex) dazu. Alle diese Zentren arbeiten völlig unbewusst, wir nehmen nur Affekte, Gefühle und Wünsche wahr. Eine Ausnahme davon bildet nur der orbitofronale Cortex. Das Gehirn entwickelt über das limbische System bewusst und unbewusst Wünsche, Absichten, Erwartungen, die unser Verhalten und unsere Handlungen steuern.
„Diese innengesteuerten Handlungen sind sogar viel bedeutender als die durch Wahrnehmungen geleiteten Handlungen.“ (Roth 2003: 29)
Das Zentralnervensystem steht mit jedem Punkt des Körpers durch Nerven in Verbindung, wobei man die Gesamtheit dieser Nerven als das periphere Nervensystem bezeichnet. Der Körper und das Gehirn sind aber auch chemisch miteinander verbunden, und zwar durch Hormone, die sich in der Blutbahn befinden.
Anhand von Pathologien kann man erkennen, dass die Ich-Körper-Welt- Beziehung gar nichts a priori Gegebenes ist, sondern durch unser Gehirn hergestellt wird (vgl.: Roth 2003: 25-29).
„Wir müssen dabei bedenken, dass die Empfindung, es gäbe einen Körper, in dem ich stecke und der deshalb mein Körper ist, ebenso ein Konstrukt meines Gehirns ist, wie die Welt um mich herum. Dieses Konstrukt kann […] zusammenbrechen, und dann entstehen diese sehr eigenartigen Erfahrungen.“ (Roth 2003: 47) Mit diesen eigenartigen Erfahrungen meint Roth z.B. „out-of body“-Erfahrung oder Nahtodeserlebnisse. Unsere Erlebniswelt setzt sich aus mehreren Unter- Welten zusammen, der Sehwelt, der Hörwelt, etc., die getrennt voneinander und zu unterschiedlichen Zeiten entstehen. Die Welt, die festgefügt erscheint, ist in Wirklichkeit ein labiles Konstrukt, das in sich zusammenbrechen kann, sobald Teilfunktionen nicht mehr richtig bedient werden können.
„… - wir leben in einer imagierten Welt, aber es ist für uns die einzige erlebbare Welt.“ (Roth 2003: 48) Dies nennt man den erkenntnistheoretischen Zirkel, der verhindert, dass wir die Welt in ihrer tatsächlichen Beschaffenheit, in ihrem Wahrheitsgehalt, überhaupt wahrnehmen und erfassen können (vgl.: Roth 2003: 73).
„Wahrnehmung beruht also nicht auf einer direkten Abbildung der Welt, einer bloßen Kopie, aber doch auf einer systematischen, wenngleich ausschnitthaften, hervorgehobenen und abgeschwächten Repräsentation der Welt im Gehirn, die mit der spezifischen Überlebenssituation des Organismus eng zusammenhängt. Wie könnte der Organismus auch überleben, wenn er nicht das Wesentliche seiner Umwelt erfasste?“ (Roth 2003: 72)
Bewegungen, Farben, Formen, etc. können nicht direkt von den Wellenlängenunterschieden, Kontrasten und räumlichen Anordnungen in der Welt abgeleitet werden, sondern sind das Produkt von Berechnungen in neuronalen Netzwerken. Wir halten sie jedoch für Zustände der bewusstseinsunabhängigen Welt. Wir können eine zweite, eine naturwissenschaftliche Wahrnehmungswelt schaffen, welche auf Messmethoden, auf Hypothesen- und Theoriebildung beruht, aber diese sagen uns letztlich auch nicht, welche objektiven Vorgänge unseren Wahrnehmungen zugrunde l iegen, sondern zeigen uns nur, dass zwischen unseren Wahrnehmungsinhalten und dem gemessenen physikalischen oder chemischen Reiz keine Ähnlichkeit herrscht (vgl.: Roth 2003: 74, 81).
„Wir können ohne Übertreibung sagen, dass bei komplexen Wahrnehmungen unser Gedächtnis das wichtigste Wahrnehmungsorgan ist. Aufbauend auf genetisch vorgegebenen oder früh verfestigten primären Interpretationshilfen […] ist jeder Wahrnehmungsprozess eine Hypothesenbildung über Gestalten, Zusammenhänge und Bedeutungen der Welt.“ Der erkenntnistheoretische Konstruktivismus betont, „dass es keinen abbildhaften Zusammenhang zwischen den Vorgängen in der Welt und den Inhalten unserer Wahrnehmung gibt“. (Roth 2003: 84)
Wenn diese Annahme für die Wahrnehmung unserer realen Welt gelten soll, um wie viel eher müsste sie dann auch für die Wahrnehmung und kognitive Verarbeitung fiktionaler Texte gelten!
„Der radikale Konstruktivismus beruht auf der Annahme, dass alles Wissen, wie immer man es auch definieren mag, nur in den Köpfen von Menschen existiert und dass das denkende Subjekt sein Wissen nur auf der Grundlage eigener Erfahrung konstruieren kann. Was wir aus unserer Erfahrung machen, das allein bildet die Welt, in der wir bewusst leben.“ (Glasersfeld 1997: 22)
Das Nervensystem kann keine Informationen im Sinne von Bedeutungen und Wissen aufnehmen. Bedeutung entsteht durch die Erregungen in den Sinnesorganen, die auf den unterschiedlichen Ebenen des Gehirns miteinander verglichen und mit Gedächtnisinhalten versetzt werden (vgl.: Roth 2003: 85).
Ich verweile deshalb so lange und ausführlich bei den neuronalen Vorgängen, weil ich sie für äußerst relevant für die Beschäftigung mit Literaturprozessen halte. Schon einige Vorsokratiker erkannten, dass es ein objektives Wissen als „Spiegelung einer an und für sich unabhängigen ontologischen Wirklichkeit“ nicht geben konnte, da sich diese Wirklichkeit dem erlebenden Subjekt eben nur durch das Erlebtwerden erschließt. Wirklichkeit entsteht in der Regel dadurch, dass unser eigenes Erleben von anderen bestätigt wird (Vgl.: Glasersfeld 1997: 9-39). Wirklichkeit ist also keine objektive vom Menschen unabhängige Größe, sondern ebenso nur ein Konstrukt, wie Fiktion eines ist, eine menschliche Schöpfung aufgrund unseres angeborenen neurobiologisch bedingten Erkenntnisvermögens und der kulturell bedingten Interpretationen.
Der Radikale Konstruktivismus stützt sich vor allem auf den bioepistemologischen Beschreibungsansatz Humberto R. Maturanas, der nicht die Inhalte und Gegenstände des Erkennens ins Zentrum rückte, sondern den Prozess des Erkennens selbst, denn die Wahrnehmungen des Menschen sind von dessen neurobiologischer Konstitution abhängig, und somit sind dem Erkennen der Außenwelt natürliche Grenzen gesetzt. Das Leben selbst ist ein Prozess der kognitiven Konstruktion, unser Nervensystem eine geschlossene, selbstbezügliche Entität.
„Autopoietische Systeme sind selbsterzeugend, autonom, strukturdeterminiert, selbstreferenziell und operational geschlossen.“ (Schmidt 1997: 151)
Dies erklärt auch das Phänomen, dass bei der Reproduktion narrativer Texte sich diese in den Köpfen der Rezipienten oft dermaßen verändern, dass teilweise sogar völlig andere Geschichten entstehen, die mit der Originalversion nichts mehr zu tun haben. Der Text, der nur auf dem Papier existiert, muss im Rahmen dieser Theorie vom l iterarischen/ narrativen Kommunikat, welches erst durch die Interaktion und in den Köpfen der am Literaturprozess teilnehmenden Akteure entsteht, abgelöst werden.
Zunächst jedoch wurden neuronale und kognitive Erkenntnisse auf dem Gebiet der Sprachwissenschaft genutzt.
1.4. Sprache
Der Gehirnforscher Alexander Lurija hatte sich mit einem gewissen Herrn Sassezki angefreundet, der als russischer Soldat im 2. Weltkrieg am Kopf verletzt worden war. Lurija schrieb dessen traurige Geschichte nieder und veröffentlichte sie unter dem Titel „Der Mann, dessen Welt in Scherben ging“. Für die fragmentierte Welt im Kopf Sassezkis war eine Verletzung des Assoziationscortex verantwortlich. Es gibt mehrere solcher Assoziationsfelder, die dafür zuständig sind, Sinneseindrücke zu kombinieren. Dieser Planungsapparat befindet sich hinter der Stirn. Sinneseindrücke werden mit Gedächtnisinhalten verknüpft, um Aktionspläne zu erstellen (vgl.: Rubner 1999: 26-27).
Laut Lurija organisiert die Sprache unsere innere Welt. Für ihn ist sie nicht nur Verständigungsmittel, sondern entscheidend im Prozess des Erkennens. Und der französische Biologe Jacques Monod ist der Meinung, dass die Sprache den Menschen erschaffen habe und nicht umgekehrt. Der Kehlkopf hat sich erst vor etwa 50000 Jahren so entwickelt, dass flüssige Sprache möglich ist, Sprache könnte frühestens vor 100000 Jahren entstanden sein, die Anlage dazu jedoch vor einigen hunderttausend Jahren, vielleicht ca. 500000 (vgl.: Rubner 1999: 61-62).
Das Geburtsjahr der Sprachforschung war das Jahr 1861. Paul Broca, ein französischer Nervenarzt hatte die Entdeckung gemacht, dass die linke Gehirnhälfte bei der Sprachproduktion eine dominante Rolle spielt (vgl.: Cappa 2001: 3)
1861 wird aber ebenfalls als das Geburtsjahr der wissenschaftlichen Neuropsychologie angesehen.
Das Broca-Areal befindet sich im unteren Stirnlappen. Bei einer Schädigung dieses Areals kommt es zur Broca-Aphasie, einer Sprachstörung, bei der gesprochene und geschriebene Sprache sehr gut verstanden wird. Broca- Aphasiker können aber selbst nur im Telegrammstil sprechen und verwenden keine Funktionswörter, sondern vorwiegend Hauptwörter.
Ein anderes ebenfalls im 19. Jhd. entdecktes Sprachzentrum im Gehirn ist das Wernicke-Areal, benannt nach dem deutschen Sprachforscher Wernicke. Bei der Wernicke-Aphasie können die Patienten flüssig sprechen, aber unsinnig. Das Wernicke-Areal befindet sich im hinteren oberen Schläfenlappen. Es erhält Signale vom Assoziationscortex über diverse Sinneseindrücke. Das Wernicke-Areal ist eine Art Lexikon, in dem die Gedächtnisspuren gesprochener und geschriebener Wörter enthalten sind (vgl.: Rubner 1999: 70). Das Wernicke-Areal ist dafür verantwortlich, dass wir Sprache verstehen. Es kümmert sich um die Bedeutung der Sprache, um die Semantik, nicht um Grammatik oder Sprachproduktion (vgl.: Kast 2003: 79).
Das Broca-Areal ist ein Lexikon. Dort sind die Wörter als Bewegungsabläufe der Sprachmuskulatur abgelegt und es fungiert auch als eine Art Grammatik- Maschine (vgl.: Rubner 1999: 72).
„[…] there is ample evidence that hemispheric specialisation is the functional correlate of the asymmetric anatomical organization of the cerebral hemispheres. Asymmetry is probably determined genetically, but […] multiple epigenetic factors can affect the pattern of menispheric specialisation. In particular, sex homones, such as testosterone, […]. The application of these biological observations to the interpretation of gender-related differences in psychological function has led to the idea that hemispheric specialisation might be ‘different’ in females, with more frequent bilateral representation of functions (i.e. less ‘specialisation’).” (Cappa 2001: 9)
Diese Hypothesen über geschlechtsspezifische Unterschiede sind am Menschen allerdings nicht hinreichend empirisch untersucht worden und stießen auch immer wieder auf Kontroversen, obwohl man sogar bei Tierversuchen dieses Phänomen beobachten konnte.
Wahrscheinlich hat sich die Sprache „aus Vorstufen innerartlicher Kommunikation entwickelt“, wobei „lautliche, mimische und gestische Signale miteinander kombiniert wurden“. Tierische Sprache ist allerdings stark kontextabhängig, Grammatik und Syntax fehlen weitgehend. Um Momentaufnahmen zu einem „Strom des Bewusstseins“ zu verbinden, benötigt man ein ausgedehntes episodisches Gedächtnis, das sich beim Kleinkind zum Ende des ersten Lebensjahres zu entwickeln beginnt. Erst mit ca. 5 oder 6 Jahren haben Kinder eine längerfristige Vorstellung von Zukunft.
Die menschliche Klugheit hängt von der Organisationsform des präfrontalen und orbitofrontalen Cortex ab.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Brodmann-Areale 9 und 46 werden als das Arbeitsgedächtnis (= Kurzzeitgedächtnis) angesehen und sind die Grundlage für unseren Bewusstseinsstrom. Die Brodmann-Areale 44 und 45 (= Broca-Areal) sind das Zentrum für grammatikalisch-syntaktische Sprache. Im linken Temporallappen befindet sich das Wernicke-Zentrum, welches für die Bedeutung einzelner Wörter und Sätze zuständig ist. Das Broca-Areal befindet sich ebenfalls auf der linken Seite der Großhirnrinde, im präfrontalen Cortex direkt unterhalb des Arbeitsgedächtnisses (vgl.: Roth 2003: 59).
Neuere bildgebende Methoden haben gezeigt, dass Sprachprozesse ein ausgedehntes Netzwerk von Gehirnarealen involvieren, nämlich nicht nur die linke Hemisphäre, sondern auch Areale der rechten Gehirnhälfte. Diese Areale sind verantwortlich für lexikalisch-semantische Prozesse und stellen Bezüge zu nicht-linguistischen „conceptual representations“ her, was wiederum für Literaturprozesse relevant ist, während Phonologie und Syntax eher der linken Gehirnhälfte zuzuordnen sind (vgl.: Cappa 2001: 36).
Angela Friederici, eine Leipziger Sprachforscherin hat Testpersonen Sätze vorgespielt und dabei die Hirnaktivität gemessen und festgestellt:
1. Das Broca-Areal verarbeitet die grammatische Struktur eines Satzes (in 200 Millisekunden).
2. Das Wernicke-Areal verarbeitet die Bedeutung der Wörter (in 300 Millisekunden).
3. Danach gleicht das Gehirn nach ca. 700 Millisekunden das Ergebnis zwischen Wort- und Satzanalyse ab (vgl.: Rubner 1999: 71).
Im 3. Teil der vorliegenden Arbeit werden wir im Bezug auf den sprach- experimentellen Text beobachten können, was passsiert, wenn dieses Abgleichen im Gehirn zu keinem für die Testpersonen sinnvollen Ergebnis führt.
1.5. Kognition
Kognition ist der Sammelbegriff für Vorgänge im Gehirn bei der „Aufnahme u[nd] Verarbeitung von Informationen, erkenntnisleitenden Schemata u[nd] Begriffen durch Empfindung, Wahrnehmung, Denken, Vorstellen, Erinnern“ (Wörterbuch der philosophischen Begriffe 2005: 346-347).
Dieser Begriff wird aber auch für die Prozesse der mentalen Repräsentationen selbst verwendet und kann daher sowohl prozess- als auch produktbezogen verstanden werden (Vgl.: Metzler Lexikon Sprache 2000: 350).
„Kognition ist biologisch bestimmt durch die Architektur und Funktionsweise neuronaler Netzwerke.“ (Schmidt 1992: 25)
Sie ist aber auch von Sozialisationsprozessen, der Sprache als System von Benennungen und Unterscheidungen, sowie der jeweiligen Kultur abhängig. Der einzelne Aktant ist dabei der Schnittpunkt von so genannten Constraints (vgl.: Schmidt 1992: 25). Im Rahmen von Wirklichkeitskonstrukten und kommunikativen, kulturellen Konditionierungen konstruiert die Gesellschaft Wirklichkeit. Im einzelnen kognizierenden System (= im einzelnen Aktanten) vollzieht sich eine mehr oder weniger bewusste Selektion, Kombination und Evaluation von Operationsmöglichkeiten im Rahmen dieser Constraints.
Die Bausteine der Kognition sind sogenannte Schemata (= abstraktes und strukturiertes Wissen über mehrere Einzelfälle, welches die Beziehungen zwischen den einzelnen Komponenten repräsentiert). In einem Schema ist das deklarative Wissen (= alles, das man weiß) in Form von konstanten und variablen Einträgen in sogenannten Leerstellen gespeichert, sie enthalten aber auch prozedurales Wissen (= „knowing how“). Ein Schema ist ein Hilfsmittel des Menschen, um allen Informationen, die er über seine Sinnesorgane aufnimmt, eine Bedeutung zuzuordnen. Sie ermöglichen dem Menschen, sich in jeder Situation schnell und mühelos zurechtzufinden und sinnvoll zu verhalten, da es sich dabei um Inhalte des impliziten Gedächtnisses handelt.
„SCHEMATA sind globale Muster von Ereignissen und Zuständen in geordneten Abfolgen, wobei die Hauptverbindungen in zeitlicher Nähe und Kausalität bestehen …“ (Beaugrande/ Dressler 1981: 95)
Durch Wiedererkennen und Selektion der eingehenden Informationen wird die Relevanz dieser Schemata geprüft; durch die Speicherung und Einordnung des neuen Wissens werden die Informationslücken gefüllt. Schemata steuern also die Wahrnehmung, die Informationsverarbeitung und das Handeln des Menschen. Sie sind mentale Wissensstrukturen, die Informationen über bestimmte Objekte oder Konzepte in abstrakter, allgemeiner Form enthalten.
„PLÄNE sind globale Muster von Ereignissen und Zuständen, die zu einem beabsichtigten ZIEL führen …“ (Beaugrande/ Dressler 1981: 95) Der Unterschied zu Schemata besteht also darin, dass es einen Planer, einen Textproduzenten geben muss, der dieses Ziel verfolgt.
„SKRIPTS sind stabilisierte Pläne, die häufig abgerufen werden, um die Rollen und die erwarteten Handlungen der Kommunikationsteilnehmer zu bestimmen … Skripts unterscheiden sich also dadurch von Plänen, dass sie eine im voraus festgesetzte Routine haben …“ (Beaugrande/ Dressler 1981: 96)
Ein Script (= Skript) ist also eine Gedächtnisstruktur, die allgemeines Wissen über eine typische Situation speichert und dadurch die Bildung von Erwartungen und die Ableitung von Beziehungen zwischen Dingen oder Ereignissen ermöglicht. Diese Gedächtnisstrukturen werden auch bei Literaturprozessen wirksam, wobei ebenso Scripts aktiviert werden, die spezielles Wissen über fiktionale Texte und Narration gespeichert haben. Scripts, auch Ereignisschemata genannt, sind also eine zusammenhängende Folge von Ereignissen, die ein Individuum erwartet, und zwar entweder als Teilnehmer (= Aktant 1. Ordnung) oder als Beobachter (= Aktant 2. Ordnung). Die Rezipienten eines narrativen Textes sind Beobachter 2. Ordnung. Scripts ermöglichen ihnen die Bildung von Erwartungs- Erwartungen, mittels derer etwaige Leerstellen im Text gefüllt werden können.
Ein wesentliches Grundelement von Scripts ist ein Frame.
„FRAMES (‚Rahmen’) sind globale Muster, die Alltagswissen über irgendein zentrales Konzept, wie z.B. ‚Geburtstagsfeiern’, umfassen … [Sie] geben an, was im Prinzip zusammengehört, aber nicht in welcher
Reihenfolge die zusammengehörigen Dinge getan oder erwähnt werden sollen.“ (Beaugrande/ Dressler 1981: 95)
Mehrere dieser Frames, die eine Einheit bilden (z. B. eine Geschichte), ergeben ein Script. Frames stellen das universelle Repräsentationssystem von Kognition im menschlichen Geist dar; sie sind das Format der Repräsentation von Wissen. Mit ihnen kann die Struktur von Konzepten und Kategorien dargestellt, Handlungen, Ereignisse und Meinungen erfasst werden. Der Unterschied zu Kategorisierung und Merkmallisten ist der, dass es sich bei Frames um Repräsentation von Wissen als dynamische, relationale Strukturen mit flexibler und kontextabhängiger Form handelt.
Diese globalen Muster sind für die Textproduktion und –rezeption relevant, besonders bei Fragen, wie ein Topik entwickelt werden kann, eine Ereignisfolge abläuft (in Schemata), wie Figuren in narrativen Texten ihre Ziele verfolgen (mittels geeigneter Pläne) und wie im Alltag bestimmte Texte (durch die Aktivierung von Scripts) im richtigen Augenblick dargeboten werden können (vgl.: Beaugrande/Dressler 1981: 96).
1.6. Die Welt im Kopf
Wenn man in ein Buch vertieft ist, merkt man gar nicht, dass man liest. Es kommt vor, „dass man das Buch vergisst – als würden die Buchstaben, die Wörter, die Seiten verschwinden. Was bleibt, sind die Szenen im Kopf, die die Sätze hervorrufen. Die Wörter verwandeln sich automatisch in etwas anderes, in Bilder, Vorstellungen, Gefühle (vgl.: Kast 2003: 16).
„In Wahrheit gibt es zwei Welten: auf der einen Seite die Realität, die physikalische Welt ‚da draußen’, und auf der anderen Seite die Welt im Kopf, die ‚Wirklichkeit, die wir erleben. Die Wirklichkeit ist eine Rekonstruktion der Realität, eine Simulation. Wozu wir Zugang haben, ist immer nur die Rekonstruktion der Realität im Kopf, niemals die Realität selbst.“ (Kast 2003: 15)
Zu dieser Theorie muss man sagen, dass sie entweder eine etwas schematische Darstellung ist, die einige wichtige Details verschweigt oder aber von einem dualistischen Konzept ausgeht: hier das wahrnehmende Subjekt, dort die Welt der wahrzunehmenden Objekte. Ich persönlich befürworte eher ein Wirklichkeitsmodell, das versucht, diesen Dualismus zu überwinden und sich auf die Interaktionen des Wahrnehmenden und des Wahrzunehmenden konzentriert, wie es etwa Siegfried J. Schmidt vorschlägt (vgl.: Schmidt 2003).
1.7. Wahrheit
„Das Hirn opfert die ‚Wahrheit’ zu Gunsten einer stabilen Wahrnehmung der Welt.“ (Kast 2003: 27)
Diese Tatsache ist entwicklungsgeschichtlich verständlich.
„Es ging nicht um Erkenntnis, sondern um Erkennen. Philosophische Brillanz ist kein Gütekriterium der Evolution. Und diese Evolution ist es, die unser Hirn im Laufe von Jahrmillionen hervorgebracht hat. Was sich dabei durchboxte, waren nicht Gehirne, die sich für das ‚Ding an sich’ interessierten, sondern solche, die Modelle der Welt schufen, Hypothesen, mit denen sich der Besitzer erfolgreich durchbeißen konnte, die ihm das Überleben sicherten. Und was Immanuel Kant einmal von diesen Hypothesen halten würde, das war der Evolution vollkommen egal. … Die Welt im Kopf hat sich im Laufe der Evolution […] perfekt an die Realität des draußen angepasst.“ (Kast 2003: 28)
Man kann auch die Sinne umgehen und das Hirn direkt reizen. „Für das Erleben von Wirklichkeit, […] braucht man keine Sinne und keine Außenwelt.
Man braucht nur Hirnaktivität.“ (Kast 2003: 33) Versuche von Penfield, der Hirne mittels Elektroden reizte, haben dies bewiesen.
Für die Art der Wahrnehmung ist nur der Ort der Reizung im Gehirn verantwortlich, nicht der Reiz selbst. Synästhetiker zum Beispiel können Farben nicht nur sehen, sondern auch schmecken, Wörter nicht nur hören, sondern auch sehen, wie etwa der russische Schriftsteller Vladimir Nabokov. Bei Hirnscans kann man sehen, dass bei Synästhetikern tatsächlich auch Regionen des Kortex aufleuchten, die normalerweise bei anderen Sinnesreizungen aktiviert werden, sozusagen eine Fehlverdrahtung im Kopf oder ein Überbleibsel aus unserer frühesten Kindheit, wo noch bei allen Menschen die Wahrnehmungen durcheinander gehen. Doch wer sieht eigentlich die Welt richtig? Die einzige richtige Wahrheit gibt es nicht (vgl.: Kast 2003: 26-27)
Eines der größten ungelösten Rätsel der Hirnforschung ist das Bindungsproblem. Seit Jahrzehnten sucht man vergebens nach dem Ort im Hirn, an dem alle visuellen Informationen zusammenfließen, nach dem Ort also, wo das Bild, das wir dann tatsächlich sehen, im Kopf entsteht. Christopher von der Marlsburg hatte eine Idee: Wenn es nicht der Raum ist, der die verschiedenen visuellen Eindrücke aneinanderbindet, könnte es doch vielleicht die Zeit sein. Dann wäre also der Zeitpunkt der Reizung die Lösung für das sogenannte Bindungsproblem (vgl.: Kast 2003: 54-57).
„Wir sehen nur das, was wir schon kennen.“ Das heißt, dass wir nur das sehen, „wofür wir Hirnstrukturen haben“ (Kast 2003: 63). Diese Tatsache ist wahrscheinlich der Grund für die Annahme gewesen, dass der Mensch als „tabula rasa“ geboren wird. Dem ist aber nicht so. Wenn Babys zur Welt kommen, haben sie noch sehr viele lose Verbindungen zwischen den Neuronen. Dann beginnt eine Auslese und danach bleiben nur mehr die Zellverbindungen über, die von der Umwelt stimuliert werden. Entwicklung heißt auch, Fähigkeiten zu verlieren. Anfangs ist praktisch jede Zelle mit jeder Zelle lose verknüpft, im Laufe des Lebens werden jedoch gewisse Verbindungen gestärkt, andere geschwächt. Wenn zwei Zellen gleichzeitig aktiv sind, wird ihre Verbindung gestärkt. Das ist z.B. die Grundlage des Lernens. Pawlow hatte das vor rund 100 Jahren bereits entdeckt. Man spricht von der klassischen Konditionierung. Hebbs sagte: „What fires together, wires together.“ Aber auch seine Lernfähigkeit beschränkt das Hirn für eine stabile Wahrnehmung der Welt (vgl.: Kast 2003: 64-76). Dieses Streben nach Stabilität ist auch bei Literaturprozessen beobachtbar.
Am Beispiel des Sehens zeigt sich ein wichtiges Prinzip von Geist und Gehirn: Wir sehen ein holistisches Bild, obwohl dieses einheitlich erscheinende Bild in verschiedenen Hirnteilen entsteht, wobei sich jeder dieser Hirnteile nur auf einen Teilaspekt, wie etwa Farben, Formen, horizontale oder vertikale Linien, etc. konzentriert.
„Dieses Baukastensystem trifft auf unser ganzes Ich zu. Wir erleben subjektiv oft eine Einheit, wo es objektiv keine Einheit zu geben scheint.“ (Kast 2003: 77)
Diese Fähigkeit unseres Gehirns ist auch bei der Reproduktion narrativer Texte zu beobachten. Es handelt sich dabei um ein Phänomen, das ich im 2. Teil meiner Arbeit im Kapitel über den gestaltpsychologischen Ansatz näher ausführen werde.
1.8. Emotionen und Gefühle
Das limbische System im Stirnhirn eröffnet uns die Welt der Emotionen. Im Alltag sind wir auf unsere Gefühle angewiesen. Man möchte meinen, dass man ohne Emotionen nur rationale Entscheidungen treffen könnte. In Wahrheit kann man sich jedoch ohne ihre Beteiligung überhaupt nicht entscheiden, da sich eine Alternative wie die andere anfühlt, nämlich gar nicht.
Ein Sprichwort, welches auf einen Ausspruch des französischen Philosophen Blaise Pascal (1623-1662) zurückgeht, lautet: „Le coeur a ses raisons que la raison ne connait point.“
Die Philosophie hat „ungeachtet David Humes (1711 – 1776) und der von ihm begründeten Tradition, der Emotion nicht vertraut“. Als Stiefkind sowohl der Geistes- als auch der Naturwissenschaften wurden die Emotionen in den Bereich des Tierisch-Fleischlichen verbannt. Ende des 19. Jhdts. befassten sich Charles Darwin, William James und Sigmund Freud ausführlich mit den verschiedenen Aspekten der Emotionen, während Neuro- und Kognitionswissenschaften während des gesamten 20. Jhdts. bis in die allerjüngste Vergangenheit die Emotionen ebenfalls unberücksichtigt l ießen. Darwin hielt sie für Überbleibsel früherer Evolutionsstadien, aber Hughlings Jackson, einer seiner Zeitgenossen, machte erste Schritte in Richtung einer Neuroanatomie der Emotionen (vgl.: Damasio 2002: 52-57).
Emotionen werden verdeckt hervorgerufen und nach außen gewendet. Die drei Verarbeitungsstadien nach Damasio sind: unbewusster emotionaler Zustand, Gefühlszustand, der nicht bewusst repräsentiert werden kann und ein bewusst gemachter Gefühlszustand. Es muss also Bewusstsein vorhanden sein, „wenn Gefühle das Subjekt über das unmittelbare Hier und Jetzt hinaus beeinflussen“. (Damasio 2002: 51)
Die Gehirnregionen, die einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, heißen Amygdala, subcorticale (= unterhalb der Großhirnrinde) Strukturen des Hirnstamms, des Hypothalamus und basalen Vorderhirns. PET-Scans (= bildgebende Methoden der Untersuchung) haben gezeigt, dass unterschiedliche Emotionen unterschiedlichen Gehirnregionen zuzuordnen sind (vgl.: Damasio 2002: 78-80).
Gefühle sind maßgeblich an Denk- und Entscheidungsprozessen beteiligt. Sie gehören zur „Logik des Überlebens“ und leisten einen wesentlichen Beitrag, speziell dann, wenn es um persönliche und soziale Problembewältigungen geht, um Risken und Konflikte, wie Studien an Patienten zeigten, die Schädigungen bestimmter Hirnregionen aufwiesen, wodurch sie bestimmte Kategorien von Emotionen eingebüßt hatten.
„… Emotionen aller Schattierungen [können] dazu beitragen, homoöstatische Regulation und Überlebenswerte mit zahlreichen Ereignissen und Objekten in unserer autobiografischen Erfahrung zu verknüpfen.“ (Damasion 2002: 72)
Emotionen sind mit der Idee von Belohnung und Bestrafung, mit Lust oder Schmerz, persönlichem Vor- oder Nachteil, auch mit der Idee von Gut und Böse verbunden, und sie sind daher für Literaturprozesse ebenso relevant wie für das Überleben des Organismus.
„Die reinigende (kathartische) Wirkung, die nach Aristoteles jeder guten Tragödie innewohnt, beruht auf der plötzlichen Aufhebung eines ständig genährten Zustands von Furcht und Elend.“ (Damasio 2002: 78)
1.9. Spiegelzellen – der Schlüssel zur Literatur
Wie schon bei Aristoteles und generell dem antiken Begriffsgebrauch umfasst die Nachahmung nicht nur die Nachahmung auf der Bühne oder in einer Erzählung, noch die spätere Einengung auf das Stilistische. Die Imitation ist ein Phänomen, das sich auch in unserem alltäglichen Tun als notwendig erweist.
Vittorio Gallese hat 1991 als Gefängnisarzt in Parma, Italien, die erste Spiegelzelle entdeckt. Diese Zellen haben die Fähigkeit unser Gegenüber zu spiegeln, nachzuahmen, und könnten der Schlüssel zu dem Phänomen Mitgefühl sein.
„… Mitgefühl, …, es ist körperlich, wir können es sehen, wir können es hören, mit unseren Elektroden können wir es messen.“, sagt Christian Keyser vom Hirnlabor in Parma. Spiegelzellen gibt es für alles. In unserem Gehirn gibt es ein regelrechtes „Spiegelsystem“. Jedes Mal, wenn wir etwas sehen oder auch nur hören, wird unser Hirn so aktiviert, als würden wir die wahrgenommene Handlung selbst ausführen; es spiegelt auf diese Weise unser Gegenüber. Wir nehmen unsere Mitmenschen nicht nur wahr, sondern wir simulieren sie. In diesem ‚neuronalen’ Nachvollziehen’ des anderen liege, so Keyser, der Ursprung des Mitgefühls.
Ein Riegel im Hirn, eine Hemmung verhindert jedoch im letzten Moment, dass wir die Imitation ausführen, dass die Spiegelzellen unsere Muskel tatsächlich in Bewegung setzen. Das Fehlen dieser Hemmung nennt man „Echopraxie“.
Bei Wörtern, die starke Emotionen auslösen, dauert in der Regel die Verarbeitung im Gehirn länger als bei neutralen Wörtern, bei gefühlskalten Verbrechern jedoch gleich lang. Dieser Verbrechertypus ist also für die emotionale Ebene dieser Begriffe, wie etwa „töten“, „verstümmeln“, etc. blind, wie auch für das Leid anderer Menschen (vgl.: Kast 2003: 131-140).
Der Ort im Hirn, wo Spiegelzellen am häufigsten auftreten, ist im vorderen Bereich der linken Hirnhälfte, im Broca-Areal. Wir sprechen mit der linken Hirnhälfte, mit dem Broca-Areal. Kann das ein Zufall sein, dass es gerade dort nur so von Spiegelzellen wimmelt? Die Spiegelzellen könnten also eine wichtige Rolle bei der Sprachentwicklung spielen. Auch Affen haben Spiegelzellen. Sprache baut auf den Strukturen auf, die bereits im Affenhirn vorhanden sind. Das Broca-Areal ist ein motorisches Areal.
„Sprache ist […] die geistige Fortsetzung von etwas, was bereits jeder Affe beherrschte, bevor er anfing zu sprechen, nämlich, sich zu bewegen und Bewegungen wahrzunehmen.“ (Kast 2003: 143-144) Bewegungen bestehen aus motorischen Einheiten, die für bestimmte Handlungen in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden müssen. Unsere Bewegungen haben also eine verborgene Grammatik, auf der unsere Sprache vielleicht aufbaut. Auch beim Affen steuert das Broca-Areal komplexe Armbewegungen. Es wurde also schon früh zum Kommunikationsareal (vgl.: Kast 2003: 145-146).
Manche Spiegelzellen können schon beim Affen nicht nur handeln und sehen, sondern sie können auch hören. Tests haben ergeben, dass beim Affen nicht nur dann die Spiegelzellen aktiviert werden, wenn er sieht, wie jemand eine Nuss knackt, sondern auch dann, wenn er nur das dafür typische Geräusch hört. Das ist der Schlüssel zur Sprache. Man muss nur beim Knacken einen Laut von sich geben, z. B. das Wort „Knacken“ sprechen und schon verbinden sich im Kopf des Zuhörers die Spiegelzellen fürs Nussknacken mit den Neuronen, die das Wort „Knacken“ übernehmen. Das abstrakte Wort „Knacken“ hat dadurch einen Sinn bekommen.
„Über die Spiegelzellen werden Wörter mit Bedeutung bestückt. Nicht nur die Grammatik, auch die Semantik – die Bedeutung von Wörtern – könnte also eng mit der Motorik zusammenhängen.“ (Kast 2003: 148)
Auch Verben könnten wir mit Hilfe der Spiegelzellen bilden, denn diese Zellen feuern unabhängig davon, wer der Urheber einer Handlung ist, aber sie kodieren nicht nur „Ich knacke“, sondern auch „Er knackt“, verbunden mit dem Laut „Knacken“ ergibt es also ein Verb.
Wie bereits erwähnt sind die Spiegelzellen die Grundlage für unser Mitgefühl, das ja bei der Rezeption von narrativen Texten bekanntlich eine große Rolle spielt. Mit der Entdeckung der Spiegelzellen bekommt Mitgefühl einen körperlichen Charakter. Experimente mit Hirnscannern haben gezeigt, dass sogar unsere Vorstellungskraft körperlicher ist, als wir vielleicht denken mögen. Bei der Vorstellung von Bewegungen werden dieselben Hirnareale aktiviert wie bei der Planung von tatsächlichen Bewegungen (Vgl.: Kast 2003: 147-149).
Unser Wohlgefallen an nachgeahmten Handlungen könnte schließlich sogar der Grund sein, warum die Menschheit Literatur, d.h. Nachahmungsgeschichten, die unseren Nachahmungstrieb befriedigen, hat.
Die Spiegelneuronen erklären, warum wir dies brauchen und unter welchen Bedingungen Literatur diese Funktion erfüllt.
1.10. Das Bewusstsein
Das menschliche Bewusstsein hat die Evolution beeinflusst und Moral, Religion, Kunst und Wissenschaft hervorgebracht. Kummer und Freude zu fühlen, Leid und Lust, aber auch die Begierde und das Mitleid sind Nebenprodukte dieses unseres Bewusstseins. Ohne das Bewusstsein, könnten wir niemals Kenntnis von unseren persönlichen Zuständen erlangen.
„Bewusstsein ist in der Tat der Schlüssel zum besichtigten Leben – ob wir es wollen oder nicht -, unsere Lizenz, alles in Erfahrung zu bringen, was in uns vorgeht – den Hunger und den Durst, die Sexualität, die Tränen, das Lachen, die Hochs und Tiefs, den Strom der Vorstellung, den wir Denken nennen, die Gefühle, die Wörter, die Geschichten, die Überzeugungen, die Musik und die Poesie, das Glück und den Überschwang.“ (Damasio 2002: 15-16)
Damasio bezeichnet mit dem Wort „Vorstellung“ immer ein „mentales Muster“ oder ein „mentales Ereignis“. Im Gegensatz dazu sind „neuronale Muster“ die neuronalen Aspekte und Vorgänge im Gehirn, die sich mit neurowissenschaftlichen Methoden nachweisen lassen. Eine Vorstellung erzeugen wir, wenn wir uns mit Objekten, z. B. auch einer Geschichte befassen oder wenn wir sie aus dem Gedächtnis rekonstruieren. Wenn man gedruckte Geschichten liest, dann verarbeitet man sie zunächst einmal als sprachliche Vorstellung, dann werden andere nichtsprachliche Vorstellungen aktiviert und dadurch werden die der Geschichte entsprechenden Konzepte mental abgespeichert. Auch die dabei auftretenden Gefühle sind Vorstellungen, die Aspekte des Körperzustandes signalisieren. Noch weiß man allerdings nicht, wie ein neuronales Muster zu einer Vorstellung wird. (vgl.: Damasio 2002: 381-389).
Doch was geschieht im Gehirn, wenn wir erkennen, dass wir Emotionen oder Schmerzen fühlen? Irgendeine Form von Selbst-Sinn ist dazu erforderlich, um den Organismus über die Empfindung in Kenntnis zu setzen. Damasio nennt drei biologische Auswirkungen der drei verwandten Phänomene: „eine Emotion, das Fühlen einer Emotion und das Erkennen des Gefühls dieser Emotion“ (Damasio 2002: 19).
Ist das Bewusstsein die entscheidende Grundlage unseres Handelns oder nur ein besonderer Zustand der Informationsverarbeitung? Vorgeburtliche und genetisch bedingte Charakterzüge machen etwa die Hälfte der Persönlichkeit eines Menschen aus. Weiters werden wir durch Vorgänge kurz nach der Geburt und in den ersten drei bis fünf Lebensjahren geprägt. Ist das Ich nun der Steuermann oder nicht? Die Bedeutung frühkindlicher Erfahrungen und die Neigung des bewussten Ich zu Pseudoerklärungen erinnern an die Freud’sche Psychoanalyse. Erklärungen über unser eigenes Verhalten sind eigentlich immer ein Raten, da die Motive für unser Verhalten dem Unbewussten entspringen, meinte Freud. Versuche mit Split-Brain-Patienten, bei denen die beiden Hirnhälften chirurgisch getrennt worden waren, bestätigten dies. Das Über-Ich ist der Richter im Kopf, die Moral. Der Sitz des Über-Ich ist im Stirnhirn (vgl.: Kast 2003: 86-106).
Aufgrund unseres Bewusstseins verspüren wir den Drang am Leben zu bleiben und unser Interesse an uns selbst, wie auch am Selbst der anderen, zu entwickeln (vgl.: Damasio 2002: 15-16). Und damit wären wir bereits wieder mitten drinnen in der Beschäftigung mit Literatur, der Beschäftigung mit Geschichten über andere Menschen und fiktive Gestalten.
Die Hirnforschung kann zwar über die Ursachen menschlichen Handelns Auskunft geben, nicht aber über die Gründe. Über diese weiß man tatsächlich wenig, denn noch ist es nicht möglich, Hirnaktivitäten detailliert spezifischen Inhalten zuzuordnen. Man kann zwar Aktivitäten, die beim Denken auftreten, sichtbar machen, aber bisher kann man semantische Inhalte nicht erfassen bzw. neuronalen Vorgängen zuordnen (vgl.: Käuflein 2006: 11-27).
Wenn ich zum Beispiel, einen Text lese, konstruiere ich bereits die Bedeutung der Worte während des Lesens. Dabei wird auch das begriffliche Wissen zum Verständnis des Textes verfügbar gemacht. Gleichzeitig ist mir aber bewusst, dass ich es bin, die den Text liest. Ich bin also die Beobachterin der vorgestellten Dinge. Es gibt eine Präsenz meiner selbst in Beziehung zu dem Objekt, also dem Text und den vorgestellten Dingen. Diese Präsenz ist aber auch eine Vorstellung; sie ist das Fühlen dessen, was geschieht, wenn mein Sein durch den Akt der Wahrnehmung verändert wird. Während ich lese und mich selbst fühle, ist mein privates Wissen von einer bestimmten Perspektive geprägt. Das Bewusstsein ist also das mentale Muster, „durch welches das Objekt und das Selbst zusammengeführt werden“ (Damasio 2002: 23). Bewusstsein ist zwar ein privates Phänomen, aber es ist – wie auch der Geist – an äußere Verhaltensweisen gebunden, die sich aus der Perspektive einer dritten Person beobachten lassen.
Untersuchungen an Patienten mit eingeschränktem Bewusstsein haben ergeben, dass bei ihnen auch die Emotionen beeinträchtigt sind. Beim Menschen lassen sich einfachere und komplexere Formen des Bewusstseins unterscheiden: das Kernbewusstsein, dessen Zuständigkeitsbereich das Hier und Jetzt ist und das erweiterte Bewusstsein, das für einen höheren Selbst- Sinn, Identität, Vergangenheit und Zukunft verantwortlich ist. Erst mit dem erweiterten Bewusstsein ist Kreativität möglich.
Gehen wir nochmals an den Ausgangspunkt dieses Beispiels zurück. Ich lese einen Text. Bewusstsein ist nun die Konsequenz der Beziehungen der beiden Hauptakteure, nämlich dem Organismus (= mir selbst) und dem Objekt (= dem Text). Die Beziehungen zwischen dem Organismus und dem Objekt sind „die Inhalte des Wissens“ (Damasio 2002: 33). Der Selbst-Sinn im Erkennen eines Objekts ist „die Einflößung neuen Wissens“ (Damasio 2002: 40). Bewusstsein entsteht, wenn Repräsentationen von Objekten eine Art wortloser Erkenntnis hervorrufen. Dennoch wird die Struktur des Objekts nicht in der Repräsentation reproduziert. Wir haben keine Ahnung, wie genau neuronale Muster und unsere Vorstellungen die Objekte tatsächlich wiedergeben. Die neuronalen Muster hängen von der momentanen Auswahl von Neuronen und Schaltkreisen im Gehirn ab, die von der Interaktion zwischen dem Organismus und einem Objekt angesprochen werden. Das Gehirn ist also somit ein ein kreatives System. (Vgl.: Damasio 2002: 384-387).
„So gesehen, besteht Bewusstsein aus der Konstruktion von Wissen über zwei Fakten: dass der Organismus damit beschäftigt ist, eine Beziehung zu einem Objekt zu knüpfen und dass das Objekt in der Beziehung eine Veränderung im Organismus hervorruft.“ (Damasio 2002: 33)
Alle diese Vorgänge sind im Gehirn in Form neuronaler Muster abgebildet und können beobachtet und untersucht werden. Bei der Rezeption und Verarbeitung einer Geschichte, werden also auch die Erinnerungen an unsere eigene Wahrnehmungstätigkeit und die begleitenden emotionalen Reaktionen in unserem Gehirn mitabgespeichert. Wir hören oder lesen einen Text. Die Wörter und Sätze sind die Übersetzung der Konzepte des Autors, die ursprünglich in seinem Geist waren. Parallel zur Wahrnehmung der Worte und der Aufrufung unseres gespeicherten Wissens, repräsentiert unser Geist aber auch uns selbst. Die Vorstellungen, das Erkennen, unser Selbst-Sinn beanspruchen keine zentrale Rolle in unserem Geist. Und doch fehlte der Selbst-Sinn im Zuge des Erkennens, wäre es so, als erhöbe niemand Anspruch auf die Gedanken, die da gerade erzeugt würden, da es keinen rechtmäßigen Besitzer gebe (vgl.: Damasio 2002: 157-160). In unserem Gedächtnis haben wir aber nicht nur die Geschichte selbst gespeichert, sondern auch die motorischen Anpassungen, die wir vorgenommen haben, um die Wahrnehmung zu gewährleisten und die emotionalen Reaktionen, die wir beim Lesen oder Zuhören hatten. Wenn wir also an die Geschichte denken oder sie reproduzieren, dann rekonstruieren wir nicht nur die Geschichte selbst, sondern eben auch die Wahrnehmungstätigkeit, die die Geschichte verlangt hat.
„Die Perspektive, von der aus Sie eine Melodie hören oder ein Objekt berühren, ist ganz selbstverständlich die Perspektive Ihres Organismus, weil sie von den Veränderungen abhängt, denen sich Ihr Organismus beim Hören oder Berühren unterzieht.“ (Damasio 2002: 181)
Das Bewusstsein ist sozusagen ein Apparat, der in der Lage ist, Vorstellungen im Interesse eines bestimmten Organismus zu manipulieren. Das Bewusstsein macht es möglich, die innere Sphäre der Lebensregulation mit der Verarbeitung von Vorstellungen, die Dinge und Ereignisse innerhalb und außerhalb des Organismus repräsentieren, zu verbinden (vgl.: Damasio 2002: 38).
„Die frühesten Ursprünge des Selbst, einschließlich des höheren Selbst, das Identität und Personalität umfasst, sind in der Gesamtheit jener Hirnmechanismen zu finden, die fortwährend und unbewusst dafür sorgen, dass sich die Körperzustände in jenem schmalen Bereich relativer Stabilität bewegen, der zum Überleben erforderlich ist.“ (Damasio 2002: 36)
Da es verschiedene Bewusstseinsstufen gibt, nennt Damasio die unterste Stufe, die noch ohne Sprache auskommt, das Kernbewusstsein. Dieses stützt sich auch nicht auf ein umfassendes Gedächtnis, sondern braucht nur ein begrenztes Kurzzeitgedächtnis. Erst das erweiterte Bewusstsein erfordert Zugang zu einem umfangreichen autobiografischen Gedächtnis. Doch das Kernbewusstsein wirkt sich auf alle anderen kognitiven Vorgänge aus. Obwohl es ohne Sprache auskommt, ist es unentbehrlich für die normalen Sprachfunktionen und begünstigt die Bildung von Erinnerungen (vgl.: Damasio 2002: 139-153). Neurowissenschafter haben sich mit der Frage befasst, wie Objekte im Gehirn sensorisch und motorisch verarbeitet werden, in welchen neuronalen Mustern Objekte in den Cortices abgebildet werden, wie das Wissen über ein Objekt gespeichert wird, nach konzeptuellen und linguistischen Kategorien und wie es auch wiedererkannt oder wiedergegeben werden kann. Dabei hat man festgestellt, dass eine relative Stabilität auf allen Ebenen der Informationsverarbeitung erforderlich ist. Diese Stabilität und Kontinuität ist auch auf der Ebene komplizierter Ideen anzutreffen (vgl.: Damasio 2002: 163-165).
[...]
1 http://www.gehirn-atlas.de/gehirn/broca_wernicke.jpg
- Arbeit zitieren
- Daria Hagemeister (Autor:in), 2010, Kognitive Ordnungsbildung bei Literaturprozessen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154534
Kostenlos Autor werden








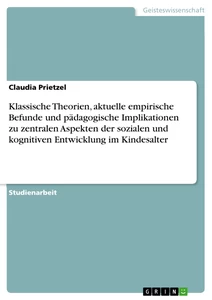






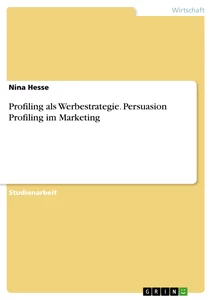




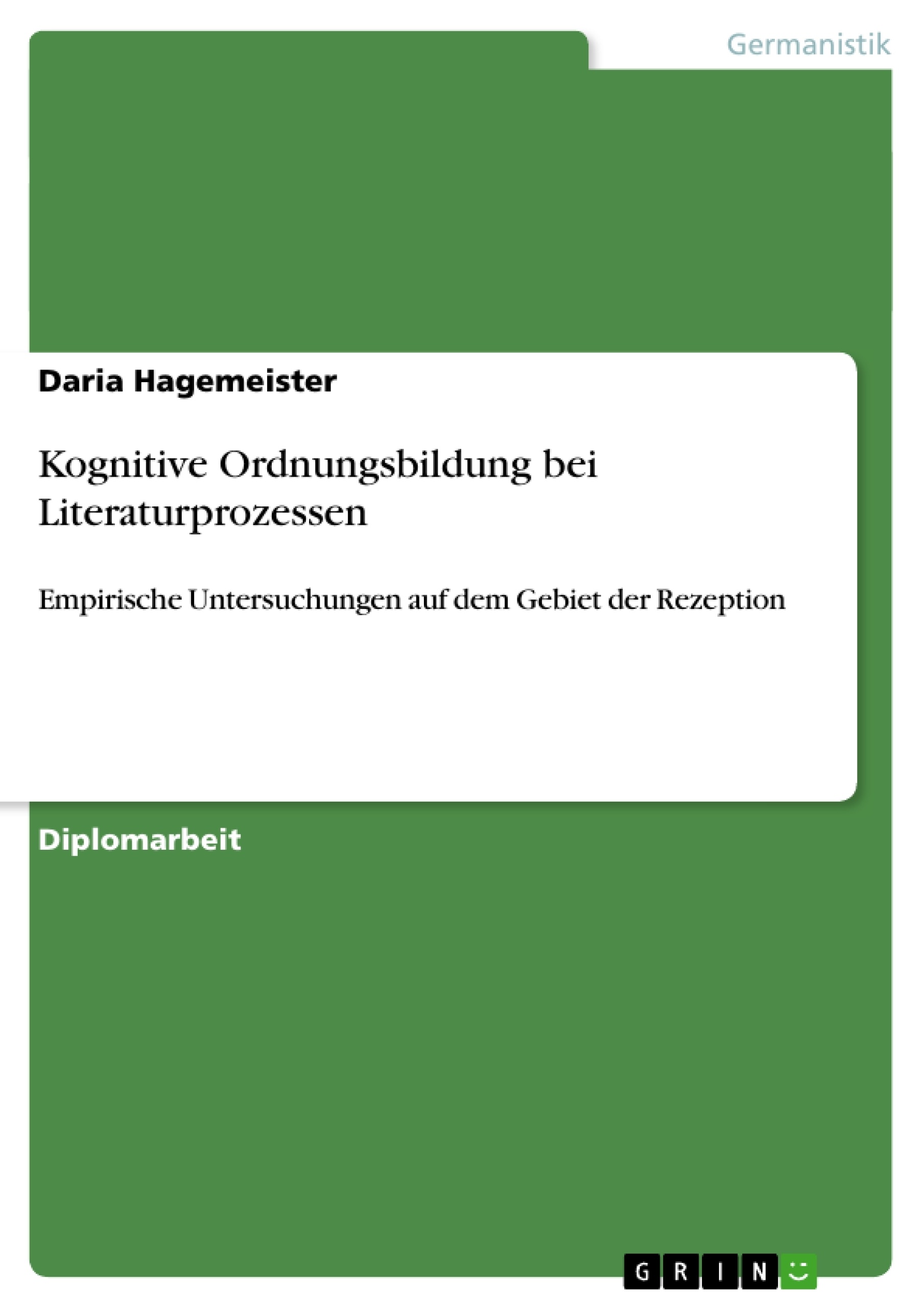

Kommentare