Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
TEIL 1
1. Biographischer Hintergrund zu Max Frisch
2. Max Frisch und Literatur
3. Max Frisch und Philosophie:
4. Allgemeine Bemerkungen zur Existenzphilosophie
5. Einzelne existenzphilosophische Positionen
5.1 Sören Kierkegaard
5.2 Martin Heidegger
5.3 Jean-Paul Sartre
5.4 Albert Camus
TEIL 2
1. Identität und Selbstverwirklichung
2. Zentrale Aspekte der Identitätsentwicklung
2.1 Freiheit
2.2 Tod
2.3 Bezug zur Zeit
2.4 Selbstverhältnis
2.5 Wiederholung
2.6 Der religiöse Bereich
2.7 Schuld
2.8 Angst und Verzweiflung
2.9 Bezug zur Welt
2.10 Der künstlerische Bereich
2.11 Der zwischenmenschliche Bereich
2.11.1 Bildnisproblematik
2.11.2 Entfremdete Beziehungen
2.11.3 Stillers Freundschaften
2.11.4 Stillers familiäre Beziehungen
2.11.5 Beziehungen zwischen Mann und Frau
2.11.5.1 Rolf und Sibylle
2.11.5.2 Stiller und Sibylle
2.11.5.3 Stiller und Julika
3. Stillers Existenzwerdung
3.1 Überblick über Stillers Entwicklung
3.2 Die Höhlengeschichte
4. Korrespondenz von Form und Inhalt
Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Einleitung
„[…] ich komme nämlich nicht von der Literatur, sondern von der Eigenerfahrung her und würde, wenn man das Wort nicht mißbrauchen will, mich zur Gattung der Notwehrschriftsteller rechnen. Das heißt, ich schreibe, um zu bestehen; ich schreibe, um mir klar zu werden; ich schreibe, um mich auszudrücken […] der zentrale Impuls ist der ganz simple, einfache, naive: der Spieltrieb, und die Notwehr: also die Gespenster zu bannen an der Wand.“[1]
Max Frisch (1911–1991) – sicherlich einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts – hat Zeit seines Lebens sowohl persönliches als auch gesellschaftliches Engagement gezeigt. Während in seinem literarischen Werk zumeist das Individuum mit seinen subjektiven Problemen im Vordergrund steht, hat er sich gleichzeitig kritisch mit den je aktuellen gesellschaftlichen Themen beschäftigt und Stellung bezogen, ohne sich von einer der gerade modernen Ideologien vereinnahmen zu lassen. Bezüglich seines literarischen Werkes lässt sich – wie das vorangestellte Zitat bestätigt – die Betonung der subjektiven Komponente feststellen.
Für den Menschen Max Frisch bedeuteten die Jahre 1954/55 einen radikalen Umbruch. Die Veröffentlichung des Romans „Stiller“ (1954) verhalf ihm zum literarischen Durchbruch und ließ ihn in Kürze zu einem renommierten Autor seiner Zeit werden, was ihm ermöglichte, die Literatur zum Hauptberuf zu machen – aus dem „Freizeitschriftsteller“ wurde der „freie Schriftsteller“ Max Frisch. Den Ausstieg aus dem bürgerlichen Leben vollzog er indes nicht nur auf beruflicher Ebene mit der Aufgabe seines Architekturbüros, sondern darüber hinaus durch die Trennung von seiner Familie.
Der Roman „Stiller“ gibt ein deutliches Beispiel von der bei Frisch charakteristischen Verschränkung von sozialer und individueller Dimension, denn der persönliche Konflikt des Protagonisten intensiviert sich in der Konfrontation mit seiner Umwelt. Dabei umfasst das Werk inhaltlich eine ganze Bandbreite von Themen, die bis heute nicht an Aktualität eingebüßt haben. Es geht um die Suche des Einzelnen nach seiner wahren Identität, sein Verhältnis zur mitmenschlichen Umwelt und speziell dem Ehepartner, des Weiteren wird die Position des Künstlers in Frage gestellt, die Stellung des Individuums in Opposition zur Gesellschaft problematisiert und in Ansätzen spezielle Gesellschaftskritik an der Schweiz geübt.[2]
Dabei entfalten sich die zentralen Motive in einer äußerlich vermeintlich einfachen Geschichte: Der aus Amerika eingereiste Mr. White wird an der Schweizer Grenze aufgrund des Verdachtes, der verschollene und in einen Spionagefall verwickelte Bildhauer Anatol Stiller zu sein, verhaftet. Bereits mit dem ersten Satz des Romans „ Ich bin nicht Stiller “[3] versucht der Protagonist, die ihm aufgedrängte Identität zu verleugnen und gibt in sieben Heften, die er während des Gefängnisaufenthaltes zur Aufdeckung der Wahrheit schreiben soll, einerseits Aufschluss über seine Person und andererseits als distanzierter Protokollant eine Darstellung der Vergangenheit des Gesuchten aus den Perspektiven dreier relevanter Personen – seiner Ehefrau Julika, seiner Geliebten Sibylle sowie deren Mann und Whites gegenwärtigen Staatsanwalt Rolf, wobei sich allmählich die Gleichheit von Stiller und White offenbart. Aus dieser mehrschichtigen Darlegung von Stillers Vergangenheit und Whites eigener Gedanken, Reflektionen, Träume, Erinnerungen und Geschichten über seine Zeit in Amerika sowie der Beschreibung seines Lebens in der Haft ergibt sich ein komplexes Bild, das die eigentliche Problematik – die Hoffnung auf Selbstverwirklichung – reflektiert. Whites Bericht endet mit der gerichtlichen Verurteilung, Stiller zu sein und wird durch das Nachwort des Staatsanwaltes und Freundes ergänzt, welches Auskunft über Stillers Leben nach der Haftentlassung sowie die Beurteilung seiner Entwicklung seitens Rolf beinhaltet.
Hinter dem scheinbar einfachen Kriminalfall – eine bloße Fassade, der Verdacht der Spionage erweist sich überdies als falsch – steckt ein tieferer Sinn, der sich in der Identitätssuche des Individuums nach seinem wahren Ich enthüllt. Mit dem Wissen, dass White und Stiller identisch sind, wird offensichtlich, dass der Protagonist nicht eine physische Verleugnung, sondern die Leugnung der eigenen Vergangenheit als Teil seiner Persönlichkeit zu erzielen versucht.
Definiert man die Identitätsproblematik und den damit verbundenen Versuch der Selbstverwirklichung als Hauptthema des Romans[4], so ist eine deutliche Nähe zur Existenzphilosophie, die die je individuelle Existenz des Menschen und dessen Möglichkeiten zur Verwirklichung derselben fokussiert, zu erkennen.
Thema dieser Magisterarbeit ist die auf der Ähnlichkeit der Themen und Problemkreise basierende Untersuchung des Romans „Stiller“ hinsichtlich seiner existenzphilosophischen Aspekte. Aufgrund der Vielzahl möglicher Auslegungen, die die Offenheit des Romans zulässt, darf die hier unternommene existenzphilosophische Analyse nur als ein möglicher Deutungsversuch, der weder Anspruch auf Vollständigkeit noch Angemessenheit bezüglich der Autorintention erhebt, angesehen werden. Mein wesentliches Anliegen besteht in der Präsentation der Parallelen und Gegensätze der im Roman enthaltenen Gedanken und den Aussagen der Existenzphilosophie.
Frischs eigene Äußerung
„Es klingt anekdotisch, aber es ist so gewesen, daß ich bei der Niederschrift von ‘Stiller’ das Wort ‘Identität’ nie gedacht habe, zum Glück. Das heißt, ich bin ausgegangen von einer subjektiven Erfahrung, der Bedrängnis, die ich versucht habe darzustellen…“[5]
unterstreicht, dass die offensichtliche Korrespondenz seiner Gedankenwelt mit existenzphilosophischen Theorien nicht intendiert ist. Primär ist die Literatur des Autors Frisch von seinem eigenen Erfahrungsbereich bestimmt, so dass mir nicht die Untersuchung eines bewussten Einsatzes existenzphilosophischer Elemente, sondern vielmehr die Feststellung ihrer Existenz relevant erscheint.
Die nachfolgende Analyse gliedert sich in zwei Schritte. Der erste Teil dieser Arbeit wird einen theoretischen Hintergrund bieten, auf dessen Grundlage die explizite Interpretation des Romans bezüglich seiner inhärenten existenzphilosophischen Analogien und Divergenzen im zweiten Teil aufbaut.
Neben einem kurzen biographischen Einblick zu Max Frisch sowie der Darstellung der Aspekte Literatur und Philosophie bezüglich ihrer Relevanz und der theoretischen Überlegungen seitens des Autors steht im Zentrum des ersten Teils ein Überblick zur Existenzphilosophie, der durch Präsentation der konkreten Positionen von Sören Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre und Albert Camus ergänzt wird. Die Auswahl und Beschränkung auf diese vier Standpunkte hat sowohl inhaltliche als auch formale Gründe. Eine erweiterte Darstellung, die sicherlich weitere interessante Aspekte bringen könnte[6], würde innerhalb dieser Magisterarbeit zu weit gehen. Die Auswahl Kierkegaards erscheint aufgrund der seinem Werk „Entweder-Oder“ entnommenen und dem Roman vorangestellten Zitate nahezu unerlässlich. Auf Heidegger, der im engeren Sinn nicht als Existenzphilosoph gewertet werden darf, einzugehen, begründet sich hauptsächlich durch meine Auseinandersetzung mit der von Doris Kiernan vorgenommenen Studie.[7] Die Entscheidung, die beiden Existentialisten Sartre und Camus in die folgende Darstellung aufzunehmen, resultiert sowohl aus meinem persönlichen Interesse als auch der Ähnlichkeit ihrer Auffassungen mit denen Frischs.
Die im zweiten Teil vorgenommene existenzphilosophische Analyse zentriert sich um den sowohl in der Existenzphilosophie als auch im Roman „Stiller“ im Mittelpunkt stehenden Identitätsbegriff. Der Zugang erfolgt primär über textimmanente Interpretation im Vergleich mit den zuvor vorgestellten existenzphilosophischen Positionen, wobei ich an den von mir als notwendig erachteten Stellen zentrale Aussagen des Autors berücksichtigen werde. Zur Klärung, inwieweit die Hauptperson des Romans Stiller sowie die weiteren Figuren einen existenzphilosophischen Grad an Identität erreichen, werde ich einzelne zur Selbstwerdung relevante Aspekte näher betrachten. Den Abschluss wird eine Untersuchung der Korrespondenz von Form und Inhalt bezüglich des Romans bilden, denn laut Stephan ist der Erfolg des Werkes
„vor allem auf die ungewöhnlich enge Verknüpfung der formalen (Struktur, Erzählerposition, Funktion der interpolierten „Lügen“-Geschichten, Tagebuchtradition, Stil, Sprache) und inhaltlichen Aspekte (Bildnisproblematik, Schweiz, wissenschaftlich-technisches Zeitalter, Leben im Zitat, Existentialismus)“[8]
zurückzuführen. Insbesondere durch diesen letzten Punkt beabsichtige ich, meine zugrunde liegende Hauptthese zu bestätigen: Die offensichtliche Parallelität von „Stiller“, den Gedanken seines Autors Frisch und der Existenzphilosophie manifestiert sich in der in allen drei Fällen geforderten Offenheit, die sich – wie sich im Verlauf dieser Arbeit zeigen wird – auf alle Lebensbereiche und insbesondere auf den Bereich Literatur und Philosophie bezieht. So wie die Existenzphilosophie keine Lebensrichtlinien bietet, intendiert auch Frischs Literatur und insbesondere „Stiller“, dem Leser keine endgültige Lösung auf die werkimmanenten Probleme zu geben, sondern ihn vor Fragen zu stellen, die er sich individuell zu beantworten hat.
1. Teil
1. Biographischer Hintergrund zu Max Frisch
Um den Roman „Stiller“ und seine existenzphilosophischen Elemente zu analysieren, erscheint es mir unumgänglich, einen Einblick in die Biographie des Autors Max Frisch zu geben. Da diese Arbeit keine biographisch-orientierte Interpretation intendiert, beschränke ich mich auf eine Skizzierung seines Lebenslaufes und werde nur einige wenige für die weitere Untersuchung relevante Details näher erläutern. Dass ich die Themenkomplexe Literatur und Philosophie an dieser Stelle nur kurz ansprechen werde, begründet sich in ihrer gesonderten Betrachtung in den folgenden Kapiteln.
Am 15. Mai 1911 wurde Max Frisch in Zürich als zweiter Sohn des Architekten Franz Bruno Frisch (1871–1932) und dem früheren Kindermädchen Karolina Bettina Frisch (1875–1966), geborene Wildermuth, geboren.
Aufgrund der zeitweiligen väterlichen Arbeitslosigkeit war Frischs Leben bereits in frühen Jahren wesentlich von Geldsorgen geprägt, die dem Hauptinteresse der Eltern, ihren Kindern eine fundierte Ausbildung zu bieten, gegenüberstanden. Obwohl die jugendlichen Interessen weniger der Literatur und vorrangig dem Fußball galten, übte der erste Theaterbesuch eine derartige Faszination aus, dass Max Frisch im Alter von 16 Jahren sein erstes Theaterstück verfasste und nach dem 1930 bestandenen Abitur am Realgymnasium ein Germanistik-Studium an der Universität Zürich begann.[9]
Durch den Tod des Vaters im Jahre 1932 war er, um für seinen Lebensunterhalt sorgen zu können, zur Unterbrechung des Studiums gezwungen. Die Tätigkeit als freier Journalist bot einen Kompromiss, den notwendigen Brotberuf mit dem Wunsch nach künstlerischer Tätigkeit zu vereinbaren.[10] Um diese Problematik kreist der zu jener Zeit erschienene Erstlingsroman „Jürg Reinhart“ (1934), der die für den Menschen Frisch problematische Vereinigung von künstlerischer und bürgerlicher Existenzweise thematisiert. Frischs Sehnsucht nach gesellschaftlicher Eingliederung kollidierte mit der Sehnsucht nach künstlerischer Freiheit.
Das Stipendium eines Freundes ermöglichte ihm 1936 ein Architekturstudium an der ETH Zürich, das er 1940 erfolgreich beendete, und markierte damit – verstärkt durch den Abbruch der literarischen Tätigkeit, symbolisiert durch eine „kleine Bücherverbrennung“ im Jahr 1937 – die vorübergehende Entscheidung für ein bürgerliches Leben. Erst durch die mehrmalige Einberufung zum Militärdienst revidierte Frisch seinen Entschluss und begann 1939 mit seinem Kriegstagebuch die Fortsetzung der schriftstellerischen Arbeit. Fortan war sein Leben von einer Zweigleisigkeit geprägt: Auf der einen Seite die Literatur, auf der anderen Seite die Arbeit als Architekt – zuerst als Angestellter, ab 1942 auf selbstständiger Basis – und das bürgerliche Leben als Ehemann mit der 1942 angetrauten Gertrude Anna Constance von Meyenburg. Dabei entsprach der Architekturberuf durchaus Frischs Begeisterung für den schöpferischen Menschen und das soziale Element des Bauens.[11]
In der Zeit bis zur Veröffentlichung des „Stillers“ und dem darauf folgenden Entschluss, sein Leben auf den künstlerischen Bereich zu beschränken, entstanden die Romane „J’adore ce qui brûle oder Die Schwierigen“ (1943), die Stücke „Santa Cruz“ (1944), „Nun singen sie wieder“ (1945), „Die Chinesische Mauer“ (1946), „Als der Krieg zu Ende war“ (1949), „Graf Öderland“ (1951), und „Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie“ (1953) sowie die Erzählung „Bin oder Die Reise nach Peking“ (1945), das „Tagebuch mit Marion“ (1947), „Tagebuch 1946–1949“ (1950) und die Hörspiele „Herr Biedermann und die Brandstifter“ (1953) und „Rip van Winkle“ (1953), welches große Ähnlichkeit mit dem Roman „Stiller“ aufweist. Für Frischs weiteres Schaffen war das „Tagebuch 1946–1949“ entscheidend, da es die Grundlage vieler späterer Werke – sowohl in formaler als auch thematischer Hinsicht – bildete. Ansonsten demonstrieren die aufgezählten Werke hauptsächlich
„die Auseinandersetzung mit den existentiellen Themen der dreißiger und frühen vierziger Jahren. Themen wie der Suche nach dem Sinn des Lebens, der Konfrontation mit dem Nichts, dem Tod und dem Anspruch auf Glück“[12].
Die sich parallel verfestigte bürgerliche Existenz – was die Geburten der drei Kinder belegten – wurde anscheinend erst durch den in Folge eines Stipendiums möglichen einjährigen USA-Aufenthalt (1951–1952) von Frisch endgültig in Frage gestellt und durch die Aufgabe des Architekturberufes und die familiäre Trennung sowie die vier Jahre später erfolgende Scheidung besiegelt.
In den Werken, die in den folgenden Jahren entstanden, haben die im „Stiller“ behandelten Themenkomplexe nicht an Bedeutung verloren. Sowohl in dem Drama „Andorra“ (1961) also auch den Romanen „Homo faber“ (1957) und „Mein Name sei Gantenbein“ (1964) beschäftigte sich Frisch mit der Identitäts-, Rollen- bzw. Bildnisproblematik, wobei speziell der „Gantenbein“-Roman, wie auch das spätere Drama „Biographie. Ein Spiel“ (1967), die inhaltliche Thematik auf formaler Ebene widerzuspiegeln versucht. Darüber hinaus weist die autobiographische Erzählung „Montauk“ (1975) mit dem inhaltlichen Versuch jenseits von Wiederholungen und festgelegten Rollen ganz in der Gegenwart zu leben, eine Parallelität auf und auch die späte Erzählung „Blaubart“ (1982) knüpft mit der Selbstreflektion und dem Schuldbewusstsein des Protagonisten an „Stiller“ an.
Im privaten Bereich war das Leben von Max Frisch bereits in der Kindheit von der Angst, als Außenseiter gelten zu können, geprägt. In späteren Jahren stand seine Tendenz zu depressiven Stimmungen, die sich in Minderwertigkeitsgefühlen und Versagensängsten manifestierte, seinem äußerlich zumeist selbstbewussten Auftreten, das sich in seiner geselligen und zumeist lebenslustigen Art zeigte, gegenüber.[13] Laut Bircher lassen sich Frischs Existenzängste sowohl als Korrespondenz zu den in der Existenzphilosophie beschriebenen Ängsten als auch auf soziologischer Ebene als Folge der kleinbürgerlichen Herkunft interpretieren.[14]
Was seine Familie anging, zeichnete sich hauptsächliche Frischs mütterliche Beziehung durch eine große Nähe aus, wohingegen er selbst das Verhältnis zu seinem Vater als eine „Nicht-Beziehung“[15] bzw. „Gefühlslücke“[16] bezeichnet hat. Da trotz der subjektiven Dimension seiner Literatur und der beschriebenen fiktiven Lebensentwürfen das Thema Kindheit und Herkunft außer Acht gelassen wurde, scheint dieser Aspekt allerdings für Frisch insgesamt eher unproblematisch gewesen zu sein. Kontrastierend zu seinem Schriftstellerkollegen Kafka stellt die fehlende emotionale Vaterbindung keinen literarisch zu bewältigenden Konflikt dar.
Einen bedeutsamen literarischen Einfluss hatten im Gegensatz dazu seine Frauenbeziehungen. Zwei geschiedene Ehen und diverse Liebesbeziehungen – u.a. in den Jahren 1958–1962 mit Ingeborg Bachmann – bestätigen die Problematik derselben, die in Frischs künstlerischer Tätigkeit Ausdruck in der Bildnisthematik gefunden hat. Waleczek konstatiert:
„Zeitlebens suchte Frisch die unmittelbare Nähe zu Frauen: Sinnliche Ausstrahlung, Schönheit und Anmut faszinierten ihn jedoch nicht nur im banalen geschlechtsspezifischen Sinn. So findet sich kaum eine literarische Arbeit von ihm, in der er nicht auch das Zusammenleben von Mann und Frau thematisierte. Der Frage nach genuinen Unterschieden zwischen den Geschlechtern begegnete er mit der Überzeugung, daß dergleichen auf sedimentierten Rollen, Zuschreibungen etc. beruhe.“[17]
Eng verbunden mit der Beziehung zum anderen Geschlecht ist der Zwiespalt zwischen bürgerlicher Existenzweise und dem Schriftstellerdasein. Anders als bei dem bereits erwähnten Autor Kafka und dem gleichfalls im Rahmen dieser Arbeit behandelte Philosophen Kierkegaard resultierte aus der Erkenntnis der Unvereinbarkeit der beiden Sphären für Frisch kein radikaler Rückzug in die künstlerische Isolation, sondern er kämpfte zeitlebens um einen Einklang zwischen seiner Berufung und seinen Liebesbeziehungen sowie mit der Frage, wie eine Dauerhaftigkeit der Liebe zu erreichen sei. Dabei war für Frisch anscheinend weniger das jeweilige Misslingen als der je neue Versuch entscheidend.
Des Weiteren interessant erscheint mir Frischs Verhältnis zum Tod. Diverse gesundheitliche Probleme sowie seine Krebserkrankung rückten das Sterben ab Ende der 80’er Jahre für Frisch in greifbare Nähe. Da er seinen Tod nicht zu ignorieren beabsichtigte, legte er frühzeitig präzise Angaben zu seinem Begräbnis fest. Mit der Vorstellung, dass der Tod den Endpunkt des Lebens markiert, versuchte er gleichzeitig, die Gegenwart des Lebens zu nutzen und war beispielsweise bis zu seinem Tod am 4. April 1991 in die Arbeiten zu den anlässlich seines 80. Geburtstags geplanten Max-Frisch-Tagen involviert.[18]
2. Max Frisch und Literatur
Der folgende Abschnitt bietet einen kurzen Überblick über den Themenkomplex Literatur im Leben von Max Frisch. Hierbei werde ich zum einen auf die thematischen und formalen Schwerpunkte seines Gesamtwerkes mit denen ihnen zugrunde liegenden Motivationen, sowie zum anderen auf Frischs theoretische Überlegungen zur Literatur und ihrer Zielsetzung eingehen.
Frischs ursprüngliche Schreibmotivation resultierte aus seiner defensiven Haltung gegenüber der Welt. Im Schreiben fand der Autor und Mensch Max Frisch eine Möglichkeit, der Welt standzuhalten – sein Leben überhaupt ertragen zu können. Nicht zu Unrecht bezeichnet Marcel Reich-Ranicki Max Frisch deshalb als einen „Dichter der Angst“[19], wobei das unbewusste Grundgefühl der Angst nicht nur Basis, sondern auch thematischen Schwerpunkt seiner Literatur darstellt.[20]
Dass dabei der individuell-subjektive Aspekt eine herausragende Stellung einnimmt, spiegelt bereits der Titel seines ersten Zeitungsartikel „Was bin ich?“ (1932) wider. Schon zu diesem Zeitpunkt zeigen sich die Frischs Gesamtwerk konstituierenden Fragen:
„Wer bin ich? Welches sind meine Möglichkeiten? Wo liegen meine Grenzen? Was ist das Leben? Welches ist der Sinn dieses Lebens? Warum kann ich nicht der sein, der ich im Grunde bin und gerne wäre? Warum will ich anders und mehr sein, als ich in Wirklichkeit bin? Was hindert mich an meiner Selbstverwirklichung? Was hindert mich in mir selbst? Was hindert mich außerhalb von mir? Wie kann man ein unverwechselbares Individuum sein und gleichzeitig Glied einer Gemeinschaft – sei es in der Ehe, sei es im Staat? Wie und wieweit ist Freiheit möglich? Freiheit in sich selbst und Freiheit innerhalb der Gemeinschaft?“[21]
Diese Fragen enthalten die seinem literarischen Schaffen zugrunde liegende Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, die Frisch jedoch nicht rein autobiographisch, sondern durch seine Protagonisten vermittelt im gesellschaftlichen Kontext behandelt. Als weitere zentrale Motive seines Werkes kann das individuelle Verlangen nach Veränderung – das sich autobiographisch in Frischs eigenen häufigen Wohnortwechseln widerspiegelt –, das Verhältnis der Geschlechter, der Komplex des Alterns sowie die Thematik des versäumten Lebens bezeichnet werden.[22] Trotz der inhärenten autobiographischen Dimension darf man die Inhalte der Dramen, Romane und Erzählungen nicht als Darstellungen von Frischs eigenem Leben identifizieren. Die dargestellten und auch den Autor bedrängenden Probleme haben zwar persönlichen Charakter, werden aber nicht auf privater Ebene behandelt.
Als exemplarisch kann die Thematisierung der Differenz von Bürger- und Künstlertum angesehen werden, die Frischs eigenes zwiespältiges Bedürfnis nach künstlerischem Schaffen einerseits und dem Wunsch nach Eingliederung ins Bürgertum andererseits illustriert, wobei vor allem auf die damalige Diskrepanz zwischen Züricher Bürgertugenden und Künstlertum hinzuweisen ist. Aufgrund der in familiärer Hinsicht eindeutig bürgerlichen Prägung kollidierten die literarischen Interessen des jungen Max Frisch frühzeitig mit den Konventionen des ihn umgebenden kleinbürgerlichen Milieus; die ersten Kontakte zum Theater und literarischen Ambitionen wurden von Seiten des Vaters entschieden missbilligt.[23] Während Max Frisch mit der dichterischen Sphäre ein „ausbrechen aus den Alltagszwängen und eintauchen in eine außergewöhnliche Welt tiefer Erlebnisse und intuitiver Selbstverwirklichung “[24] und somit eine Gegenwelt zur bürgerlichen Alltäglichkeit verband, konnte er sich gleichzeitig nicht von seiner ihn immer wieder heimsuchenden Sehnsucht nach einer bürgerlichen Existenz distanzieren. Diese innere Zerrissenheit, verursacht durch seine Ängste, sowohl als Bürger als auch Künstler zu versagen, kommt in seiner literarischen Arbeit zum Ausdruck und reflektiert seine persönlichen Versuche, diese Spannung zwischen den Polen künstlerischer Einmaligkeit und bürgerlicher Gewohnheit zu leben.[25] Besonders die frühe Schaffensphase ist von der Problematik Bürger- versus Künstlerexistenz beeinflusst, in der sich die Wunschvorstellung „Beruf soll nicht Zwangsjacke sein, […] sondern Lebensinhalt“[26] widerspiegelt. Erst Frischs endgültige Entscheidung für die Literatur als Brotberuf (1954/55) ließ diese Thematik tendenziell in den Hintergrund rücken.[27]
Wie bereits angedeutet ist Frischs literarische Arbeit Resultat eines persönlichen Impulses. Dementsprechend bezeichnete er sich als „Notwehrschriftsteller“[28] und erläuterte dieses im Gespräch mit Arnold mit dem Wunsch nach Selbsterhaltung und Abwehr der ihn bedrängenden Ängste mit dem Mittel der Literatur.[29] Des Weiteren rechtfertigt Frisch mit dieser subjektiven Motivation die sich wiederholende Themenwahl, die sich in keiner bewussten Entscheidung, sondern in seiner spezifischen Eigenart begründet.
„Warum kommt er immer wieder auf das gleiche Thema – sieht er das denn nicht? Natürlich sieht er es – er hat aber nur dieses, weil ihn eben dieses am meisten brennt. Das wissen alle, die selber irgend etwas machen: daß wir diese große Wahl gar nicht haben – wir haben wohl die Wahl der Mittel, aber die Wahl der Themen haben wir kaum.“[30]
Diese subjektive Dimension des Gesamtwerkes spiegelt sich in der theoretischen Literaturauffassung wider, wobei Frisch von seinem politisch engagierten Zeitgenossen und Schriftstellerkollegen Bertolt Brecht zu unterscheiden ist.
Die Intention des Autors Frisch besteht darin, einen Weg zwischen einem absoluten „l’art pour l’art“-Dogma und einer ideologisch-orientierten Kunst zu finden. Auf diese Weise will er seinen Lesern keine Richtlinie für ihr je eigenes Leben geben, sondern zum eigenen Nachdenken auffordern. Die darin liegende Absicht zur Veränderung muss von Brechts marxistisch orientierter Theorie differenziert werden. Frischs Werk liegt die Überzeugung zugrunde, dass
„die Entscheidung zur Veränderung seiner selbst […] beim Einzelnen [liegt], dessen Würde in der Wahl besteht; eine verbindliche Antwort oder gar Anweisung kann es nicht geben. Die Kunst des Vorangehenden besteht darin, die Frage unausweichlich zu stellen.“[31]
Frischs literatur-theoretische Entwicklung nimmt ihren Ausgangspunkt in einem rein apolitischen Kunstinteresse, aber lässt in ihrem Verlauf eine stärkere Hinwendung zur Integrierung politischer Themen erkennen. Entsprechend seiner Ideologieablehnung stellt er sich nie in den Dienst einer bestimmten Partei, sondern akzentuiert die auf das Individuum bezogene Dimension seines Engagements.[32] Die politische Komponente seines Schaffens sieht Frisch im Infragestellen der gesellschaftlichen Zustände durch ihre dichterische Darstellung. Dabei offenbart sich der subversive Charakter, insofern sich die rein individuelle Erfahrung kaum mit der allgemeinen Auslegung decken wird. Nach Frisch kann nur eine solche Darstellungsform mit dem innewohnenden Appell zur eigenen Reflektion langfristig eine Veränderung des Leserbewusstseins bewirken:
„Es ist meine persönliche Meinung, daß ich mit einem Text, der nicht direkt meine politische Überzeugung verbalisiert, aber eine Darstellung des Konkreten gibt, mehr erreiche (mehr zu erreichen hoffe), indem ich den Partner vorher ‘verunsichere’, ihn […] frei mache, das Dargestellte neu zu sehen und zwar der Situation angemessener zu sehen.“[33]
Aufgrund von Frischs Plädoyer für die Offenheit und Autonomie von Kunst gegenüber jeglichem ideologischen Gehalt ist eine größere Nähe zu Büchner, Keller und Zollinger als zu seinem zeitgenössischen Kollegen Brecht zu erkennen.[34] Nach Frisch liegt der problematische Kern jeder Ideologie in ihrer Tendenz zur Verfestigung und Erstarrung.[35] Neben dem subjektiven Ausdruck besteht für ihn die Aufgabe der Literatur durch ihre Darstellungsfunktion in der Verunsicherung und Zersetzung ideologischen Gedankengutes. Dass für Frisch die Fragen im Vordergrund stehen, deckt sich mit Reich-Ranickis Charakterisierung des Autors: „ Er ist ein Diagnostiker menschlicher Leiden, nicht etwa ein Therapeut.
Das soll heißen: Befund hat er zu bieten, nicht Lösungen.“[36]
Obwohl Frisch in seiner literarischen Arbeit insgesamt der individuellen Existenz Vorrang gegenüber dem gesellschaftlichen Aspekt zuschreibt, realisiert er, dass sich Kunst niemals ganz vom politischen Bereich distanzieren kann; er weiß: „ Wer sich nicht mit Politik befaßt, hat die politische Parteinahme, die er sich sparen möchte, bereits vollzogen: er dient der herrschenden Partei.“[37] Gleichzeitig beweist die innerhalb des Romans „Mein Name sei Gantenbein“ vertretene literaturtheoretische Auffassung die enge Verknüpfung zwischen privaten und öffentlichen Bereich und rechtfertigt damit den subjektiven Charakter seines literarischen Werkes:
„(Manchmal scheint auch mir, daß jedes Buch, so es sich nicht befaßt mit der Verhinderung des Kriegs, mit der Schaffung einer besseren Gesellschaft und so weiter, sinnlos ist, müßig, unverantwortlich, langweilig, nicht wert, daß man es liest, unstatthaft. Es ist nicht die Zeit für Ich-Geschichten. Und doch vollzieht sich das menschliche Leben oder verfehlt sich am einzelnen Ich, nirgends sonst.)“[38]
Neben den bereits vorgeführten Differenzen zwischen Frisch und Brecht, stellt die Übernahme des Verfremdungseffektes Brechts bedeutsamsten Einfluss auf den jüngeren Kollegen dar, wobei Frisch die ideologisch-inhaltliche Komponente außer Acht lässt. Mit der Anwendung der Verfremdungstechnik auf epische Literaturformen beabsichtigt er, die Einfühlung des Lesers in das Erzählte zu verhindern und damit die Illusion der Realitätsnähe zu zerstören.[39]
Des Weiteren ist die Tagebuchform und die damit verbundene Offenheit der Form als entscheidendes Merkmal von Frischs Gesamtwerk zu erachten. Dabei handelt es sich um eine „literarische Tagebuchform“, so dass selbst die herausgegebenen Tagebücher, „Tagebuch 1946–1949“ (1950) und „Tagebuch 1966–1971“ (1972), aufgrund ihres fiktionalen Charakters nicht als private Dokumente angesehen werden dürfen.[40] Frisch verdeutlicht, dass die Vorliebe für diese Form parallel zu seiner Themenwahl nicht beabsichtigt ist:
„[…] man kann wohl sagen, die Tagebuchform ist eigentümlich für den Verfasser meines Namens, Sie haben recht – gerade darum behagt mir Ihre Frage nicht. Stellen Sie sich vor, ein Mann hat eine spitze Nase, und Sie fragen ihn zuhanden der Leser: woher kommt Ihre Vorliebe für eine spitze Nase? Kurz geantwortet: ich habe keine Vorliebe für meine Nase, ich habe keine Wahl – ich habe meine Nase.“[41]
Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass Frischs Bevorzugung der diaristischen Form auch theoretische Gründe hat. Zum einen ermöglicht diese Form – wie die Romane „Stiller“ und „Homo faber“ beweisen – einen Weg der Selbstfindung, indem die Protagonisten schreibend versuchen, zu ihrer wahren Identität zu gelangen.[42] Zum anderen entspricht und dient das Tagebuch dem von Frisch propagierten Ziel der Wahrhaftigkeit. Subjektivität, Offenheit und Fragmentartigkeit diaristischer Aufzeichnungen ermöglichen die Revidierung jedes zuvor eingenommenen Standpunktes und beweisen damit die Verpflichtung des Schreibers zur Wahrheitssuche.[43] Mit der Überzeugung, dass eine solche Wahrheit im objektiven Sinn nicht existiert, geht es primär um ein „Umkreisen“, was Frisch selbst mit der Analogie von Literatur und Bildhauerkunst hervorhebt:
„Was wichtig ist: das Unsagbare, das Weiße zwischen den Worten, […]. Unser Anliegen, das eigentliche, läßt sich bestenfalls umschreiben, und das heißt ganz wörtlich: man schreibt darum herum. Man umstellt es. Man gibt Aussagen, die nie unser eigentliches Erlebnis enthalten, das unsagbar bleibt; sie können es nur umgrenzen, möglichst nahe und genau, und das Eigentliche, das Unsagbare, erscheint bestenfalls als Spannung zwischen diesen Aussagen.
Unser Streben geht vermutlich dahin, alles auszusprechen, was sagbar ist; die Sprache ist wie ein Meißel, der alles weghaut, was nicht Geheimnis ist, und alles Sagen bedeutet ein Entfernen. Es dürfte uns insofern nicht erschrecken, daß alles, was einmal zum Wort wird, einer gewissen Leere anheimfällt. Man sagt, was nicht das Leben ist. Man sagt es um des Lebens willen. Wie der Bildhauer, wenn er den Meißel führt, arbeitet die Sprache, indem sie die Leere, das Sagbare, vortreibt gegen das Geheimnis, gegen das Lebendige. Immer besteht die Gefahr, daß man das Geheimnis zerschlägt, und ebenso die andere Gefahr, daß man vorzeitig aufhört, daß man es einen Klumpen sein läßt, daß man das Geheimnis nicht stellt, nicht faßt, nicht befreit von allem, was immer noch sagbar wäre, kurzum, daß man nicht vordringt zu seiner letzten Oberfläche.“[44]
Mit seiner Skepsis gegenüber der Möglichkeit der Wahrheitsabbildung eng verbunden ist der Anspruch auf Verhinderung von Festlegungen jeder Art. Die offene und oft fragmentarische Form seiner literarischen Werke gibt Frisch die Möglichkeit, die Wirklichkeit der dargestellten Realität, so wie sie die geschlossene Form suggeriert, in Frage zu stellen. Die Offenheit ist Ausdruck eines Weltbildes, das keine fixierbare Wahrheit beansprucht; Autor und Leser stehen auf derselben Erkenntnisstufe. Frisch Hauptintention beinhaltet, die ihn beschäftigenden Fragen bei seinem Gegenüber offen zu halten.[45]
Eine explizite Analyse der Leserrolle, wie sie Egger unternimmt, möchte ich in dieser Untersuchung unterlassen, und nur darauf hinweisen, dass maßgeblich die formale Struktur – Offenheit und Fragment-Charakter wie sie insbesondere in der Tagebuchform zum Ausdruck kommen – den Leser zur eigenen Stellungnahme zwingt.[46]
Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich auf die Parallelität des Themenkomplexes Literatur bei Frisch und der Existenzphilosophie hinweisen. Wie die folgenden Kapitel zeigen werden, besteht diese Analogie sowohl auf thematischer Ebene durch die Betonung der subjektiven Existenz sowie auf formaler Ebene in der Ablehnung einer festgelegten Wahrheit und der Favorisierung von offenen Darstellungsweisen.
3. Max Frisch und Philosophie:
„Die reine Philosophie, mit wirklicher Inbrunst befragt, offenbarte mir nur den eigenen Mangel an Denkkraft.“[47]
Max Frischs literarische Arbeit nimmt – wie das vorangegangene Kapitel erläutert hat – ihren wesentlichen Ausgangspunkt in der subjektiven Sphäre des Autors. Er selbst begründet seine distanzierte Haltung gegenüber dem Bereich der Theorie mit seinen von ihm selbst als mangelhaft bewerteten intellektuellen Fähigkeiten. Im Gespräch mit Arnold erklärt er:
„Ich bin heute der Meinung, daß das Theoretische nie meine Stärke gewesen ist. Ich hab’s natürlich versucht, aber ich denke anderen Menschen dann doch sehr nach, also ich glaube nicht, daß ich eigentlich genuin theoretische Einfälle gehabt habe.“[48]
An die Stelle von reinen Denkmodellen rückt der persönliche Erfahrungshorizont als Voraussetzung für Frischs Literatur.
Bereits diese einleitenden Bemerkungen deuten die Schwierigkeit an, Frisch einer konkreten philosophischen Strömung zuzuordnen, was wesentlich mit seiner generellen Ablehnung ideologischer Inhalte übereinstimmt.
Von Seiten des Autors selbst fehlt es beinahe vollständig an Aussagen, die auf einen prägenden Einfluss konkreter philosophischer Konzeptionen hinweisen. Schmitz vertritt die These, dass man das „Thema: ‘Max Frisch und die Philosophie’ quellenkritisch kaum angehen“[49] kann. Petersen bestätigt die Schwierigkeiten, eine explizite Beschäftigung Frischs mit bestimmten philosophischen Autoren nachzuweisen. Seiner Meinung nach beweisen die in seiner Literatur enthaltenen Hinweise nicht notwendigerweise eine konkrete Kenntnis der Werke des genannten Philosophen, sondern können ebenso als Zeichen eines nur mittelbar vollzogenen Rezipierens gedeutet werden. Möglicherweise entsprechen diese Einflüsse auf den Schriftsteller Frisch den von ihm im Roman „Stiller“ dargestellten indirekten Vermittlungsprozessen unseres „Zeitalter der Reproduktion“.[50]
Da auch ich – wie im Vorwort angedeutet – davon ausgehe, dass die in dieser Arbeit zu untersuchenden existenzphilosophischen Elemente des Romans „Stiller“ weniger der konkreten Absicht des Autors entsprechen, sondern vielmehr unbewusste Parallelen darstellen, möchte ich an dieser Stelle nur einige wenige Erkenntnisse der Sekundärliteratur bezüglich Frischs Beschäftigung mit existenzphilosophischen Autoren darlegen, wobei die Andeutung einiger Analogien zwischen Frischs Denken und dem der Existenzphilosophie nicht zu vermeiden sein wird.
Gerade in der für die Analyse des Romans „Stiller“ essentiellen Identitätsproblematik wird die Korrespondenz existenzphilosophischer Überlegungen mit denen des Autors Frisch deutlich. Beide Menschenbilder beruhen auf einer wesentlichen Zweiteilung, die einen für den Menschen problematischen Zwiespalt konstituiert, der diesen vor die lebenslängliche Aufgabe seiner Selbstwerdung stellt. Frisch sieht die grundlegende Spaltung des Menschen in einen bewussten und empirisch bestimmbaren sowie einen unbewussten und nicht zu erfassenden Bereich, den er auch als das „Lebendige“ bezeichnet, was für ihn eine Korrespondenz zu den göttlichen Attributen darstellt.[51] – Wie die Zweiteilung existenzphilosophisch interpretiert wird, erläutert das folgende Kapitel.
Darüber hinaus weist die formale Seite Frischs Literatur
„eine gewisse Ähnlichkeit mit derjenigen der Philosophie, die erkennen will, und zwar nicht pragmatisch, indem sie nur Fragen stellt, auf die sie eine praktikable Antwort weiß, sondern die sich für die Fragen an sich interessiert“[52],
auf, was vornehmliches Merkmal der Existenzphilosophie ist.
Als sicher gilt eine Beschäftigung mit dem dänischen Philosophen Kierkegaard, wovon die vor den ersten Teil des Romans „Stiller“ eingefügten Motti aus dessen Werk „Entweder-Oder“ Zeugnis ablegen. Frischs Aussage zu diesen Zitaten bestätigt jedoch die Vorrangigkeit seines persönlichen Erfahrungsbereiches
gegenüber theoretischen Denkansätzen:
„[…] das Kierkegaard-Motto kam sehr spät dazu, weil ich dann anfing, Kierkegaard zu lesen und das entsprach mir natürlich von der Position aus ungeheuer. Ich habe dann dieses gewagte Motto genommen – eigentlich als Leserhilfe.“[53]
Schmitz geht davon aus, dass Frisch zur Zeit der Niederschrift des „Stiller“ sowohl Kierkegaards Werke „Entweder-Oder“ und „Die Krankheit zum Tode“ als auch Teile der Tagebücher gelesen habe.[54] Inwieweit es sich dabei um eine gesicherte These handelt, möchte ich offen lassen.
Literarisch beschränkt sich der Einfluss Kierkegaards auf Frischs Werke „Stiller“ und „Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie“. Während im Stück „Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie“ hauptsächlich Bezug auf Kierkegaards Don Juan Analyse und das „Tagebuch des Verführers“ Bezug genommen wird, zeigt sich die Beschäftigung im Roman „Stiller“ auf inhaltlicher Ebene durch die Identitätsproblematik und die Auseinandersetzung mit den von Kierkegaard angebotenen Selbstwerdungsmöglichkeiten und auf formaler Ebene durch eine Angleichung des Romans an die Struktur des Werkes „Entweder-Oder“. Auf die konkreten Parallelitäten und Differenzen zwischen „Stiller“ und Kierkegaards Philosophie werde ich im Verlauf dieser Arbeit noch ausführlicher zu sprechen kommen. Außerdem besteht eine wesentliche Affinität der Werke beider Autoren in dem literarisch verarbeiteten Konflikt zwischen künstlerischer und bürgerlicher Lebensweise.[55]
Was den deutschen Philosophen Heidegger angeht, so taucht sein Name zwar an vier Stellen des Gesamtwerkes – u. a. an einer Stelle im „Stiller“[56] – auf, doch „jedesmal [ ] so beiläufig, daß man nicht einmal sagen kann, ob Frisch von Heidegger überhaupt etwas gelesen hat.“[57]
Kiernan dagegen geht davon aus, dass Heideggers Daseinsanalyse die Romane „Stiller“, „Homo faber“ und „Mein Name sei Gantenbein“ wesentlich beeinflusst habe.[58] Ihre Untersuchung des „Stillers“ mit Blick auf Heideggers Philosophie begründet sie mit dessen thematischer Nähe zu Kierkegaard und der fehlenden religiösen Komponente, was mit Frischs eigener Position korrespondiert.[59] Allerdings bestreitet auch Kiernan, „daß Frischs Romane gewissermaßen in Literatur ‘übersetzte’ Philosophie seien “[60] und betont den intuitiven Charakter von Frischs Arbeit.[61]
Inwieweit Frisch die existentialistischen Positionen von Sartre und Camus rezipiert hat, kann keine Angaben gemacht werden.
Was die Nähe zu Sartre angeht, so erscheint mir vor allem die miteinander korrespondierenden Auffassungen zum mitmenschlichen Umgang entscheidend, die auf der einen Seite in dem von Frisch und seinen Protagonisten propagierten Bildnisverbot und auf der anderen Seite durch Sartres theoretische Überlegungen zur Philosophie des Anderen und seine literarischen Darstellungen zum Ausdruck kommen.
Frischs Zurückweisung jeglicher Verwendung von Kunst als Mittel der Vermarktung einer ideologischen oder philosophischen Gesinnung und der damit verbundenen offenen Form seiner Werke, die die Übernahme von individueller Verantwortung fordert, entspricht der gesamten existenzphilosophischen Kunst- und Literaturauffassung. Diese kommt meiner Meinung nach besonders Camus’ Selbstsicht als Künstler, dessen Werke nicht als philosophische Illustrationen beurteilt werden sollen, sehr nahe.
4. Allgemeine Bemerkungen zur Existenzphilosophie
Existenzphilosophie bezeichnet eine der wichtigsten philosophischen Strömungen des 20. Jahrhunderts, die ihre Begründung bereits Mitte des 19. Jahrhunderts durch Kierkegaards Ablehnung der traditionellen Essenzphilosophie und seiner Zentrierung des Begriffes Existenz in den Mittelpunkt philosophischer Überlegungen erfahren hat.
Auch wenn Existenzphilosophie im Laufe der Zeit verschiedene Arten angenommen hat, so ist all diesen Richtungen „ zunächst die Frage nach dem Charakteristischen und Eigentümlichen der Seinsweise des Menschen “[62] gemeinsam. Ein emphatischer Begriff von Existenz steht im Mittelpunkt des Interesses[63]:
„Existenz als spezifisch menschliche Existenz ist von allen anderen Formen des Seins völlig verschieden. Dabei wird menschliche Existenz im Sinn von faktischer, konkreter oder gelebter Existenz genommen.“[64]
In diesem Sinne meint Existenz etwas, das erst verwirklicht werden muss, womit sich die Abgrenzung zum traditionell systematischen Denken, das als Verneinung der tatsächlichen Lebensverhältnisse interpretiert wird, widerspiegelt.[65]
Der traditionelle „Existenz“-Begriff ist Ausdruck für das bloße Dasein eines Dinges ohne jede weitere Bestimmung. Bezogen auf den Menschen ist hiermit das „Dasein“, das „Vorhandensein“ oder die „Wirklichkeit“ eines Menschen gemeint, womit der Begriff „Existenz“ im Gegensatz zu dem des Wesens – „der Essentia“ – steht. In dieser Interpretation kann man folgende Aussage treffen: „Existenz bedeutet […], ‘daß’ etwas tatsächlich vorkommt, im Gegensatz zum ‘Was’, seinem Wesen […].“[66]
Die Existenzphilosophie hat seit Mitte des 19. Jahrhunderts die zweite weitergehende und schon angesprochene Bedeutung von „Existenz“ als die inhaltliche Bestimmung des Daseins – die bewusste menschliche Lebensgestaltung – etabliert, womit die bisherige Unterordnung unter den Begriff der „Essenz“ aufgehoben – die ursprüngliche Bedeutung als bloßes Dasein jedoch nicht gelöscht – worden ist.[67]
Jegliche Philosophie, die sich mit der Existenz beschäftigt, stellt eine bewusste Abgrenzung zu der rationalistischen Wesensphilosophie dar. In diesem Zusammenhang bezeichnet Existenz jetzt „die spezifische, unableitbare und individuelle Seinsweise des Menschen.“[68] Der Begriff Existenz bezeichnet das „aus Freiheit entstehende Verhalten des einzelnen Menschen zum Sein, wodurch er sein So-Sein konstituiere.“[69]
Kierkegaards Einführung des hier vorgestellten Existenzbegriffes, der zur Grundlage der gesamten Existenzphilosophie geworden ist, markiert vor allem eine bewusste Abgrenzung von Hegel. Während im Mittelalter die Existenz ein reines Faktum darstellte, hat Hegel eine Einheit von Wesen und Existenz deklariert. Gegen diese von Hegel propagierte Begriffsdialektik versucht der Existenz-Begriff, der als eine Lebensweise, die allein dem Menschen zuzuordnen ist, die Einmaligkeit der menschlichen Existenz vor einem Verlust im entpersönlichten allgemeinen Begriffswesen zu schützen.[70]
Dieses Motto hat die gesamte Existenzphilosophie des 20. Jahrhunderts aufgenommen:
„Daß ein Mensch existiert, heißt nicht, daß er oder sie einfach ‘da’ ist, sondern daß man sich zu seinem Dasein verhalten, sich zu (oder gegen) sich entscheiden muß, ohne sich an einer ihm oder ihr übergeordneten Essenz orientieren zu können.“[71]
Der Akt des Existierens meint das Sich-Verhalten zur Existenz, insofern „Existenz […] ein Sein [ist], das durch wirklichkeitserzeugendes Handeln von einem Individuum in seinem Selbstvollzug hervorgebracht wird.“[72]
Diese Wirklichkeit ist untrennbar mit dem Akt des Existierens, dem Lebensvollzug in dieser Wirklichkeit, verbunden.[73]
Die Grundfrage der Existenzphilosophie „Was mache ich mit meiner Existenz?“ gewinnt dabei vor allem in Grenzsituationen wie Angst, Leid, Tod und Absurdität des Daseins, die die Frage nach dem Sinn des Lebens hervorrufen, an Bedeutung. Dementsprechend hat die Existenzphilosophie wesentlich durch die Erfahrung der Weltkriege an Relevanz zugenommen. In diesen Krisensituationen musste das Individuum seine Angewiesenheit auf die eigene Person erkennen – „es wurde auf sich selbst zurückgeworfen, auf seine eigene einmalige Existenz in ihrer jeweiligen geschichtlichen Situation“[74] und sich die „Grundfrage nach der Möglichkeit einer sinnvollen, wahren oder ‘eigentlichen’ Existenz unter den gegebenen geschichtlichen Bedingungen“[75] stellen.
Neben dem Aspekt der menschlichen Freiheit sind diese Erfahrungen sowohl Grundlage als auch wichtigste Themen der Existenzphilosophie, um Möglichkeiten zur Gestaltung des individuellen Lebens aufzuzeigen. Die Notwendigkeit, sich zur eigenen Existenz zu verhalten, begründet sich gleichzeitig im existenzphilosophischen Menschenbild, das nicht nur das Vorhandensein einer vorgegebenen menschlichen Natur leugnet, sondern darüber hinaus die Besonderheit des Menschen gegenüber der „restlichen“ Natur betont. Der Mensch stellt eine Synthese zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit dar. Die Begrenztheit des menschlichen Seins offenbart sich durch den Tod; die Tendenz zum Unendlichen zeigt sich durch die Denkfähigkeit und die Möglichkeit, sich zu seiner Endlichkeit zu verhalten. Außerdem ist festzustellen, dass der Mensch zwar durch bestimmte biologische und psychologische Dispositionen[76] bestimmt ist, gleichzeitig aber ein freies Verhältnis zur Zeit hat. Der Mensch bildet eine Einheit aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Durch seine Fähigkeit zum Denken, kann er sich an die Vergangenheit erinnern und Schlüsse für sein zukünftiges Leben ziehen. Hier zeigt sich eine Freiheit, die der restlichen Natur fehlt. „ Das Sich-Verhalten zur eigenen Situation gibt dem Menschen die Möglichkeit, in diese Situation einzugreifen und sie zu ändern. “[77] Sein Denken gibt ihm Gelegenheit, die Frage nach dem Sinn des Seins bzw. die Frage nach dem Sinn des Lebens zu stellen.
Der schon erwähnte Freiheitsaspekt stellt eine metaphysische Notwendigkeit dar, insofern der Mensch seine Freiheit nicht wählen kann, sondern bereits in diese hineingeboren wird.[78]
Existenzverwirklichung kann dabei niemals als abgeschlossen betrachtet werden, sondern besteht in Bewegung und immerwährendem Streben, wobei der Praxisbezug der Existenzverwirklichung deutlich wird. Existenz lässt sich nicht durch theoretische Bestimmungen, „sondern nur aus dem Wie ihres Vollzugs kennzeichnen“[79].
Die Frage nach einer dem Menschen übergeordneten Instanz wird in den verschiedenen existenzphilosophischen Strömungen unterschiedlich beantwortet. Sören Kierkegaard kann eindeutig als christlich-religiöser Philosoph bezeichnet werden. In der deutschen Ausprägung bei Martin Heidegger und Karl Jaspers findet sich dagegen eine Tendenz zum Idealismus[80], die in der französischen atheistisch-geprägten Existenzphilosophie nicht zu erkennen ist.[81]
Abschließend ist hervorzuheben, dass das existenzphilosophische Ziel nicht in greifbaren Antworten zur individuellen Lebensgestaltung besteht. Die Betonung des Individuums impliziert, dass dieses die passenden Antworten und Entscheidungen selbst zu finden hat. Die Philosophie kann nur den metaphysischen Rahmen abstecken.[82]
5. Einzelne existenzphilosophische Positionen
5.1 Sören Kierkegaard
Sören Kierkegaard (1813–1855) kann sicherlich mit Recht als Begründer der Existenzphilosophie bezeichnet werden. Mit seiner Kritik an Hegel und der Ablehnung der traditionellen Metaphysik sowie der Definition von Existenz als „das empirisch-besondere, geschichtliche und zufällige Dasein des Einzelnen “[83] hat er den Grundstein für alle weiteren philosophischen Strömungen gelegt, die gegenüber dem traditionellen Wesensbegriff das subjektive Sein des Menschen in den Vordergrund stellen.
Eine Darstellung der Philosophie Kierkegaards im Rahmen dieser Arbeit begründet sich durch die dem Werk „Stiller“ vorangestellten Zitate aus „Entweder-Oder“ (1843), inhaltlicher wie auch formaler Ähnlichkeiten zwischen Kierkegaards Werk und dem hier zu behandelnden Roman sowie die mehrfache Erwähnung des Philosophen innerhalb des „Stiller“.
Im Gegensatz zu den im weiteren Verlauf dieser Arbeit präsentierten existenzphilosophischen Standpunkten unterstreicht Kierkegaard die Beziehung des Einzelnen zu Gott, insofern für ihn erst der individuelle Glaube Existenzverwirklichung ermöglicht, weshalb er nicht primär als Philosoph, sondern religiöser Denker bezeichnet werden muss. Während Kierkegaard in seiner Beschreibung der verschiedenen Stadien zur Selbstwerdung das Religiöse gegenüber dem Ethischen und Ästhetischen favorisiert, ist er selbst aufgrund seiner schriftstellerischen Tätigkeit – entgegengesetzt zu seinem Wunsch eines bürgerlichen Lebens – der ästhetischen Sphäre zuzuordnen.
Wie meine allgemeinen Bemerkungen verdeutlicht haben, bildet die Betonung der Besonderheit des menschlichen Zustandes den Mittelpunkt der Existenzphilosophie.
Kierkegaard bezeichnet den Menschen als „ Zwischenwesen “[84], dessen Seinsweise in einem „Schweben“ zwischen den Polen Endlichkeit und Unendlichkeit besteht, wobei diese für den Menschen selbst unbegreiflich ist.[85] Der Mensch ist der übrigen – organischen und anorganischen – Natur „übergeordnet“, insofern er neben der Gebundenheit an die Naturgesetze durch die Fähigkeit zum selbstständigen Denken die Möglichkeit hat, über sich selbst hinauszugehen, um verändernd in Situationen einzugreifen. Gleichzeitig ist er Gott, als dem von raum-zeitlichen Beschränkungen unabhängigen Wesen, untergeordnet. Insgesamt bildet der Mensch eine Verbindung von Notwendigkeit als seinem natürlichen Ursprung und Möglichkeit als Resultat seiner Freiheit. Analog kann diese Synthese als Einheit von Denken und Existieren bzw. Möglichkeit und Wirklichkeit bezeichnet werden. Denken schafft Möglichkeit, wohingegen Existieren als die menschliche Notwendigkeit die absolute Wirklichkeit darstellt, die durch seine Endlichkeit bzw. Faktizität gekennzeichnet ist. Mit seiner körperlichen Existenz auf der einen Seite und seiner Denkfähigkeit auf der anderen Seite, vereinigt der Mensch zwei konträre Momente in sich.[86] Damit unterscheidet er sich von Gott, der weder denkt noch existiert sondern erschafft und ewig ist.[87] Entscheidend ist die menschliche Bewegungsfähigkeit zwischen den kontrastierenden Bestimmungen: Dem rein empirischen Sein und dem Anspruch auf universelle Geltung.[88]
Doch diese Zusammensetzung aus Unendlichkeit und Endlichkeit konstituiert in seinem Widerspruch zwischen Existieren und Denken eine für den Menschen problematische Situation, insofern er existierender Denker bzw. denkender Existierender ist.[89] Die Existenz als die einzige Wirklichkeit des Menschen ist nicht denkend erfassbar – jedes Wissen wäre bloßes Übersetzen in Möglichkeit –, gleichzeitig ist die Realität seines Vorhandenseins seine einzige Gewissheit, woraus folgt, dass jede Wahrheit subjektiver Natur ist.[90]
Aus dieser Problematik heraus bestimmt Kierkegaard das „Existieren“ als das höchste Interesse des Menschen.[91] Das Existieren als Aufgabe des Menschen impliziert, „daß ich mich unter den Grundsatz des Widerspruchs stelle“[92] und die Pole Unendlichkeit und Endlichkeit zu einer Einheit zu bringen versuche.[93] Das heißt, dass der Mensch sich dauerhaft im Modus des Werdens befindet, denn
Existenzvollzug ist ein niemals abgeschlossener Prozess. Selbst wenn man dieser Pflicht durch Verdrängung zu entgehen versucht, kann man sich nicht der Selbstverantwortung entziehen.[94] Soll Existieren jedoch nicht als bloßes Dahinleben verstanden werden, so muss diese Pflicht mit Leidenschaft übernommen werden. Sie erfordert in der Gradwanderung zwischen Denken als Abstraktion und dem Leben in der Endlichkeit die gesamte menschliche Kraft und bestimmt die gesamte Lebenszeit.[95] Die Durchführung des existentiellen Lebensvollzuges besteht in einem Sprung, der aus der Freiheit des Existierenden eine Möglichkeit herausnimmt und durch das entsprechende Handeln in Wirklichkeit umsetzt, wofür die Leidenschaft als das unendliche Interesse am Existieren vorausgesetzt werden muss.[96] Die Besonderheit der von Kierkegaard gemeinten Leidenschaft resultiert aus ihrem idealisierenden Charakter[97], der in der „Antizipation des Ewigen in der Existenz für einen Existierenden, um zu existieren“[98] besteht. Existenz ist Bewegung, denn
„daß der Existierende existiert, verhindert wesentlich die Kontinuierlichkeit, während die Leidenschaft die momentweise Kontinuierlichkeit ist, die zugleich gegenhält und die Impuls der Bewegung ist. Für den Existierenden sind das Maß der Bewegung die Entscheidung und die Wiederholung.“[99]
Der Sprung soll die Lücke zwischen den im Bewusstsein entstandenen Selbstentwürfen und der konkreten Umsetzung im Leben schließen, wobei sich Selbstwerdung immer nur in einzelnen Augenblicken vollziehen kann.[100] Dabei darf Kierkegaards Verweis auf den Tod nicht vernachlässigt werden, erst durch das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit gewinnt das Leben als „ Zeit der Entscheidung “[101] an Bedeutung.
Auch wenn Existieren verschiedene Formen annehmen kann, besteht die Gemeinsamkeit darin, dass jeder wahrhaft Existierende seine ganze Kraft und Leidenschaft darauf verwenden wird, sein Leben bewusst zwischen den Polen Ewigkeit und Zeitlichkeit zu lenken und einen Ausgleich zu schaffen und beizubehalten.[102]
Das menschliche Seins betreffend erscheint mir eine kurze Darstellung Kierkegaards Angstkonzeptes relevant. Eine wesentliche Eigentümlichkeit der menschlichen Seinsweise besteht in der Angst, die anders als der Begriff Furcht nicht etwas Konkretes zum Gegenstand hat. Stattdessen steht sie in enger Verbindung zum Freiheitsbewusstsein – dem Wissen, dass man als Mensch jederzeit für sein Lebens selbst verantwortlich ist. Insofern die freie Wahl und die Subjektivität das entscheidende Merkmal des menschlichen Seins ist, kann gesagt werden:
„Wovor aber die Angst sich ängstigt, ist das ‘Nichts’ des Selbst, insofern Freiheit und Selbst weder vor der Entscheidung wirklich sind noch aus einer Möglichkeit abgeleitet werden können, sondern sind, wenn sie sind.“[103]
Angst als Grundbefindlichkeit des menschlichen Zustandes zu beschreiben, findet sich gleichfalls bei Heidegger und Sartre. Angst bildet die Voraussetzung zur Existenzverwirklichung, indem sie dem Menschen die Bestimmungen seines Seins realisieren lässt. Kierkegaard bemerkt,
„daß dies ein Abenteuer ist, das jeder Mensch zu bestehen hat – er muß das Fürchten lernen, um nicht ins Verderben zu geraten, entweder weil er niemals in Angst gewesen ist oder weil er in Angst versinkt; wer sich richtig zu fürchten gelernt hat, der hat deshalb das Höchste gelernt.“[104]
Darüber hinaus steht die Angst bei ihm in enger Verbindung zur Religion, denn erst der Sprung ins religiöse Stadium befreit den Menschen von Angst und Verzweiflung.[105]
Auf Kierkegaards Differenzierung der verschiedenen Existenzstadien werde ich im Folgenden eingehen.
Die drei Hauptstadien sind das ästhetische, das ethische sowie das religiöse Stadium, die in dieser Reihenfolge aufeinander folgen können, aber nicht müssen, da die konkrete Lebensweise der individuellen Entscheidung obliegt.[106] In dieser Abfolge bewirken die Stadien eine Steigerung im Prozess der Selbst- bzw. Existenzverwirklichung.
In seinem Werk „Entweder-Oder“ stellt Kierkegaard unter dem Pseudonym des Herausgebers Johannes Climacus dem durch die Papiere des anonymen A präsentierten ästhetischen Lebensentwurf die sich in der brieflichen Reaktion widerspiegelnde ethische Position des Gerichtsrat Wilhelm (B genannt) gegenüber. Dass dieser die Haltung des Ästhetikers durchschauen kann und auf formaler Ebene das „letzte Wort“ hat, zeigt Kierkegaards Bevorzugung der ethischen Lebensform.[107]
Das Leben im ästhetischen Stadium ist vorrangig durch seinen unmittelbaren und unverbindlichen Charakter gekennzeichnet. Die vom Ästhetiker betonte Freiheit bleibt im Bereich der bloßen Möglichkeiten, insofern keine dieser konkretisiert wird, denn die aus einer Entscheidung resultierende Festlegung würde die Übernahme von Verantwortung nach sich ziehen, wozu der Ästhetiker aufgrund der Angst vor einer Einschränkung seiner Freiheit nicht bereit ist. Stattdessen bleibt er auf der Ebene der Anschauung und des Genusses. Kierkegaard bezeichnet ein solches Dasein als leer und unwirklich, insofern es durch die fehlende Bereitschaft zur bewussten Wahl nicht zum Vollzug der Selbstwerdung kommt. Aufgrund mangelnder Entschlusskraft fehlt dem Ästhetiker jegliche Kontinuität, denn durch die Beschränkung auf Zufälligkeiten kommt es weder zu Erfahrungen noch zu einem kohärenten Lebensverlauf.[108] Ein solches Leben
„zerfällt in lauter zusammenhanglose Einzelerlebnisse […] gelangt […] zu keiner Geschichtlichkeit und zu keiner Lebenswirklichkeit, die nur aus dem Zusammenhang entstehen kann. Das ästhetische Dasein ist ein Leben im Möglichen, daher ist es keine wirkliche Existenz, sondern bloße ‘Existenzmöglichkeit’.“[109]
In dieser Beschreibung spiegelt sich das „falsche“ Zeitverhältnis wider, das sich – wie die ästhetische Lebensform überhaupt – in verschiedenen Varianten zeigen kann: Beispielsweise in einem spontanen, ganz auf den Augenblick bezogenen Handeln oder durch reine Reflektion, die die Gegenwart zum bloßem Denkanlass reduziert.[110]
Das Verharren des Ästhetikers im Bereich der Möglichkeiten resultiert aus der Angst vor Langeweile und Wiederholung; A aus „Entweder-Oder erklärt: „ Ich fürchte weder komische noch tragische Schwierigkeiten; die einzigen, die ich fürchte, sind die langweiligen.“[111] Diese Haltung spiegelt sich gleichfalls im mitmenschlichen Umgang wider. Aufgrund der Vermeidung von Bindungen und Verpflichtungen, bleiben die Beziehungen auf rein oberflächlicher Ebene. A setzt an die Stelle einer dauerhaften Liebesbeziehung flüchtige und wechselnde Affären. Für ihn „ist doch die schönste Zeit, die erste Periode der Liebe, wenn man bei jeder Zusammenkunft, jedem Blick etwas Neues heimbringt, um sich daran zu erfreuen.“[112] Besonders deutlich offenbart sich die fehlende Bindungsfähigkeit des Ästhetikers im „Tagebuch des Verführers“[113], in dem sich A als Frauenheld präsentiert, der zur Steuerung sowohl der eigenen Gefühle als auch der gesamten Beziehungsentwicklung fähig ist. Seine Aussage
„Ich bin ein Ästhetiker, ein Erotiker, der das Wesen der Liebe und die Pointe darin begriffen hat, der an die Liebe glaubt und sie von Grund auf kennt, und behalte mir nur die private Meinung vor, daß jede Liebesgeschichte höchstens ein halbes Jahr dauert und daß jedes Verhältnis zu Ende ist, sobald man das letzte genossen hat.“[114]
verdeutlicht den fehlenden Glauben an eine Lebenskontinuität.
Analog zu der sozialen Distanz hat der ästhetisch lebende Mensch ein bloß abstrakt-theoretisches Verhältnis zur Welt.[115]
Die Bilanz des Ästhetikers A „ Das Resultat meines Lebens wird gar nichts sein, eine Stimmung, eine einzelne Farbe.“[116] demonstriert die Leere eines solchen Lebens.
Infolgedessen ist das ästhetische Stadium durch Verzweiflung, bei der Kierkegaard zwei Formen unterscheidet, gekennzeichnet. Während eine Kultivierung in Form von Schwermut bzw. „gepflegter Melancholie“ das Individuum an die ästhetische Lebenshaltung gebunden lässt[117], bildet die zweite Art als Bewusstwerdung der Leere seines Zustandes die Vorstufe zur Selbstwahl und somit Gelegenheit zum Übergang ins ethische Stadium.
Im Gegensatz zum ästhetischen Stadium ist das ethische Stadium wesentlich durch Wahl und Entscheidung charakterisiert. Mit der Wahl einer Möglichkeit und der gleichzeitigen Verwerfung einer anderen beweist der Ethiker seine Entschlusskraft und demonstriert sein Wissen, dass nur auf diesem Weg Freiheit und Wirklichkeit erreicht werden kann, wobei die Realität dem Bereich bloßer Eventualitäten übergeordnet wird.[118] In seiner Beschreibung des ethischen Menschen,
„behandelt er [Kierkegaard] den Ausdruck ‘sich selbst wählen’ als etwas Grundlegendes, was seinerseits wieder eng an Selbsterkenntnis, Selbstübernahme und Selbstverwirklichung geknüpft ist. Das ethische Subjekt wird als ein Subjekt geschildert, das sich selbst als ‘Ziel’, als ‘Aufgabe’ betrachtet.“[119]
Die Wahl des Übergangs in das ethische Stadium impliziert die Bejahung von Verantwortung und Allgemeinheit. Man sieht sich nicht länger als Einzelwesen, sondern setzt sich ins Verhältnis zu anderen Individuen, gegenüber denen man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Indem der Ethiker sich als Teil der Gesellschaft betrachtet, bilden für ihn individuelle Subjektivität und allgemeine Verantwortlichkeit keinen Widerspruch, denn er identifiziert sich mit der Gesellschaft und interpretiert gleichzeitig das Allgemeine als Bestandteil seiner selbst. Auf diese Weise wird die ethische Selbstverwirklichung im sozialen Rahmen, der nicht wie vom Ästhetiker als Zwang empfunden wird, betrieben, was sich u. a. in der Übernahme von bürgerlichen, institutionellen und sozialen Verpflichtungen manifestieren kann.[120] Insbesondere die Ehe beurteilt Kierkegaard als entscheidendes Kriterium hinsichtlich Existenzverwirklichung, weshalb er sich selbst aufgrund seiner gelösten Verlobung zu Regine Olsen in ethischer Hinsicht als gescheitert sieht. Was seine Ehe betrifft, so weiß der Ethiker B aus „Entweder-Oder“: „ Wenn man ein Heim hat, so hat man Verantwortung, und diese Verantwortung gibt innere Sicherheit und Freude.“[121] Dem Problem der möglichen Wiederholung und Langeweile stellt er ein bewusstes Handeln in der Gegenwart gegenüber, das die Dauerhaftigkeit der Liebesbeziehung ermöglicht.[122]
Gleichzeitig wird auf diese Weise der Unterschied zwischen ästhetischem und ethischem Stadium hinsichtlich des Zeitverhältnisses erkennbar. Die Wiederholung wird als etwas Positives, dem Leben Gegenwärtigkeit verleihendes angesehen[123], wobei das Jetzt nicht in Augenblicke aufgespalten wird, sondern die Zeit in ihrer Kontinuität als der Einheit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft angenommen wird.
Insgesamt ist zu betonen, dass das ethische Pathos im Handeln, gegenüber dem die Reflektion eine untergeordnete Rolle einnimmt, besteht. Im Kontrast zur ästhetischen Uninteressiertheit am eigenen Existieren, steht dieses – wie ich zu Anfang dieses Kapitels beschrieben habe – im Zentrum des ethischen Lebens.[124]
Das religiöse Stadium bewertet Kierkegaard als höchste Stufe der Selbstwerdung.
Der Weg in dieses Stadium führt über den Glaubenssprung, der darin besteht, dass sich der Mensch als schuldig annimmt und wählt. Besonders problematisch stellt sich die Annahme des christlichen Glaubens aufgrund der immanenten Paradoxie der Menschwerdung Gottes in der Gestalt Jesu dar, insofern „ das Ewige selbst in einem Moment der Zeit geworden ist“[125]. Der Glaube verlangt die bedingungslose Bejahung dieses durch keine Lehre zu verstehenden Widerspruchs, was nur mit „ unendlicher Leidenschaft “[126] erreichbar ist.[127] Nur die individuelle Existenzentscheidung des Glaubenssprunges kann dieses Paradox, das weder auf Verstandesebene noch durch historische Tatsachen beweisbar ist, überwinden.[128] Die traditionelle Aufnahme ins Christentum widerspricht nach Kierkegaard der persönlichen Entweder-Oder-Entscheidung bezüglich Religion. Der von ihm geforderte leidenschaftliche Entschluss setzt die Kenntnis der christlichen Lehre voraus, womit Kierkegaard seine Kritik am „gedankenlosen Massenchristentum“ begründet.[129] Seine Forderung nach einem innerlich entschiedenen Christentum drückt er folgendermaßen aus:
„Die Entscheidung liegt im Subjekt, die Aneignung ist die paradoxe Innerlichkeit, die von aller anderen Innerlichkeit spezifisch verschieden ist. Das Christsein wird nicht durch das Was des Christentums bestimmt, sondern durch das Wie des Christen. Dieses Wie kann nur zu einem passen, zum absoluten Paradox. Da gibt es deshalb kein unbestimmtes Reden davon, daß das Christsein sei: annehmen und annehmen und ganz anders aneignen (lauter rhetorische und fingierte Bestimmungen); sondern das Glauben ist, spezifisch bestimmt, verschieden von aller anderen Aneignung und Innerlichkeit. Glaube ist die objektive Ungewissheit zusammen mit der Abstoßung durch das Absurde, festgehalten in der Leidenschaft der Innerlichkeit, was gerade das Verhältnis der Innerlichkeit, potenziert zu seiner höchsten Höhe, ist. Diese Formel paßt nur auf den Glaubenden, […] der sich zum absoluten Paradox verhält.“[130]
Die hier zum Ausdruck kommende Betonung der Subjektivität – auch „Innerlichkeit“, „Selbstübernahme“, „Gesinnung“ oder wie bei späteren Existenzphilosophen „Authentizität“ genannt – mit der Kierkegaard den Grundstein für Heideggers Philosophie und die des Existentialismus und den Beschreibungen von „Uneigentlichkeit“ (Heidegger) bzw. „mauvais foi“ (Sartre) legt[131] –, hat konträr zu distanzierter Selbstreflektion wesentlich eine praktische Dimension, die sich in Entscheidungen und der verantwortlichen Übernahme der aus diesen entstandenen Konsequenzen manifestiert.
Obwohl Innerlichkeit speziell mit Glauben und Religion verbunden ist, findet sich die Identifikation mit dem eigenen Leben mit den Werten Aufrichtigkeit und Entschlossenheit bereits im ethischen Stadium, denn auch in diesem hat die Praxis Vorrang vor dem Denken. Die Festlegung auf den christlichen Glauben ist wie die Wahl einer jeden Lebensform eine objektiv nicht zu rechtfertigende persönliche Angelegenheit. Das Konzept der radikalen Wahl ist dabei sowohl im religiösen als auch ethischen Bereich entscheidend.[132] Lediglich bezüglich des ästhetischen Stadiums, das jeder Verpflichtung zu entgehen beabsichtigt, kann von einer solchen Wahl nicht gesprochen werden.
Der zum Übergang ins religiöse Stadium vollzogene Sprung demonstriert das „richtige“ Zeitverhältnis in der Existenzverwirklichung. Im Sprung wird das zeitliche Dasein unter ewige Verantwortung genommen – die paradoxe Berührung von Zeit und Ewigkeit vollzieht sich im Augenblick. Dieser wird offenbar
„immer dann, wenn der Einzelne sich in Existenz wählt. Im Augenblick wird der Einzelne gleichzeitig mit sich, und erst diese Selbstgegenwart in der Entscheidung scheidet Vergangenheit und Zukunft, konstituiert ‘Zeitlichkeit’ und läßt Geschichte beginnen.“[133]
In der Aussage, dass die Wahrheit des Christentums in seiner Subjektivität liege, zeigt sich Kierkegaards vom Alltag abweichende Bedeutung von Wahrheit. Wichtig ist nicht, dass der Glaubensinhalt einer Tatsache entspricht, sondern die persönliche Überzeugung, die sich im persönlichen Engagement – der leidenschaftlichen Hingabe in Verbindung mit der geforderten Innerlichkeit beweist.[134]
Des Weiteren betont Kierkegaard das Sündenbewusstsein als charakteristisches Merkmal des Christ-Seins. Für ihn besteht die Stärke des Christen, „ angesichts eines unbegreiflichen Gottes [zu] existieren.“[135] Die dauerhafte Entfremdung von dieser göttlich-paradoxen Wahrheit ist Ursache der grundsätzlichen Sündhaftigkeit des menschlichen Zustandes, wobei „ die Sünde […] keiner deterministischen oder wissenschaftlichen Erklärung zugänglich [ist]; jeder wird ‘nur durch sich selbst’ schuldig.“[136] Zum Bewusstsein dessen gelangt der Mensch durch die religiöse Offenbarung; doch Sündenvergebung kann nur durch Gott geschehen, denn kein menschlicher Lehrer kann die göttliche Wahrheit vermitteln.[137] Dementsprechend stellt Glaube den Gegenbegriff zur Sünde dar.
Insgesamt kann der von Kierkegaard präsentierte Weg zur Selbstverwirklichung folgendermaßen skizziert werden: In der Angst, die dem Menschen seine spezifische Seinsweise realisieren lässt, erkennt das Individuum seine Sündhaftigkeit. Da diese durch die Entfremdung von der göttlichen Wahrheit verursacht ist, kann sie nur durch Bejahung derselben aufgehoben werden, woraus die Aufhebung der Entfremdung überhaupt und somit das Selbstsein folgt.[138] Während Kierkegaard in den „Philosophischen Brocken“ die göttliche Gnade als Vorbedingung für den Glaubenssprung betont, ist in der „Abschließenden unwissenschaftlichen Nachschrift“ davon keine Rede mehr, was den rein subjektiven Charakter der Glaubensannahme unterstreicht.
Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass das Religiöse über das Ethische hinausgeht. Anhand des alttestamentarischen Beispiels von Abrahams Bereitschaft zur Opferung seines Sohnes demonstriert Kierkegaard, dass der Glaube und das Handeln aufgrund einer religiösen Verpflichtung unter Umständen nach ethischen Gesichtspunkten als absurd bewertet werden muss, womit die Zweitrangigkeit ethischer Wertmaßstäbe im religiösen Stadium verdeutlicht wird.[139]
Auf ähnliche Weise beurteilt Kierkegaard Philosophie als „ Propädeutik der Religion “[140], die als Vorstufe die Möglichkeit zum Übergang zum „eigentlichen“ Existieren durch den Glauben bietet. Allerdings ermöglicht auch der Glaube keine Aufhebung des Zwiespaltes des menschlichen Daseins, sondern macht diesen Zwiespalt nur ertragbar. Kierkegaard sucht die Lösung für die menschlichen Probleme nicht im Jenseits, sondern rückt wiederum das Diesseits und die Wirklichkeit in den Vordergrund.[141]
Als ein weiterer wichtiger Aspekt Kierkegaards Philosophie bewerte ich die Konzeption der Wiederholung. Wie meine Darstellungen von Heidegger und Camus zeigen werden, ist der Existenzphilosophie die positive Konnotation gemeinsam. Während ein Mensch im ästhetischen Stadium Wiederholung als bloße Wiederkehr des Gleichen und als ein zu vermeidenden Vorgang betrachtet, sieht Kierkegaard in ihr eine Form, um ins religiöse Stadium zu gelangen. Wiederholung beinhaltet die Annahme der eigenen Kontinuität und bezeichnet nach Zimmermann
„die Bewegung, in der sich der Einzelne aus der Vergangenheit wieder holt, indem er sich zur Zukunft verhält, zur Forderung, mit dem Gott in der Zeit gleichzeitig zu werden und darin mit sich in der ewigen Bestimmung als Bild Gottes“[142],
womit einerseits die in der Wiederholung enthaltene Einheit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hervorgehoben und andererseits die enge Verbindung zum Glaubenssprung bestätigt wird, insofern sich Wiederholung als „ ein transzendierender Vorgang“[143] offenbart. Als „ die mutig bejahte Hinwendung zur Gegenwart, die das Alte miteinbezieht und noch als in Zukunft Gültiges vor sich stellt“[144] übernimmt das Individuum in der Wiederholung Verantwortung für sein gesamtes Leben.
Abschließend ist auf Kierkegaards Anspruch, weder allgemein gültige Richtlinien noch ein fixierbares Wissen zu verkünden, einzugehen. In der Tradition Sokrates’ intendiert Kierkegaard, als philosophischer „Geburtshelfer“ zu fungieren, der seine Leser zum selbstständigen Denken und dem Finden einer für ihn individuell geltenden Wahrheit anstiftet. Auf formaler Ebene geschieht dieses mit Hilfe verschiedener Pseudonyme und der unbewerteten Darstellung unterschiedlicher sich gegenseitig widersprechender Positionen.[145] Auf diese Weise tritt er als Autor hinter der im jeweiligen Werk vertretenen Meinung zurück und appelliert an die Beurteilungsfähigkeit der Leser, worin sich der Verzicht auf einen wissenschaftlichen Anspruch und die Subjektivität von Philosophie bestätigt.[146]
Analog beschreibt Kierkegaard den „subjektiven Denker“ als jemanden, der den Kontrast von Denken und Existieren zu einer Einheit zu bringen versucht, indem er das Abstrakte nur als Mittel zum Verständnis des Konkreten der menschlichen Existenz verwendet. Aufgrund des Wissens um die Subjektivität des Existierens ist die Mitteilungsform des subjektiven Denkers so beschaffen, dass der Gegenüber auf die eigene Beurteilung- und Entscheidungsfähigkeit verwiesen wird.[147] Sokrates Vorbildfunktion als subjektiver Denker par excéllènce besteht für Kierkegaard wesentlich in dessen Mitteilungsform, die durch die Dialogform die Prüfung des eigenen Wissens in den Vordergrund stellt.[148] Mit dem Grundgedanken, dass man niemals von einem „festen“ Wissens ausgehen könne, kann immer nur eine Approximation an die Wahrheit, womit ihr subjektiver Charakter unterstrichen wird, erreicht werden.[149] Dieses korrespondiert mit der von mir beschriebenen kierkegaardschen indirekten Mitteilungsform seiner Philosophie, die nur einen Rahmen für die persönlichen Antworten auf die Existenzfragen bieten kann.[150]
Abschließend ist bezüglich Kierkegaards Philosophie, die in der Annahme der christlichen Lehre die Voraussetzung zur Existenzverwirklichung sieht, die Betonung der religiösen Komponente zu unterstreichen, insbesondere dadurch dass dies eine deutliche Differenz zu den im Folgenden dargestellten existenzphilosophischen Positionen darstellt und auch in Hinblick auf die Analyse des Roman „Stiller“ besondere Relevanz hat.
5.2 Martin Heidegger
Martin Heidegger (1889–1976) kann nicht im engeren Sinne der Existenzphilosophie zugeordnet werden. Während sein Hauptwerk „Sein und Zeit“ (1927) noch von sowohl existenzphilosophischen als auch seinsphilosophischen Tendenzen geprägt ist, werden die existenzphilosophischen Überlegungen in Heideggers Denken nach 1930 in den Hintergrund gedrängt. In den Vordergrund tritt eine Philosophie des Seins, die dieses unmittelbar und nicht mehr über die Explikation des Wesen des Menschen als Existenz zu verstehen versucht[151], weshalb ich mich im Folgenden hauptsächlich auf „Sein und Zeit“ beziehen werde.
Obwohl deshalb eine generelle existenzphilosophische Interpretation Heideggers im traditionell moralisch-existentiellen Sinne in Frage zu stellen ist, werde ich in meiner Darstellung einzelner Existenzphilosophen Martin Heidegger behandeln. Dieses begründet sich einerseits in der Intention, eine möglichst facettenreiche Präsentation existenzphilosophischen Denkens zu bieten, andererseits in der Beschäftigung mit Doris Kiernans Untersuchung der heideggerschen Philosophie bezüglich des Werkes von Max Frisch. Die von Kiernan zur Basis genommene stark existenzphilosophisch-orientierte Deutung Heideggers ist in ihrer Richtigkeit zwar zu bezweifeln, zeigt jedoch die für meine Analyse relevanten Parallelen der existenzialen Themen Heideggers und Frisch.
Heideggers Hauptthema in seinem Werk „Sein und Zeit“ ist die Beschäftigung mit der „ Frage nach dem Sinn von Sein“[152] , die er selbst als „ die Fundamentalfrage“[153] bezeichnet. Um diese zu beantworten, nimmt Heidegger den Menschen zum Ausgangspunkt seiner Untersuchung.
Die Problematik des Seins besteht in seiner Verborgenheit im Gegensatz zur offensichtlichen Erscheinung der Seienden, unter deren Menge prinzipiell alles fällt.[154] Einen Einblick zum Verständnis und der damit verbundenen Schwierigkeit von Sein scheint mir Chul-Hans Definition zu geben:
„Das Sein erschafft zwar nicht das Seiende, aber es ermöglicht das Verstehen des Seienden, nämlich dessen Sinn. Das Sein ist kein Entstehungsgrund, sondern ein Verstehenshorizont, der ein verstehendes Sich-Verhalten zum jeweiligen Seienden erst möglich macht.“[155]
Sein ist gleichzeitig mit den Seienden anwesend sowie dem Seienden vorausgehend.[156]
Die Untersuchung des menschlichen Seins als Basis der Seinsanalyse ergibt sich für Heidegger aus der von ihm als „Dasein“ bezeichneten Sonderstellung des Menschen. Als solches ist er ein Seiendes, das sich sowohl zu seiner eigenen Existenz als auch zum Sein des Seienden überhaupt verhält und darüber hinaus die Frage nach dem Sein des Seienden stellt. Da der Mensch sich in seinem Sein bereits zu diesem verhält, kann bei ihm bereits ein gewisses vages Verständnis von Sein vorausgesetzt werden.[157] Heidegger definiert die Besonderheit des Menschen folgendermaßen:
„Das Dasein ist ein Seiendes, das nicht nur unter anderen Seienden vorkommt. Es ist vielmehr dadurch ontisch ausgezeichnet, daß es diesem Seienden in seinem Sein um dieses Sein selbst geht. Zu dieser Seinsverfassung des Daseins gehört aber dann, daß es in seinem Sein zu diesem Sein ein Seinsverhältnis hat. Und dies wiederum besagt: Dasein versteht sich in irgendeiner Weise und Ausdrücklichkeit in seinem Sein. Diesem Seienden eignet, daß mit und durch sein Sein dieses ihm selbst erschlossen ist. Seinsverständnis ist selbst eine Seinsbestimmtheit des Daseins. Die ontische Auszeichnung des Daseins liegt darin, daß es ontologisch ist.“[158]
Anzumerken ist in diesem Kontext, dass die Differenzierung der Begriffe „ontisch“ und „ontologisch“ erst seit Heidegger Relevanz hat, insofern sich „ontisch“ („seiend“) auf das zwar geistig erfasste aber noch nicht rational erschlossene Seiende und sich „ontologisch“ (ebenfalls „seiend“) auf das durch geistige Reflektion erschlossene Sein bezieht. Der Ausdruck „ontologische Differenz“ bezeichnet dementsprechend den Unterschied von Sein und Seiendem.[159]
Nach Heidegger kann man das Stellen der Frage nach dem Sein als Aufgabe der Existenz, wobei „Existenz“ ein weiterer von Heidegger benutzter Ausdruck zur Bezeichnung des Menschen ist, betrachten. Dieses geschieht in dem Auslegen der Grundstrukturen des Daseins, die Heidegger in ihrer Gesamtheit als „Existenzialität“ betitelt. Existenzialen – z. B. „In-der-Welt-sein“, „Mit-sein“, „Befindlichkeit“ und „Verstehen“ – sind die Strukturmomente des Daseins, welche man sich nicht als Eigenschaften, sondern als apriorische Grundverfassung des Daseins, also konstitutive Weisen, das „Da“ zu sein, zu denken hat.[160] Diese Strukturmomente des Daseins werde ich im Folgenden näher erläutern.
Die Verfassung des Menschen als Dasein bezeichnet Heidegger mit „In-der-Welt-sein“ bzw. mit dem Begriff der Transzendenz. Das In-der-Welt-sein hat dabei keine räumliche Bedeutung, sondern soll eine ursprüngliche Vertrautheit des Menschen mit der Welt – ein Seinsverständnis – ausdrücken.[161]
Dabei muss beachtet werden, dass der Begriff „Welt“ bei Heidegger nicht die Summe aller Seienden, sondern den Bedeutungszusammenhang bzw. „den Spielraum der Bedeutungen […], innerhalb dessen das einzelne Seiende seine Bedeutung erlangt “[162], meint.[163]
Das alltägliche In-der-Welt-sein ist der Umgang in der Welt mit dem innerweltlich Seienden, dem so genannten Zeug, das sich in verschiedenen Arten des Besorgens zeigt. – Unter Zeug fallen sowohl Dinge und Gebrauchsgegenstände wie Staubsauger, Werkzeug, Schreibzeug als auch natürlich Seiende wie die Sonne. Entscheidend ist der Zugang des Menschen zu ihnen durch den praktischen Gebrauch anstelle eines rein theoretischen Erkennens.[164]
Die Ganzheit des Daseins konstituiert sich aus drei ontologischen Charakteren: der Existenzialität, der Faktizität und dem Verfallensein.
Die Existenzialität impliziert, dass der Mensch sich von seinen Möglichkeiten – bzw. seinem Seinkönnen –, her versteht. Mit dem Terminus „Geworfenheit“ bezeichnet Heidegger die Faktizität des Menschen, insofern dieser nicht Urheber seines eigenen In-der-Welt-Seins ist. Verfallensein beinhaltet, dass der Mensch sich an die innerweltlich Seienden verliert und sich von ihnen her versteht und derart die Frage nach dem Sinn seines Seins vernachlässigt. Dabei gilt folgende Definition: „Dasein ist Sorge um sich, insofern es ihm um sein Sein als In-der-Welt-sein geht.“[165] Dieses gibt dem Menschen die Pflicht zur Entscheidung, zwischen Selbstannahme oder der Flucht vor sich selbst.
Gemäß der Konnotation der ursprünglichen menschlichen Seinsverfassung, dem In-der-Welt-Sein, betont Heidegger die Vorrangigkeit der Praxis zur Existenzverwirklichung im Gegensatz zum theoretischen Wissen: „Die Frage der Existenz ist immer nur durch das Existieren selbst ins Reine zu bringen.“[166] Bereits alltägliche Handlungen – beispielsweise der Umgang mit Zeug im Besorgen – können ein gewisses Seinsverständnis enthalten. Problematisch wird dieses „ursprüngliche“ Existieren durch die menschliche Tendenz zum „Verfallen“ an die Alltäglichkeit und der daraus resultierenden Entfremdung und Seinsvergessenheit, womit die Ambivalenz des Alltags offenbar wird: Der Angewiesenheit des Menschen auf Alltagssituationen steht die dem Alltag innewohnende Neigung, den Menschen von sich selbst und der Frage nach dem Sinn von Sein zu entfernen, gegenüber.
Diese von Heidegger mit „Man“, „Verfallen“, „fehlende Authentizität“, „Uneigentlichkeit“ und „Weltlosigkeit“ bezeichnete negative Seinsart des Alltags, von der sich das Subjekt zumeist nicht distanzieren kann, bietet dem Menschen durch das im Man vorgespiegelte Verständnis eine Einfachheit
„Das Seiende ist nicht völlig verborgen, sondern gerade entdeckt, aber zugleich verstellt; es zeigt sich – aber im Modus des Scheins. Im gleichen sinkt das vordem Entdeckte wieder in die Verstelltheit und Verborgenheit zurück. Das Dasein ist, weil wesenhaft verfallen, seiner Seinsverfassung nach in der ‘Unwahrheit’.“[167]
Die entfremdete Seinsweise – die Uneigentlichkeit – sowie die mit Eigentlichkeit bezeichnete Existenzverwirklichung zeigen sich anhand verschiedener Aspekte. Während der Mensch im eigentlichen Existieren sich die Welt immer wieder aufs Neue zu erschließen hat, gibt ihm das „Aufgehen“ im Man die Möglichkeit zum „blinden“ Handeln nach vorgegebenen Gesetzen. Die Simplizität dieses Lebens folgt aus der Entbindung von jeglicher individueller Entscheidung und Verantwortlichkeit. Die „ öffentliche Ausgelegtheit“[168] gibt dem Individuum die Beruhigung, die ihm vom eigenen Verstehen seiner ihm offen stehenden Möglichkeiten abhält. Im Man befreit sich das Subjekt von der Last seiner Existenz, die sich in seiner Geworfenheit begründet.[169]
Die Geworfenheit des Menschen ist folgendermaßen zu kennzeichnen: „ ‘Daß es ist’ nennen wir die Geworfenheit dieses Seienden in sein Da, so zwar, daß es als In-der-Welt-sein das Da ist.“[170] – Des Weiteren sind die drei Charakteristika der Geworfenheit zu konstatieren. Erstens ist der Mensch nicht Urheber seines In-der-Welt-seins, sondern „ist“, wobei die Frage nach dem Ursprung offen bleibt. Heidegger stellt fest: „ Die Geworfenheit aber liegt nicht hinter ihm als ein tatsächlich vorgefallenes und vom Dasein wieder losgefallenes Ereignis, das mit ihm geschah, sondern das Dasein ist ständig – solange es ist – als Sorge sein ‘Daß’.“[171] Das heißt, dass Geworfenheit nicht als vergangenes Ereignis erachtet werden kann. Daraus ergibt sich zweitens die Aussage: „Man muß sein“, womit die Freiheit und Verantwortlichkeit des Menschen für seine eigene Existenz verdeutlicht wird[172], insofern „der Ausdruck Geworfenheit […] die Faktizität der Überantwortung andeuten [soll].“[173] Drittens ist festzustellen, dass diese Freiheit nicht Absolutheitswert besitzt, was die Angewiesenheit auf die Welt bestätigt. Diese impliziert die Abhängigkeit und Notwendigkeit von Mitmenschen und Zeug und damit die menschliche Unvollkommenheit, die wesentlich im Faktum der Sterblichkeit zum Ausdruck kommt.
Die angedeutete Verantwortung des Menschen ist die Forderung an jeden Einzelnen „zu sein“, wobei die aus der Geworfenheit resultierende Verantwortung als negativ empfunden wird.
„Als dieses Seiende, dem überantwortet es einzig als das Seiende, das es ist, existieren kann, ist es existierend der Grund seines Seinkönnens. Ob es den Grund gleich selbst nicht gelegt hat, ruht es in seiner Schwere, die ihm die Stimmung als Last offenbar macht.“[174]
Dass dem Dasein aufgrund der in seiner Faktizität impliziten Endlichkeit nur eine begrenzte Anzahl von Seinsmöglichkeiten zur Verfügung steht, unterstreicht die Tatsache des Todes.
Diesen sieht Heidegger nicht nur als das biologisch punktuelle Ereignis des Lebensendes, sondern der Tod betont für ihn vielmehr die Notwendigkeit des Menschen, sich ständig in seinem Dasein zu seiner Endlichkeit zu verhalten.[175] „Das ‘Ende’ des In-der-Welt-seins ist der Tod. Dieses Ende, zum Seinkönnen, das heißt zur Existenz gehörig, begrenzt und bestimmt die je mögliche Ganzheit des Daseins. “[176] Aufgrund dessen bezeichnet Heidegger als wesentliche Seinsart „das Sein zum Tod“, das er wie folgt beschreibt:
„So wie das Dasein vielmehr ständig, solange es ist, schon sein Noch-nicht ist, so ist es auch schon immer sein Ende. Das mit dem Tod gemeinte Enden bedeutet kein Zu-Ende-sein des Daseins, sondern ein Sein zum Ende dieses Seienden. Der Tod ist eine Weise zu sein, die das Dasein übernimmt, sobald es ist.“[177]
Dabei ist „ der Tod […] eine Seinsmöglichkeit, die je das Dasein selbst zu
übernehmen hat.“[178] Das bedeutet, dass der Tod immer Sache des Einzelnen ist, wobei Hilfe oder Übernahme durch einen Anderen ausgeschlossen ist. Keiner kann dem Anderen sein Sterben abnehmen.
„Das Sterben muß jedes Dasein jeweilig selbst auf sich nehmen. Der Tod ist, sofern er ‘ist’, wesensmäßig je der meine. Und zwar bedeutet er eine eigentümlich Seinsmöglichkeit, darin es um das Sein des je eigenen Daseins schlechthin geht. Am Sterben zeigt sich, daß der Tod ontologisch durch Jemeinigkeit und Existenz konstituiert wird.“[179]
Im eigentlichen Existieren muss das Individuum sich seinem Tod stellen. Eine Flucht in die Alltäglichkeit des Man ist unmöglich, denn der Tod bzw. das Sein zum Tod isoliert das Subjekt.
Im Gegensatz dazu wird der Tod im Man zu einem bloßen Vorkommnis nivelliert, das nicht auf das je eigene Dasein bezogen wird.[180]
„Daß ‘man stirbt’ verbreitet die Meinung, der Tod treffe gleichsam das Man. Die öffentliche Daseinsauslegung sagt: ‘man stirbt’, weil damit jeder andere und man selbst sich einreden kann: je nicht gerade ich; denn dieses Man ist das Niemand.“[181]
Wie bereits angedeutet, begrenzt der Tod die Freiheit der menschlichen Existenz, indem er als Ende des Lebens weitere Handlungs- bzw. Veränderungsmöglichkeiten unmöglich macht. Aufgrund dessen bezeichnet Heidegger den Tod als „ unüberholbare Möglichkeit “[182] oder „ die Möglichkeit der schlechthinnigen Daseinsunmöglichkeit.“[183]
Während uneigentliches Verhalten primär durch Verdrängung des Todes, indem die Flucht ins Man dem Dasein Beruhigung verschafft, gekennzeichnet ist, ist eigentliches Verhalten zum Tod wesentlich durch Angst charakterisiert.[184] Diese ist bei Heidegger im Gegensatz zur Furcht gegenstandslos und kann als menschliche Wesenseigenschaft bezeichnet werden, insofern sich das Individuum „ ‘vor’ dem eigensten, unbezüglichen und unüberholbaren Seinkönnen“[185] – dem In-der-Welt-sein und dem darin enthaltenen Sein zum Tode – ängstigt. „ Wenn sich demnach als das Wovor der Angst das Nichts, das heißt die Welt als solche herausstellt, dann besagt das: wovor die Angst sich ängstet, ist das In-der-Welt-sein selbst.“[186] – Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Tatsache des Todes sich wesentlich in der Angst zeigt, wobei diese nicht die alltägliche Angst vorm Sterben, sondern das ständige Wissen um die in jedem Augenblick anwesende Möglichkeit des Endes, insofern „ das Dasein als geworfenes Sein zu seinem Ende existiert “[187], meint.
Indem „die Angst […] das Dasein aus seinem verfallenden Aufgehen in der ‘Welt’ zurück[holt].“[188], muss das Individuum die Unheimlichkeit des In-der-Welt-seins realisieren und kann nicht länger auf das im Man suggerierte Wissen zurückgreifen. Damit offenbart die Angst dem Menschen seine Möglichkeiten und stellt ihn vor die Möglichkeit seiner Selbstwahl[189], so dass die Angst als Bewusstwerdung der eigenen Verantwortlichkeit die Vorstufe zum eigentlichen Existieren bilden kann.
Die Erkenntnis des Todes ist Ursprung der Angst, aus der wiederum die Möglichkeit des Gewissenrufes – dem „ Ruf der Sorge “[190] – resultiert. Dieser präsentiert dem Dasein seine eigene Nichtigkeit, die Heidegger mit Schuldigkeit gleichsetzt. Der Gewissensruf ist vor allem durch seine inhaltliche Leere, die keine Forderungen stellt, gekennzeichnet.[191] Auf diese Weise wird der Mensch zur Annahme seiner Nichtigkeit und zum eigentlichen Existieren, welches inhaltlich nicht näher definiert ist, aufgefordert. Wie dieses Existieren auszusehen hat, muss der Einzelne selbst entscheiden und wählen. Heidegger beschreibt den Gewissensruf folgendermaßen:
„In der Unheimlichkeit steht das Dasein ursprünglich mit sich selbst zusammen. Sie bringt dieses Seiende vor seine unverstellte Nichtigkeit, die zur Möglichkeit seines eigensten Seinkönnens gehört. Sofern es dem Dasein – als Sorge – um sein Sein geht, ruft es aus der Unheimlichkeit sich selbst als faktisch-verfallendes Man auf zu seinem Seinkönnen. Der Anruf ist vorrufender Rückruf, vor: in die Möglichkeit, selbst das geworfene Seiende, das es ist, existierend zu übernehmen, zurück: in die Geworfenheit, um sie als den nichtigen Grund zu verstehen, den es in die Existenz aufzunehmen hat. Der vorrufende Rückruf des Gewissens gibt dem Dasein zu verstehen, daß es – nichtiger Grund seines nichtigen Entwurfs in die Möglichkeit seines Seins stehend – aus der Verlorenheit in das Man sich zu ihm selbst zurückholen soll, das heißt schuldig ist.“[192]
Heideggers Schuldbegriff bezieht sich auf eine generelle Schuldhaftigkeit des Menschen, die sich nicht in konkreten Handlungen oder Unterlassungen manifestiert und deshalb mit Kierkegaards Interpretation von Schuld gleichgesetzt werden kann.[193] Des Weiteren ist die Annahme des Gewissenrufes bei Heidegger mit der Kierkegaards Selbstwahl vergleichbar, was folgende Passage verdeutlicht:
„Das rechte Hören des Anrufes kommt dann gleich einem Sichverstehen in seinem eigensten Seinkönnen, das heißt dem Sichentwerfen auf das eigenste eigentliche Schuldigwerdenkönnen. Das verstehende Sichvorrufenlassen auf diese Möglichkeit schließt in sich das Freiwerden des Daseins für den Ruf: die Bereitschaft für das Angerufenwerdenkönnen. Das Dasein ist rufverstehend hörig seiner eigensten Existenzmöglichkeit. Es hat sich selbst gewählt.“[194]
Die Annahme der eigenen Sterblichkeit und Schuldhaftigkeit gibt dem Menschen Wahlfreiheit, die sich als paradox herausstellt, denn sie beschränkt sich auf die durch die menschliche Faktizität vorgegebenen Möglichkeiten.
„Das vorlaufende Freiwerden für den eigenen Tod befreit von der Verlorenheit in die zufällig sich andrängenden Möglichkeiten, so zwar, daß es die faktischen Möglichkeiten, die der unüberholbaren vorgelagert sind, allererst eigentlich verstehen und wählen läßt.“[195]
Korrespondierend mit Kierkegaards Übergang vom ästhetischen ins ethische Stadium verhindert die Bejahung der Begrenztheit des Lebens das „Verlieren“ im bloßen Bereich des Möglichen und verhilft durch das Verständnis der seinem Wesen innewohnenden Möglichkeiten zu einer bewussten Entscheidung und wirklicher Freiheit. Das Gewissen dient nicht der Befreiung von der Schuldhaftigkeit, sondern das Gewissen-haben-wollen besteht gerade in der Annahme derselben.[196]
Insgesamt ist zu erkennen, dass für Heidegger das Todesverhalten konstitutiv für die eigentliche Existenzverwirklichung ist. – Zusammengefasst lässt sich mit Heideggers eigenen Worten sagen:
„Das Sein zum Tode ist Vorlaufen in ein Seinkönnen des Seienden dessen Seinsart das Vorlaufen selbst ist. Im vorlaufenden Enthüllen dieses Seinkönnens erschließt sich das Dasein ihm selbst hinsichtlich seiner äußersten Möglichkeit. Auf eigenstes Seinkönnen sich entwerfen aber besagt: sich selbst verstehen können im Sein des so enthüllten Seienden: existieren. Das Vorlaufen erweist sich als Möglichkeit des Verstehens des eigensten äußersten Seinkönnens, das heißt als Möglichkeit eigentlicher Existenz.“[197]
Ein weiterer Aspekt, der mir gerade hinsichtlich der späteren Analyse des Romans „Stiller“ wichtig erscheint, ist Heideggers Analyse des menschlichen Sozialverhaltens.
Für Heidegger ist das Dasein und In-der-Welt-sein zugleich immer durch die Begegnung mit Anderen konstituiert, was er „Mit-sein“ nennt, denn: „Die Welt des Daseins ist Mitwelt . Das In-Sein ist Mitsein mit Anderen.“[198] Das Verhältnis zur Mitwelt nennt Heidegger „Fürsorge“, die sich sowohl positiv durch „Rücksicht“, „Nachsicht“, Liebe oder Achtung als auch negativ im Sinne von Rücksichtslosigkeit und Gleichgültigkeit ausdrücken kann.[199] Damit ist angedeutet, dass zwischenmenschliche Beziehungen sowohl eigentlichen als auch uneigentlichen Charakter haben können. Im Man kommt es zu keiner positiven Fürsorge, insofern der jeweils Andere zum bloßen Gegenstand nivelliert wird.[200] Darüber hinaus ist das mitmenschliche Verhältnis untereinander durch leeres Gerede, Neugier und Zweideutigkeit gekennzeichnet.[201] Diesem stehen Verstehen, Sprechen, Hören und Sehen in der Eigentlichkeit gegenüber. So deutet Heidegger das eigentliche Hören folgendermaßen:
„Das Hören auf … ist das existenziale Offensein des Dasein als Mitsein für den Anderen. Das Hören konstituiert sogar die primäre und eigentliche Offenheit des Daseins für sein eigenstes Seinkönnen, als Hören der Stimme des Freundes, den jedes Dasein bei sich trägt. Das Dasein hört, weil es versteht.“[202]
Parallel dazu ist das Gerede des Man dem Schweigen entgegengesetzt:
„Wer im Miteinander schweigt, kann eigentlicher ‘zu verstehen geben’, das heißt das Verständnis ausbilden, als der, dem das Wort nicht ausgeht. Mit dem Viel-sprechen über etwas ist nicht im mindesten gewährleistet, daß dadurch das Verständnis weiter gebraucht wird. Im Gegenteil: das weitläufige Bereden verdeckt und bringt das Verstandene in die Scheinklarheit, das heißt Unverständlichkeit der Trivialität. Schweigen heißt aber nicht stumm sein.“[203]
Darüber hinaus markiert Heideggers Terminus „Sein-lassen“ ein wichtiges Merkmal eigentlichen Mit-seins. „ Das hier nötige Wort vom Sein-lassen […] denkt jedoch nicht an Unterlassung und Gleichgültigkeit, sondern an das Gegenteil. Sein-lassen ist das Sicheinlassen auf das Seiende“.[204] Insgesamt ist festzustellen, dass eigentliches Mit-sein vorrangig durch gegenseitige Offenheit und Verständnis geprägt ist, insofern der Gegenüber nicht in seiner Freiheit und Existenz eingeschränkt oder bedrängt wird.
Auf dieser Grundlage lässt sich weder sagen, dass der soziale Umgang die eigene Existenzverwirklichung unmöglich macht, noch dass Einsamkeit und Isolation zur Eigentlichkeit führen. Generell ist bei Heidegger allerdings eine Tendenz zur Abwertung des Mitsein erkennbar, denn der Weg zur Eigentlichkeit führt zumeist über die individuelle Vereinzelung, die aus der Erfahrung des Todes und der Angst resultiert.[205] Möglich ist der Weg im Miteinander zur Eigentlichkeit für Heidegger nach Lübckes Interpretation nur, „wenn sich das Sein auf eine ursprüngliche Weise offenbart, indem zwei oder mehr Menschen zusammen die Angst durchleben und sich dadurch einen neuen Bedeutungsspielraum des Seienden eröffnen […].“[206]
[...]
[1] Zitiert nach: Arnold, Heinz Ludwig: Gespräche mit Schriftstellern. Max Frisch, Günter Grass, Wolfgang Koeppen, Max von der Grün, Günter Wallraff, München 1975, S. 44. (Im Folgenden zitiert als: Arnold, Gespräche.)
[2] Insbesondere Jurgensen betont die doppelte Dimension der Romanthemen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. (Jurgensen, Manfred: Max Frisch. Die Romane. Interpretationen, 2., erweiterte Auflage, Bern 1976, S. 84–85. (Im Folgenden zitiert als: Jurgensen, Romane.)
[3] Frisch, Stiller, S. 361.
[4] Eine solche Sichtweise findet sich u.a. bei Gunda Lusser-Mertelsmann, Helmut Naumann, Jürgen H. Petersen, Walter Schmitz, Alexander Stephan und Monika Wintsch-Spiess.
[5] Zitiert nach: Arnold, Gespräche, S. 44.
[6] Beispielsweise wären die Standpunkte von Karl Jaspers und Gabriel Marcel als christlich-orientierte Existenzphilosophen gerade in Hinblick auf Sören Kierkegaard interessant.
[7] Kiernan, Doris: Existenziale Themen bei Max Frisch. Die Existenzphilosophie Martin Heideggers in den Romanen Stiller, Homo faber und Gantenbein, Berlin/New York 1978. (Im Folgenden zitiert als: Kiernan, Existenziale Themen.)
[8] Stephan, Alexander: Max Frisch. München 1983, S. 68. (Im Folgenden zitiert als: Stephan, Frisch.)
[9] Vlg. Frisch, Max: Tagebuch 1946–1949. In: Frisch, Max: Gesammelte Werke in zeitlicher Folge 1931–1985. Band II 1944–1949. Herausgegeben von Hans Mayer unter Mitwirkung von Walter Schmitz, Frankfurt am Main 1998, S. 347–755, S. 584–585. (Im Folgenden zitiert als: Frisch, Tagebuch 1946–1949.)
[10] Vlg. Schwenke, Walburg: Leben und Schreiben. Max Frisch – Eine produktionsästhetische Auseinandersetzung mit seinem Werk, Frankfurt am Main/Bern 1983, S. 35–46. (Im Folgende zitiert als: Schwenke, Leben und Schreiben.)
[11] Vlg. Petersen, Carol: Max Frisch. 6., ergänzte Auflage, Berlin 1978, S. 22. (Im Folgenden zitiert als: C. Petersen, Frisch.)
[12] Stephan, Frisch, S. 38.
[13] Vlg. Waleczek, Lioba: Max Frisch. München 2001, S. 16–18, 25. (Im Folgenden zitiert als: Waleczek, Frisch.)
[14] Vlg. Bircher, Urs: Vom langsamen Wachsen eines Zorns. Max Frisch 1922–1955, Zürich 1997, S. 26–27. (Im Folgenden zitiert als: Bircher, Zorn.)
[15] Zitiert nach: Waleczek, Frisch, S. 15.
[16] Zitiert nach: Waleczek, Frisch, S. 15.
[17] Waleczek, Frisch, S. 99.
[18] Vlg. Waleczek, Frisch, S. 152–153.
[19] Reich-Ranicki, Marcel: Der Dichter der Angst. 1963. In: Reich-Ranicki, Marcel: Max Frisch. Aufsätze, Zürich 1991, S. 13–36, S. 14. (Im Folgenden zitiert als Reich-Ranicki, Dichter.)
[20] Vlg. Reich-Ranicki, Dichter, S. 13–14, 17.
[21] Stäuble, Eduard: Max Frisch. Gedankliche Grundzüge in seinen Werken, 3., erweiterte Auflage, Basel 1974, S. 12 (im Folgenden zitiert als: Stäuble, Frisch) und vlg. Bänzinger, Hans: Frisch und Dürrenmatt. 7. neu bearbeitete Auflage, Bern/München 1976, S. 39. (Im Folgenden zitiert als: Bänzinger, Frisch/Dürrenmatt.)
[22] Vlg. beispielsweise Petersen, Jürgen H.: Max Frisch. 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage, Stuttgart/Weimar 2002, S. 6. (Im Folgenden zitiert als: J. Petersen, Frisch.)
[23] Max Frisch schickte eines seiner ersten Stücke an Max Reinhard. – Vlg. Bircher, Zorn,
S. 29.
[24] Bircher, Zorn, S. 36.
[25] Vlg. Bircher, Zorn, S. 26, 29–30, 36.
[26] Frisch, Max: Was bin ich? (I), 1932. In: Frisch, Max: Gesammelte Werke in zeitlicher Folge 1931–1985. Band I 1931–1944. Herausgegeben von Hans Mayer unter Mitwirkung von Walter Schmitz, Frankfurt am Main 1998, S. 10–15, S. 12.
[27] Vlg. Schwenke, Walburg: Leben und Schreiben. Max Frisch – Eine produktionsästhetische Auseinandersetzung mit seinem Werk, Frankfurt am Main/Bern 1983, S. 269–276. (Im Folgenden zitiert als: Schwenke, Leben und Schreiben.)
[28] Zitiert nach: Arnold, Gespräche, S. 44.
[29] Vlg. Arnold, Gespräche, S. 44.
[30] Zitiert nach: Arnold, Gespräche, S. 45 und vlg. Bienek, Horst: Werkstattgespräche mit Schriftstellern. 3. vom Autor durchgesehene und erweiterte Auflage, München 1976,
S. 29–30. (Im Folgenden zitiert als: Bienek, Werkstattgespräche.)
[31] Naumann, Helmut: Der Fall Stiller. Antwort auf eine Herausforderung. Zu Max Frischs „Stiller“, Rheinfelden 1978, S. 185–186 (im Folgenden zitiert als: Naumann, Fall Stiller) und vlg. Kiernan, Existenziale Themen, S. 67.
[32] Vlg. Bänzinger, Frisch/Dürrenmatt, S. 38 und Stäuble, Frisch S. 35–41.
[33] Zitiert nach: Bloch, Peter André/Hubacher, Edwin (Hrsg.): Der Schriftsteller in unserer Zeit. Schweizer Autoren bestimmen ihre Rolle in der Gesellschaft. Eine Dokumentation zu Sprache und Literatur der Gegenwart, Bern 1972, S. 23–24 und vlg. 21 (im Folgenden zitiert als: Bloch/Hubacher, Schriftsteller), sowie Arnold, Gespräche, S. 67.
[34] Vlg. Stephan, Frisch, S. 42–43; Jaques-Bosch, Bettina: Kritik und Melancholie im Werk Max Frischs. Zur Entwicklung einer für die Schweizer Literatur typischen Dichotomie, Bern/Frankfurt am Main/Nancy/New York 1984, S. 94–98 (im Folgenden zitiert als: Jaques-Bosch, Kritik und Melancholie); Lüthi, Hans Jürg: Max Frisch. „Du sollst dir kein Bildnis machen“, München 1981, S. 136 (im Folgenden zitiert als: Lüthi, Bildnis) und J. Petersen, Frisch, S. 16.
[35] Wie ich im 2. Teil, Kapitel 2.11.1 näher darlegen werden, ist die Vermeidung von Erstarrungen jeglicher Art eine von Frischs Hauptintentionen.
[36] Reich-Ranicki, Dichter, S. 17; vlg. Arnold, Gespräche, S. 48 und Kieser, Rolf: Max Frisch. Das literarische Tagebuch, Frauenfeld/Stuttgart 1975, S. 154. (Im Folgenden zitiert als: Kieser, Literarisches Tagebuch.)
[37] Frisch, Tagebuch 1946–1949, S. 632 und vlg. 444–445.
[38] Frisch, Max: Mein Name sei Gantenbein. In: Frisch, Max: Gesammelte Werke in zeitlicher Folge 1931–1985. Band V 1964–1967. Herausgegeben von Hans Mayer unter Mitwirkung von Walter Schmitz, Frankfurt am Main 1998, S. 5–320. S. 68. (Im Folgenden zitiert als: Frisch, Gantenbein.)
[39] Vlg. Stephan, Frisch, S. 47 und Frisch, Tagebuch 1946–1949, S. 600–601.
[40] Vlg. Kieser, Literarisches Tagebuch, S. 23.
[41] Zitiert nach: Bienek, Werkstattgespräche, S. 26–27.
[42] Vlg. Stephan, Frisch, S. 45.
[43] Vlg. Frisch, Tagebuch 1946–1949, S. 360–361.
[44] Frisch, Tagebuch 1946–1949, S. 378–379. – Auf den Aspekt der Nicht-Darstellbarkeit von Wahrheit bzw. Frischs generellen Skepsis gegenüber solchen Abbildungen werde ich im
2. Teil in Kapitel 2.10 eingehen.
[45] Vlg. Frisch, Tagebuch 1946–1949, S. 448, 634; Kieser, Literarisches Tagebuch, S. 21–22, 66–67 und Hanhart, Tildy: Max Frisch: Zufall, Rolle und literarische Form. Interpretationen zu seinem neueren Werk, Kronberg/Ts. 1976, S. 4–7, 109–110. (Im Folgenden zitiert als: Hanhart, Frisch.)
[46] Für eine genauere Analyse vlg. Egger, Richard: Der Leser im Dilemma. Die Leserrolle in Max Frischs Romanen „Stiller“, „Homo faber“ und „Mein Name sei Gantenbein“, Bern/Frankfurt am Main/New York 1986, beispielsweise S. 214–216, 225–228, 230–232. (Im Folgenden zitiert als: Egger, Leserrolle.)
[47] Frisch, Tagebuch 1946–1949, S. 586.
[48] Zitiert nach: Arnold, Gespräche, S. 13.
[49] Schmitz, Walter: Max Frisch: Das Werk (1931–1961). Studien zu Tradition und Traditionsverarbeitung, Bern/Frankfurt am Main/New York 1985, S. 68–69. (Im Folgenden zitiert als: Schmitz, Tradition.)
[50] Vlg. J. Petersen, Frisch, S. 10–19 und vlg. zur Form des indirekten Rezipierens 2. Teil, Kapitel 2.9 und Stiller, S. 535–536.
[51] Vlg. Frisch, Tagebuch 1946–1949, S. 374.
[52] Bloch/Hubacher, Schriftsteller, S. 21-22.
[53] Zitiert nach: Schmitz, Walter „Zur Entstehung von Max Frischs Roman „Stiller“. In: Ders. (Hrsg.): Materialien zu Max Frisch „Stiller“. Erster Band, 1. Auflage, Frankfurt am Main, 1978, S. 29–34, 34.
[54] Vlg. Schmitz, Tradition; S. 251.
[55] Vlg. Stemmler, Wolfgang: Max Frisch, Heinrich Böll und Sören Kierkegaard. München 1972, S. 1–5, 15 (im Folgenden zitiert als: Stemmler, Frisch Böll Kierkegaard) und J. Petersen, Max Frisch, S. 17.
[56] Vlg. Frisch, Stiller, S. 536.
[57] J. Petersen, Frisch, S. 13.
[58] Vlg. Kiernan, Existenziale Themen, S. 1.
[59] Vlg. Kiernan, Existenziale Themen S. 3–4.
[60] Kiernan, Existenziale Themen, S. 6.
[61] Vlg. Kiernan, Existenziale Themen, S. 6–7.
[62] Hügli, Anton/Lübcke, Poul (Hrsg.): Philosophielexikon. Personen und Begriffe der abendländischen Philosophie von der Antike bis zur Gegenwart, 5. Auflage, Reinbek 2003,
S. 195. (Im Folgenden zitiert als: Hügli/Lübcke, Philosophielexikon.)
[63] Demgegenüber steht die Ansicht Zimmermanns, der das Vorhandensein einer „einheitlichen Existenzphilosophie“ bestreitet und als einzige Gemeinsamkeit aller existenzphilosophischen Strömungen die Ablehnung der traditionellen Metaphysik betont. – Vlg. Zimmermann, Franz: Einführung in die Existenzphilosophie. Darmstadt 1977, S. 1–2. (Im Folgenden zitiert als: Zimmermann, Existenzphilosophie.)
[64] Hügli/Lübcke, Philosophielexikon, S. 195.
[65] Vlg. Redaktion für Philosophie des Bibliographischen Instituts (Hrsg.): Schülerduden „Die Philosophie“. Mannheim, Wien, Zürich 1985, S. 135. (Im Folgenden zitiert als: Schülerduden Philosophie.)
[66] Hügli/Lübcke, Philosophielexikon, S. 195.
[67] Vlg. Seibert, Thomas: Existenzialismus. Hamburg 2000, S. 92. (Im Folgenden zitiert als: Seibert, Existenzialismus.)
[68] Schülerduden Philosophie, S. 136.
[69] Ebd.
[70] Vlg. Zimmermann, Existenzphilosophie, S. 5.
[71] Seibert, Existenzialismus, S. 92.
[72] Pieper, Annemarie: Søren Kierkegaard. München 2000, S. 9. (Im Folgenden zitiert als: Pieper, Kierkegaard.)
[73] Vlg. Pieper, Kierkegaard, S. 9, 38.
[74] Schneiders, Werner: Deutsche Philosophie im 20. Jahrhundert. München 1998, S. 87. (Im Folgenden zitiert als: Schneiders, Dt. Philosophie.)
[75] Schneiders, Dt. Philosophie, S. 87.
[76] Beispielsweise als Naturnotwendigkeiten Entstehung, Entwicklung und Tod.
[77] Hügli/Lübcke, Philosophielexikon, S. 347.
[78] Vlg. Hügli/Lübcke, Philosophielexikon, S. 347.
[79] Zimmermann, Existenzphilosophie, S. 16.
[80] Diese idealistische Tendenz manifestiert in der Betonung der menschlichen Abhängigkeit von einer absoluten – letztlich jedoch unverständlich bleibenden – Transzendenz, die aber nicht (in allen Fällen) mit dem traditionell christlichen Gott gleichgesetzt werden darf.
[81] Vlg. Schneiders, Dt. Philosophie, S. 88.
[82] Vlg. Schülerduden, S. 135 und Hügli/Lübcke, Philosophielexikon, S. 195–196, 347.
[83] Pieper, Kierkegaard, S. 7–8.
[84] Kierkegaard, Sören: Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift zu den Philosophischen Brocken Zweiter Teil In: Hirsch, Emanuel/Gerdes, Hayo/Junghans, Hans Martin (Hrsg.): Sören Kierkegaard. Gesammelte Werke 16. Abteilung, Gütersloh 1982, S. 32 (im Folgenden zitiert als: Kierkegaard, Nachschrift Teil 2) und vlg. Kim, Madeleine: Der Einzelne und das Allgemeine. Zur Selbstverwirklichung des Menschen bei Sören Kierkegaard, München, Wien 1980, S. 30, 33. (Im Folgenden zitiert als: Kim, Einzelne und Allgemeine.)
[85] Vlg. Schneiders, Dt. Philosophie, S. 36.
[86] Vlg. Kim, Einzelne und Allgemeine, S. 33.
[87] Vlg. Kierkegaard, Nachschrift Teil 2, S. 35.
[88] Vlg. Kierkegaard, Nachschrift Teil, S. 32 und Kim, Einzelne und Allgemeine, S. 30, 33.
[89] Vlg. Kierkegaard, Nachschrift Teil 2, S. 15, 96.
[90] Vlg. Kierkegaard, Nachschrift Teil, S. 17.
[91] Vlg. Kierkegaard, Nachschrift Teil 2, S. 16, 19.
[92] Stemmler, Frisch Böll Kierkegaard, S. 17.
[93] Vlg. Schulz, Kierkegaard, S. 300 und vlg. Zimmermann, Existenzphilosophie, S. 23–24, 26.
[94] Vlg. Gardiner, Patrick: Kierkegaard. Freiburg im Breisgau 2001, S. 132–135 (im Folgenden zitiert als: Gardiner, Kierkegaard) und Zimmermann, Existenzphilosophie, S. 27.
[95] Vlg. Kierkegaard, Nachschrift Teil, S. 1–3, 12, 16, 19, 27, 55.
[96] Vlg. Kim, Einzelne und Allgemeine, S. 49–51.
[97] Eine Leidenschaft von irdischer Art würde die Existenz nur in Augenblicke verwandeln und somit das wesentliche Moment des Existierens – die Spannung zwischen Ewigem und Augenblicklichem – vernachlässigen.
[98] Kierkegaard, Nachschrift Teil 2, S. 13.
[99] Ebd.
[100] Vlg. Pieper, Kierkegaard, S. 54.
[101] Zimmermann, Existenzphilosophie, S. 35.
[102] Vlg. Kierkegaard, Nachschrift Teil 2, S. 12–13. – Kierkegaard demonstriert die Unterschiedlichkeit von verschiedenen Existierenden anhand des Beispiels verschiedener Arten von Kutschern.
[103] Zimmermann, Existenzphilosophie, S. 39.
[104] Kierkegaard, Søren: Der Begriff Angst. Übersetzt von G. Perlet, 7. Auflage, Stuttgart 1992, S. 181.
[105] Vlg. Gardiner, Kierkegaard, S. 135–140 und Schneiders, Dt. Philosophie, S. 37.
[106] Zur ausführlichen Darstellung der verschiedenen Existenzstadien vlg. beispielsweise Pieper, Kierkegaard, S. 60–99 und Kim, Einzelne und Allgemeine, S. 75–102.
[107] Vlg. Gardiner, Kierkegaard, S. 61.
[108] Vlg. Zimmermann, Existenzphilosophie, S. 36–37.
[109] Lüthi, Bildnis, S. 160.
[110] Vlg. Kierkegaard, Sören: Entweder-Oder, Teil I und II. Übersetzt von H. Fauteck, 7. Auflage, München 2003, S. 400, 464 (im Folgenden zitiert als: Kierkegaard, Entweder-Oder) und vlg. zur allg. Darstellung der ästhetischen Lebensform: Gardiner, Kierkegaard, S. 61–65.
[111] Kierkegaard, Entweder-Oder, S. 381.
[112] Kierkegaard, Entweder-Oder, S. 33.
[113] Vlg. Kierkegaard, Entweder-Oder, S. 351–521.
[114] Kierkegaard, Entweder-Oder 1, S. 429.
[115] Vlg. Lüthi, Bildnis, S. 160 und Gardiner, Kierkegaard, S. 62–63.
[116] Kierkegaard, Entweder-Oder, S. 38.
[117] Kierkegaard, Entweder-Oder, S. 30.
[118] Vlg. Kierkegaard, Nachschrift Teil 2, S. 21.
[119] Gardiner, Kierkegaard, S. 67.
[120] Vlg. Gardiner, Kierkegaard, S. 67–72.
[121] Kierkegaard, Entweder-Oder, S. 623.
[122] Vlg. Kierkegaard, Entweder-Oder, S. 531.
[123] Vlg. Kierkegaard, Entweder-Oder, S. 566–567 (und siehe weiter unten).
[124] Vlg. Kierkegaard, Nachschrift Teil 2, S. 21, 96–138, 141, 143–144.
[125] Kierkegaard, Nachschrift Teil 2, S. 281.
[126] Kierkegaard, Nachschrift Teil 2, S. 28.
[127] Vlg. Kierkegaard, Nachschrift Teil 2, S. 29, 281, und Zimmermann, Existenzphilosophie,
S. 33–34.
[128] Vlg. Gardiner, Kierkegaard, S. 90–91, 95–96, 98, 122.
[129] Vlg. Kierkegaard, Nachschrift Teil 2, S. 67–89, 314, 324–325.
[130] Kierkegaard, Nachschrift Teil 2, S. 324–325.
[131] Vlg. Gardiner, Kierkegaard, S. 116–118.
[132] Vlg. Gardiner, Kierkegaard, S. 142–143.
[133] Zimmermann, Existenzphilosophie, S. 32 und vlg. 31–32.
[134] Vlg. Gardiner, Kierkegaard, S. 124–131.
[135] Schneiders, Dt. Philosophie, S. 34.
[136] Gardiner, Kierkegaard, S. 138.
[137] Vlg. Zimmermann, Existenzphilosophie, S. 33–34.
[138] Vlg. Gardiner, Kierkegaard, S. 135–140.
[139] Vlg. Gardiner, Kierkegaard, S. 75–78, 81, 83, 90.
[140] Schneiders, Dt. Philosophie, S. 37.
[141] Vlg. Schulz, Walter: Sören Kierkegaard – Existenz und System. In: Schrey, Heinz-Horst (Hrsg.): Sören Kierkegaard. Darmstadt 1971, S. 297–323, 322–323.
[142] Zimmermann, Existenzphilosophie, S. 41.
[143] Lüthi, Bildnis, S. 161.
[144] Naumann, Fall Stiller, S. 26.
[145] Vlg. Zimmermann, Existenzphilosophie, S. 22.
[146] Vlg. Schneiders, Dt. Philosophie, S. 34–35.
[147] Vlg. Kierkegaard, Nachschrift Teil 2, S. 54–57.
[148] Vlg. Kierkegaard, Nachschrift Teil 2, S. 29 und Pieper, Kierkegaard, S. 23–33.
[149] Vlg. Kierkegaard, Nachschrift Teil 2, S. 17.
[150] Vlg. Wesche, Tilo: Kierkegaard. Eine philosophische Einführung, Stuttgart 2003, S. 167–175.
[151] Vlg. zu einer existenzphilosophischen Interpretation der Philosophie Heideggers und ihrer Problematik Lübcke, Poul: Martin Heidegger: Philosophie als radikales Fragen. In: Hügli, Anton/Lübcke, Poul (Hrsg.): Philosophie im 20. Jahrhundert Band 1 Phänomenologie, Hermeneutik, Existenzphilosophie und Kritische Theorie, 4. Auflage, Reinbek 2002,
S. 156–199, S. 159, 187, 190–191 (im Folgenden zitiert als: Lübcke, Heidegger); Schneiders, Dt. Philosophie, S. 102, 106–116 und Zimmermann, Existenzphilosophie, S. 91.
[152] Heidegger, Martin: Sein und Zeit. 18. Auflage, unveränderter Nachdruck der 15., an Hand der Gesamtausgabe durchgesehene Auflage mit den Randbemerkungen aus dem Handexemplar des Autors im Anh., Tübingen 2001, S. 1. (Im Folgenden zitiert als: Heidegger, Sein und Zeit.)
[153] Heidegger, Sein und Zeit, S. 5.
[154] Seiende sind sowohl Gegenstände wie Tisch und Apfel als auch Menschen.
[155] Chul-Han, Byung: Martin Heidegger. Eine Einführung, München 1999, S. 11 (im Folgenden zitiert als: Chul-Han, Heidegger) und vlg. Heidegger, Sein und Zeit, S. 5–7.
[156] Vlg. Chul-Han, Heidegger, S. 12–13.
[157] Vlg. Zimmermann, Existenzphilosophie, S. 92 und Chul-Han, Heidegger, S. 14.
[158] Heidegger, Sein und Zeit, S. 12.
[159] Vlg. Schülerduden Philosophie, S. 295–297.
[160] Vlg. Zimmermann, Existenzphilosophie, S. 93–94.
[161] Vlg. Heidegger, Sein und Zeit, S. 54 und 110.
[162] Lübcke, Heidegger, S. 177. (Im Folgenden zitiert als: Lübcke, Heidegger.)
[163] Vlg. Chul-Han, Heidegger, S. 14.
[164] Vlg. Heidegger, Sein und Zeit, S. 66–69; Chul-Han, Heidegger, S. 14–18 und Lübcke, Heidegger, S. 170–174. – So wie wir das Werkzeug zur Herstellung von Möbeln verwenden, wird auf ähnliche Weise die Sonne von uns für die Zeitmessung benutzt.
[165] Zimmermann, Existenzphilosophie, S. 98.
[166] Heidegger, Sein und Zeit, S. 12.
[167] Heidegger, Sein und Zeit, S. 222.
[168] Heidegger, Sein und Zeit, S. 177.
[169] Ebd.
[170] Heidegger, Sein und Zeit, S. 135.
[171] Heidegger, Sein und Zeit, S. 284.
[172] In diesem Zusammenhang ist an Sartres Aussage, dass der Mensch zur Freiheit „verurteilt“ sei, zu denken, worauf ich im folgenden Kapitel näher eingehen werde.
[173] Heidegger, Sein und Zeit, S. 135.
[174] Heidegger, Sein und Zeit, S. 284.
[175] Vlg. Heidegger, Sein und Zeit, S. 240.
[176] Heidegger, Sein und Zeit, S. 234.
[177] Heidegger, Sein und Zeit, S. 245.
[178] Heidegger, Sein und Zeit, S. 250.
[179] Heidegger, Sein und Zeit, S. 240.
[180] Vlg. Heidegger, Sein und Zeit, S. 253.
[181] Heidegger, Sein und Zeit, S. 253.
[182] Heidegger, Sein und Zeit, S. 250.
[183] Ebd.
[184] Vlg. Heidegger, Sein und Zeit, S. 266.
[185] Heidegger, Sein und Zeit, Heidegger, S. 251.
[186] Heidegger, Sein und Zeit, Heidegger, S. 187 und vlg. 188.
[187] Heidegger, Sein und Zeit, S. 251.
[188] Heidegger, Sein und Zeit, S. 189.
[189] Vlg. Zimmermann, Existenzphilosophie, S. 99.
[190] Heidegger, Sein und Zeit, S. 286.
[191] Vlg. Heidegger, Sein und Zeit, S. 277.
[192] Heidegger, Sein und Zeit, S. 286–287.
[193] Vlg. Heidegger, Sein und Zeit, S. 288.
[194] Heidegger, Sein und Zeit, S. 287.
[195] Heidegger, Sein und Zeit, S. 264.
[196] Vlg. Heidegger, Sein und Zeit, S. 288.
[197] Heidegger, Sein und Zeit, S. 262–263.
[198] Heidegger, Sein und Zeit, S. 118.
[199] Vlg. Heidegger, Sein und Zeit, S. 123.
[200] Vlg. Heidegger, Sein und Zeit, S. 126.
[201] Vlg. Heidegger, Sein und Zeit, S. 221–222.
[202] Heidegger, Sein und Zeit, S. 163.
[203] Heidegger, Sein und Zeit, S. 164 und vlg. 165.
[204] Heidegger, Martin: Vom Wesen der Wahrheit. 7. Auflage, Frankfurt am Main 1986, S. 15 und vlg. Kiernan, Existenziale Themen, S. 89–90.
[205] Vlg. Chul-Han, Heidegger, S. 55.
[206] Lübcke, Heidegger, S. 189 und vlg. Chul-Han, Heidegger, S. 55–59.
- Arbeit zitieren
- M.A. Andrea Frohleiks (Autor:in), 2005, Max Frisch – Eine Untersuchung zur Existenzphilosophie in seinem Roman „Stiller“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132672
Kostenlos Autor werden


















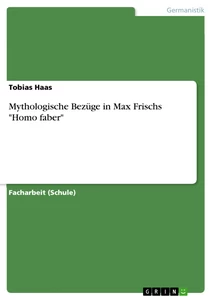



Kommentare