Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Einleitung
2. Kurt Tucholsky: Biographische Anmerkungen
2.1 Familie, Schule und Studium
2.2 Journalistisch-literarische und politische Tätigkeiten
2.2.1 Die letzten Jahre
3. Die Weltbühne
3.1 Von der "Schaubühne" zur "Weltbühne"
3.2 Zum Aufbau eines Exemplars
4. 1918-1919: Die verratene Revolution
4.1 Geschichtlicher Rückblick
4.1.1 Kulturelle und ideologische Strömungen
4.2 Ignaz Wrobel - "Revolution des Geistes"
4.3 "Die lebenden Toten" - eine Interpretation
5. 1920-1924: Reaktion und Inflation bedrohen die Republik
5.1 Geschichtlicher Rückblick
5.1.1 Kulturelle und ideologische Strömungen
5.2 Ignaz Wrobel - Warnungen an Parlament und Regierung
5.3 "Das leere Schloß" - eine Interpretation
6. 1925-1929: Die Republik beschreitet ihren Weg
6.1 Geschichtlicher Rückblick
6.1.1 Kulturelle und ideologische Strömungen
6.2 Ignaz Wrobel - "Revolution des Proletariats"
6.3 Dänische Felder - eine Interpretation
6.4 Trugen die linken Intellektuellen eine Mitschuld am Untergang der Republik?
7. 1930-1932: Die letzte Phase
7.1 Geschichtlicher Rückblick
7.1.1 Kulturelle und ideologische Strömungen
7.2 Ignaz Wrobel - Kampf gegen den Nationalsozialismus
7.3 "Der Hellseher" - eine Interpretation Inhalt Seite
8. Didaktischer Teil: "Das leere Schloß" fächerverbindend behandelt
8.1 Voraussetzungen
8.2 Überlegungen und Entscheidungen zur Thematik
8.2.1 Sachanalyse
8.2.2 Begründung der Unterrichtsarbeit
8.3 Überlegungen und Entscheidungen über die fachlichen Lehrziele
8.4 Überlegungen zur Vermittlungsproblematik
9. Literaturverzeichnis
10. Gesamtverzeichnis der Beiträge Ignaz Wrobels in der "Weltbühne"
11. Anlagen
11.1 "Fünfundzwanzig Jahre" - Tucholskys "Weltbühnenrückblick" - gekürzt
11.2 Bernt Engelmann: Zur Rolle der Medien
11.3 Dänische Felder
Vorwort
Im Wintersemester 94/95 begegnete ich zum ersten Mal Kurt Tucholsky und seinem Werk. Zwar konnte ich noch aus meiner Zeit in der Friedens-bewe- gung einige Gedichte mit ihm in Verbindung bringen, konkret einordnen konnte ich ihn aber nicht. Aus diesem Grund besuchte ich das literatur-wis- senschaftliche Hauptseminar, veranstaltet von Prof. Dr. Harald Vogel. Dort erfuhr ich einiges über den Menschen Tucholsky, seine Biographie und seinen Pazifismus. Spontan fühlte ich mich ihm verbunden. Nachdem durch die intensive Vorbereitung anhand von Materialien des Tucholsky-Archivs in Marbach und der Biographie von Michael Hepp ein von mir übernommenes Referat über Tucholskys Warnungen vor dem Faschismus im Seminar positive Resonanz fand, beschloß ich auf Anregung von Prof. Harald Vogel, meine Wissenschaftliche Hausarbeit Kurt Tucholsky zu widmen..
Durch die Biographie "Kurt Tucholsky - Biographische Annäherungen" des Publizisten Michael Hepp lernte ich Tucholsky als sensiblen, politisch engagierten, gegen bestehende Moralvorstellungen agierenden, aber durch- aus auch mit Ecken und Kanten versehenen Menschen kennen. Seine Art zu leben stand ab und zu im Widerspruch zu seinen Artikeln. Dennoch - oder vielleicht gerade deshalb - entlarven viele seiner Texte den Widerspruch zwischen Ideal und Realität, zwischen Traum und Wirklichkeit..
Seit meiner Begegnung mit dem Leben und Werk Tucholskys hat mich Tucholsky nicht mehr losgelassen. Ich ertappe mich oft, daß ich mir in bestimmten Situationen die Frage stelle: "Was hätte Tucholsky darauf gesagt?" Gerade weil Tucholsky kein "Übermensch" und kein "Heiliger" war, sondern ein mit Fehlern und Schwächen aber mit sehr viel Sensibilität und Emotionalität ausgestatteter Mensch, konnte diese "Seelenfreundschaft" überhaupt entstehen.
Den Mitgliedern der Kurt-Tucholsky-Gesellschaft Kirsten Erwentraut und Prof. Dr. Hans Werner am Zehnhoff verdanke ich wertvolle Anregungen.
Besonderen Dank möchte ich Norbert Nashan und Wolfgang Haug (Mitglied der Erich-Mühsam-Gesellschaft) aussprechen, deren kritische Ratschläge und Anregungen zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.
Ganz besonders herzlich danke ich Prof. Dr. Harald Vogel, der mir den Zu-gang zu Kurt Tucholsky ermöglichte und auf dessen Anregung diese Arbeit überhaupt entstehen konnte. Auch bei Prof. Dr. Herwart Vorländer, der trotz seines bevorstehenden verdienten Ruhestandes diese Wissenschaftli- che Hausarbeit als Zweitkorrektor betreut, möchte ich mich herzlich bedan- ken.
1 Einleitung
Mit dieser Arbeit möchte ich den Versuch wagen, anhand der Untersuchung eines Pseudonyms Tucholskys, nämlich das des Ignaz Wrobel, also das des politischen Warners, des aufklärenden Journalisten und das des scharf-zün- gigen Kritikers, einen Teil des Wesens von Kurt Tucholsky zu ergründen. Wie und vor welchem politischen Hintergrund verändern sich die Warnungen des Ignaz Wrobel in der "Weltbühne"? Diese Frage zu klären, ist das Ziel dieser Arbeit.
Anhand der Veränderung sollen die verschiedenen Stationen seines politi- schen "Schaffens" aufgezeigt werden. Dadurch, daß diesen Stationen jeweils ein geschichtlicher Rückblick vorausgeht, können die Artikel direkt mit den politischen Geschehnissen der damaligen Zeit verglichen werden. Sie werden so verständlicher und können oft als emotionale Reaktion auf bestimmte Ereignisse erkannt und nachvollzogen werden. Die sich dem geschichtlichen Rückblick jeweils anschließende Darstellung der kulturellen und ideologischen Strömungen soll dazu beitragen, den Blick- winkel auf die Epoche der Weimarer Republik zu vergrößern. Außerdem lassen sich dadurch Strömungen erkennen, die das Leben und Werk Tucholskys beeinflußten.
Da es nicht möglich ist, auf wenigen Seiten die Geschichte und die Kultur der Weimarer Republik darzustellen, habe ich mich auf die Darstellung wesentlicher Punkte beschränkt. Allerdings gehe ich auf diejenigen historischen Ereignisse, die im Zusammenhang mit den Texten Ignaz Wrobels stehen bzw. in der "Weltbühne" diskutiert wurden, genauer ein.
Ich bin mir durchaus bewußt, daß Ignaz Wrobel nur einen Teil des Wesens von Kurt Tucholsky darstellt. Diesem Teil, dem wie ich finde politisch bedeut- samsten, gilt mein besonderes Interesse. Wie in keinem anderen seiner Pseudonyme macht Tucholsky als Ignaz Wrobel auf politische Miß-stände aufmerksam und warnt vor der Zukunft. Mit einer schonungslosen, ja fast schon beleidigenden Offenheit, versucht er die Menschen aufzuklären. Meine Untersuchung dieses Pseudonyms beschränkt sich allerdings auf die "Weltbühne", andere Zeitschriften bleiben unberücksichtigt..
Jedoch wurden zunächst alle Artikel von Ignaz Wrobel in der Gesamt-aus- gabe der "Weltbühne" gelesen und Texte, welche Warnungen enthielten, gekennzeichnet. Aus diesen gekennzeichneten Artikeln wählte ich in chrono- logischer Reihenfolge diejenigen aus, die mir für diese Arbeit wichtig erschie- nen.
Tucholskys Pseudonyme werden oft als Ausdruck seiner inneren Zerrissen- heit verstanden. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob die genaue Analyse der einzelnen Pseudonyme zum Gesamtbild des Menschen Tucholsky beitragen würde, dennoch wäre das Ergebnis so einer Untersuchung interessant. Trotzdem glaube ich, daß sich Kurt Tucholsky in kein Schema, in keine Schublade einfügen läßt - und das ist ganz gut so. Seine Vielfalt ermöglicht den Lesern unterschiedliche Zugänge zu ihm, was dazu führt, daß die Freunde der Texte Kurt Tucholskys sich auf verschiedenste Art und Weise mit ihm identifizieren bzw. sich ihm verbunden fühlen können. Als Beispiel wären hier die Mitglieder der Kurt-Tucholsky-Gesellschaft zu nennen. Diese Menschen, unterschiedlichsten Charakters und aus verschiedenen Berufen kommend, verbindet eines - die Liebe zu Kurt Tucholsky und seinem Werk.
2 Kurt Tucholsky: Biographische Anmerkungen
2.1 Familie, Schule und Studium
Der am 9. Januar 1890 geborene Kurt Tucholsky, Kind einer gutbürgerlichenjüdischen Familie, erlebte seine Kindheit eher negativ. Die hohe gesellschaftliche Stellung der Tucholskys (sein Vater war Direktor der Berliner Handelsgesellschaft) empfand er als einengend.
Die Mutter, Doris, wurde von den drei Geschwistern als "Dämon" bzw. als "herrschsüchtige Tyrannin" bezeichnet. Der Vater starb am 1. November 1905 an Syphilis. Im Gegensatz zur Mutter wurde dieser von seinen Kindern über alles geliebt. Kurt Tucholsky hat den frühen Verlust seines Vaters nie überwunden und blieb immer auf der Suche nach einem Vaterersatz. In der Schule war Kurt rebellisch. Er glaubte nicht an das, was ihm im Unterricht vorgesetzt wurde, zweifelte und hinterfragte. Die Lehrer konnten ihn nicht mehr richtig unter Kontrolle bringen.
"Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, so tue ich das nicht mit dem Gefühl des Hasses, sondern mit dem einer unsäglichen Verachtung für die Typen, die uns da unterrichtet haben - und wie unterrichtet! [...] Gelernt haben wir nicht viel - mein Wissen krankt noch jetzt an Lücken, die ich nie wieder aufzufüllen vermag. Dieser Unterricht war, in seinen großen Teilen und von erfreulichen Ausnahmen abgesehen, eine sinnlose Quälerei und das Fahrgeld nicht wert."1
Schließlich nahm ihn seine Mutter vom Gymnasium und schickte ihn zur privaten Vorbereitung auf das Abitur zu einem Studienrat. Dieser gewann das Vertrauen des jungen Mannes, so daß Tucholsky 1909 sein Abitur als Ex-terner machen konnte. Sein daran anschließendes Jurastudium beendete er erfolgreich. Sechs Jahre später erhielt er die Doktorwürde der Universität Jena.
2.2 Journalistisch-literarische und politische Tätigkeiten
Kurt Tucholskys zwei 1907 anonym im "Ulk", einem Berliner Witzblatt, ver-öf- fentlichte Erzählungen, legten den Grundstein für seine künstlerische und journalistische Entwicklung. Vier Jahre später erschien sein erster Artikel im sozialdemokratischen "Vorwärts", einer der größten Zeitungen Berlins. Wieder ein Jahr später, am 15. November 1912, kam ein kleines, knapp 100 Seiten dünnes Büchlein auf den Büchermarkt: "Rheinsberg. Ein Bilderbuch für Verliebte". Dieses Büchlein kam einer erotischen Rebellion gleich und fand mit seinen darin versteckten, zahlreichen politischen und gesellschaftskritischen Anspielungen bald reißenden Absatz.
Im Januar 1913 lernte Tucholsky Siegfried Jacobsohn, den Herausgeber der "Schaubühne", kennen. Dieser nahm bald die Rolle seines väterlichen Freundes und Lehrmeisters ein.
Tucholsky hatte diese Zeitschrift "verschlungen" und hatte es 1913 gewagt, einen kleinen Artikel an Siegfried Jacobsohn zu schicken. "Und ich platzte vor Stolz: S. J. ließ mich kommen. Und hat mich dann nie mehr losgelassen."1 Der Artikel erschien am 9. Januar, seinem 23. Geburtstag.
"Bald wurden in jedem Heft wenigstens ein oder zwei seiner Beiträge veröffent- licht, die meisten unter Pseudonym. Allein im ersten Jahr der Zusammenarbeit standen rund hundert Arbeiten von Tucholsky im 'Blättchen', wie die roten Heftchen liebevoll genannt wurden. Jacobsohn ermunterte ihn zu kleinen Versen, von denen dieser ihm bei seinem ersten Besuch einige Proben gezeigt hatte, und er hetzte ihn auf 'Bühnen, Bücher, und Büldung'. Jacobsohn wurde für Tucholsky zum Lehrmeister, und dieser gestand später offen ein, daß der 'kleine Mann' ihn 'erst zu dem gemacht' habe, 'was er wurde.' Andererseits erkannte Jacobsohn schnell, wen er da 'entdeckt' hatte, und versuchte, Tucholsky immer enger an das Blatt zu binden. Das Blatt wandelte sich langsam unter Tucholskys Einfluß vom reinen Theaterblatt zum kulturellen und politischen Blatt."2
Tucholskys vielfältige Interessen bewogen ihn, in einigen anderen Zeit-schrif- ten und Zeitungen zu schreiben. Jedoch wurde er bald zum Hauptautor der "Schaubühne". Er schrieb allmählich unter mehreren Pseudonymen: Ignaz Wrobel, Peter Panter, Theobald Tiger und Kaspar Hauser. Peter Panter wurde der Feuilletonist, Theobald Tiger der Verseschmied und Kaspar Hauser der melancholischste von allen. Später erschienen unter Kaspar Hauser die schärfsten Satiren gegen den deutschen Spießer, die "Wendrinergeschichten".
"Ignaz Wrobel wurde zum bissigen scharfzüngigen Kritiker. Er legte sich mit den geheiligten Institutionen des Staates an und 'trommelte auf den Sturmhel- men' der Reaktion. Auch in den politischen Organisationen war meist nicht Kurt Tucholsky, sondern Ignaz Wrobel Mitglied."1
Den Namen lieh sich Kurt Tucholsky vom Herausgeber der Arithmetik-Lehr- bücher für die preußischen Gymnasien.
"Wrobel - so hieß unser Rechenbuch; und weil mir der Name Ignaz besonders häßlich erschien, kratzbürstig und ganz und gar abscheulich, beging ich diesen kleinen Akt der Selbstzerstörung und taufte so einen Bezirk meines Wesens."2
Er sah Wrobel als einen "essigsauren, bebrillten, blaurasierten Kerl, in der Nähe eines Buckels und roter Haare."
Nach dem Beginn des Krieges, am 01.08.1914, verstummte Kurt Tucholsky für über ein Jahr in der Öffentlichkeit.
"Während ein großer Teil der Schriftsteller, vom patriotischen Rausch befallen, den Krieg hymnisch feierte, stellten Tucholsky und seine Pseudonyme die Arbeit ein."3
Im April 1915 wurde Kurt Tucholsky zum Heeresdienst eingezogen. Die ersten Wochen waren für ihn besonders hart. Doch bald kam er als Kompa- nieschreiber in den Bürodienst. Aufgrund seiner Fähigkeiten rückte er bald zum Bürochef auf. 1916 rief er die Feld-Zeitung "Der Flieger" ins Leben und wurde dessen Herausgeber. Tucholsky vermied zwar "Lobhudeleien" über den Krieg abzudrucken, ab und zu findet sich auch eine vorsichtige Kritik, trotzdem läßt es sich nicht leugnen, daß während dieser Zeit bei ihm eine gewisse Anpassung vorhanden war, um ein möglichst angenehmes Leben führen zu können. Dies hat er später immer wieder bedauert. So berichtete er 1926 rückblickend:
"Ich habe mich dreieinhalb Jahre im Kriege gedrückt, wo ich nur konnte - und ich bedaure, daß ich nicht, wie der große Karl Liebknecht, den Mut aufgebracht habe, Nein zu sagen und den Heeresdienst zu verweigern. Dessen schäme ich mich."4
Am 11. November 1918 war der Krieg zu Ende.
Anfang Dezember trat Tucholsky die Stelle des Chefredakteurs im "Ulk" an. Doch bald merkte er, daß sich seine Vorstellung von Satire nicht mit der des Hauses deckte.
Die "Schaubühne" wurde nach dem Krieg auf Anraten Tucholskys in "Weltbühne" umbenannt. Obwohl Tucholsky in zahlreichen Zeitschriften und Zeit- ungen veröffentlichte, erschien doch der bei weitem umfangreichste Teil seines Schaffens in der "Weltbühne", die eine Auflage von 12 000 Stück hatte. Zwischen 1919 und 1923 erschienen rund vierhundertfünfzig Beiträge unter Tucholskys Pseudonymen. Er schrieb außerdem zahlreiche Chansons, ein Theaterstück, Gedichtsammlungen. Er war Mitglied in verschiedenen Organisationen: im "Bund neues Vaterland", im "Friedensbund der Kriegsteilnehmer", er war führendes Mitglied des "Nie-wieder-Krieg-Aktionsausschus- ses". Er wurde aktives Mitglied der USPD und hatte Auftritte in politischen Versammlungen. "Tucholsky war allgegenwärtig."1
Am 03.05.1920 heiratete Kurt Tucholsky die Ärztin Else Weil. 1924 wurde die Ehe geschieden.
Tucholsky trat am 1. März 1923 in das Bankhaus "Bett, Simon & Co" als Volontär ein. Bereits im Sommer wird er dort Sekretär des Seniorchefs Hugo Simon. Diesem Schritt gingen offenbar Unstimmigkeiten mit Jacobsohn, aber auch finanzielle Probleme voraus. Er litt außerdem unter schweren Depressionen, da ihm zunehmend die Aussichtslosigkeit seines Kampfes bewußt wurde. Die Arbeit im Bankhaus erfüllte ihn nicht. Er schrieb weiterhin für verschiedene Zeitschriften. Kurt Tucholsky wollte Deutschland verlassen, sein Ziel war Frankreich.
Am 15. Februar 1924 schloß er mit Jacobsohn einen Vertrag. Er trat in den Verlag der "Weltbühne" ein und hatte dort Büroarbeit zu erledigen. Siegfried Jacobsohn verpflichtete sich, Tucholsky ohne Gehaltsabzug mindestens drei Monate im Jahr auf Reisen zu schicken. Als durch weitere Verträge mit anderen Zeitschriften seine Finanzen gesichert waren, kündigte er beim Bankhaus und fuhr am 6. April 1924 nach Frankreich. Er verliebte sich in dieses Land. Seine Berichte und Artikel drückten zunächst euphorische Begeisterung aus. "Hier konnte er sich von seinem Vaterlande ausruhen". Kurt Tucholsky heiratete am 30.08.1925 Mary Gerold, die er während seines Militärdienstes 1917 kennengelernt hatte. Diese Ehe, mit der wahrscheinlich größten Liebe seines Lebens, ging 1933 endgültig in die Brüche. Am 3. Dezember 1926 starb überraschend, im Alter von nicht einmal 46 Jahren, Siegfried Jacobsohn an einem Gehirnschlag. "Der Tod seines väterli- chen Freundes war für Tucholsky ein Schock."2 Ein Jahr nach Jacobsohns Tod schreibt Kurt Tucholsky in der "Weltbühne":
"Ich bin damals, vor einem Jahr, nicht imstande gewesen, über S. J. ruhig zu sprechen, nicht über unsre Beziehungen, nicht über seine Persönlichkeit, über gar nichts - ich war ziemlich zu Ende."3
Eigentlich sollte Tucholsky die Redaktion der "Weltbühne" übernehmen. Der Gedanke daran widerstrebte ihm, allerdings war ihm bewußt, daß im Falle seiner Ablehnung, die Zeitschrift nach wenigen Wochen "kaputtgehen" würde. Die Verhandlungen mit Edith Jacobsohn führten schließlich zum Vertrag. Kurt Tucholsky übernahm die Redaktion, konnte aber in Paris bleiben. Die Arbeit in der Redaktion veränderte sich. Im Gegensatz zu Jacob- sohn wird Tucholsky als gemütlich und gesellschaftlich beschrieben. Er war auch viel stärker an tagespolitischen Fragen interessiert als Jacobsohn. Doch bereits im Mai 1927 gab Tucholsky die Redaktion an Carl von Ossietzky ab. Ab Oktober stand auf dem Titelblatt: "Unter Mitarbeit von Kurt Tucholsky geleitet von Carl von Ossietzky".
Tucholskys Bilderbuch "Deutschland, Deutschland über alles" erschien am 6. August 1929. Kurt Tucholsky rechnete nun mit dem Deutschland ab, das er inzwischen haßte und bekämpfte.
"Dieses Buch wurde ein brillantes Feuerwerk aus Witz und Wut. Aber aus der Wut quoll das ganze Maß Verachtung und Hohn, Spott und Haß heraus, das sich bei Tucholsky in zehn Jahren Republik angesammelt hatte."1
Er glaubte nicht mehr an eine Veränderung der Verhältnisse, außerdem wurde ihm immer stärker bewußt, daß sein Kampf aussichtslos war.
"Dieses Buch war Tucholskys letzer Versuch, der Republik den Spiegel vorzuhalten."2
Er verließ Paris, reiste durch Europa und landete schließlich in Schweden. In Hindas bei Göteborg entstand 1931 sein letzten großes literarisches Werk "Schloß Gripsholm" - eine "Liebesgeschichte".
Am 17. Januar 1933 wird der letzte Beitrag Tucholsys in der "Weltbühne" gedruckt. Mit dem Leserbrief "Liebe Weltbühne" verabschiedet sich Peter Panter vom "Blättchen". Tucholsky verstummte nun endgültig in der Öffent- lichkeit.
2.2.1 Die letzten Jahre
Diese waren ein einziger Lösungsprozeß von allem, was sein Leben bisher bestimmt hatte. Am 25.08.1933 stand er auf der ersten Ausbürgerungsliste im "Deutschen Reichsanzeiger". Das noch in Deutschland verbliebene Vermögen wurde beschlagnahmt. Zu Hedwig Müller, einer Züricher Ärztin, die er im August 1932 kennengelernt hatte, entwickelte sich bald eine tiefe Freundschaft. Im regen Briefwechsel mit "Nuuna" aber auch mit vielen seiner
Freunde kommt seine melancholische, hoffnungslose Stimmung zum Ausdruck. Seine finanziellen Reserven erschöpften sich zusehends. Er war auf die Hilfe von Hedwig Müller angewiesen. Tucholsky litt unter chronischen Nasenbeschwerden. Als nach mehreren Operationen endlich eine Bes-se- rung eintrat, klagte er über andauernde Magenbeschwerden. Am 21. Dezem- ber 1935 starb Kurt Tucholsky. Die Todesursache: eine Überdosis Schlaftabletten!
3 Die Weltbühne
3.1 Von der "Schaubühne" zur "Weltbühne"
Am 7. September 1905 erschien die erste Nummer der "Schaubühne" - einer Theaterzeitschrift. Herausgeber war Siegfried Jacobsohn, ein 24jähriger Theaterkritiker. Das Blatt wurde schnell zu einem Begriff. Unermüdlich arbeitete Jacobsohn für diese Zeitschrift.
"Das Theater war für S. J. die Welt - doch nahm er den Begriff so weit, daß niemals [...] ein enges Spezialistentum daraus wurde. Er kämpfte für die Wahrheit in der Kunst."1
Am 9. September 1930 beschrieb Kurt Tucholsky unter der Überschrift "Fünfundzwanzig Jahre", den Werdegang des "Blättchens" in der "Weltbühne". In seinem Rückblick kommt die ganze Liebe zur "Schau- bzw. Weltbühne" und seinem "Erfinder" Siegfried Jacobsohn zum Ausdruck. Wahrscheinlich hat niemand diese Zeitschrift, ihren Sinn, ihre Leserschaft liebevoller und genauer beschrieben, als Kurt Tucholsky dies in seinem Artikel getan hat. Daher sollen hier einige Passagen dieses Artikels zitiert werden. Der Artikel "Fünfundzwanzig Jahre" erscheint gekürzt im Anhang dieser Arbeit.
Wenn man Tucholskys Schilderungen über Jacobsohns journalistischen "Kampfgeist" liest, spürt man die Bewunderung, die er ihm entgegengebracht hat:
"Er [S.J.] hatte Lust zu kämpfen, er hatte das flinke Florett und eine tödlich treffende Hand. Er war ein ritterlicher Gegner - doch wohin er schlug, da wuchs kein Gras mehr. [...] In dem 'kleinen Mann' war so viel Kampfeswille, so viel Begeisterung, im literarischen Kampf anzutreten; man hatte manchmal das Gefühl, als komme ihm der Gegner grade recht, als habe er nur darauf gewartet, ihn abzutun. Das vollzog sich sehr oft in Form eines geistigen Zweikampfes; er gab schon damals dem Gegner das Wort im Blatt, antwortete sofort, und man hatte niemals den Eindruck, daß er nur das "letzte Wort" behielte, weil ers typographisch hatte. Er traf - aber er blieb dabei stets in den Regeln des Spiels. [...] Und hatte S. J. einmal jemand beim Wickel, dann ließ er ihn sobald nicht los. Er verfolgte ihn, er schlug, er wich nie zurück, er war ein Polemiker von Geblüt. Davon wissen viele zu klagen."2
Jacobsohn wollte die Zeit erfassen in der er schrieb. Sein Anliegen war es, seine Zeitgenossen "zu packen, aufzuwühlen, zu bilden und zu fassen".
Für die "Schaubühne" schrieben bekannte Autoren, wie Christian Morgen- stern, Erich Mühsam, Alfred Polgar und Max Brod, um nur einige zu nennen. Ab 1913 gehörte Kurt Tucholsky zur "Familie". Schon im ersten Jahr seiner Mitarbeit erschienen insgesamt hundert Arbeiten von ihm in der "Schaubühne", die meisten unter Pseudonym. Tucholsky entwickelte sich bald zur rechten Hand des Herausgebers.
"Siegfried Jacobsohn und Kurt Tucholsky - zwei Brüder im Geiste, die ohne den anderen nicht konnten. Zwei Pole, die, tatsächlich, sich ergänzten, zum klingenden Zusammenspiel fanden. Lehrling und Lehrmeister, Sohn und Vater, Stan und Ollie - ein zweiblättriges Kleeblatt, das eine (verlorene) Welt zum Blühen brachte. Sonne und Mond und Licht und Schatten. Der eine heiter, der andere schwermütig, auch hierin ergänzten sie sich vortrefflich. Grad wie Eukolos und Dyskolos, die Figuren, die Schopenhauer gebrauchte."1
Unter der Mitarbeit Tucholskys veränderte sich das Blatt allmählich, es wurde politischer. Neue Themen und Rubriken erschienen.
Die Textbeiträge hatten vor allem auf junge Leser eine starke Wirkung.
" - das da ging uns alle an. Welche Grazie! welche Leichtigkeit noch im wuchti- gen Schlag! welche Melodie! - alles Eigenschaften, die den Schreibenden bei dem schlechtern Typus des Deutschen höchst verdächtig machen. [...] Was im Blatt stand, das drang weit ins Land - totschweigen half nicht, kreischen half nicht, nach 'Motiven' suchen half nicht, denn es waren keine anderen da, als nur eines: der niemals zu unterdrückende Drang, die Wahrheit zu sagen."2
Doch während des Krieges war die Redaktion der "Schaubühne" gezwungen, sich mit kritischen Äußerungen zurückzuhalten.
"Das Blatt lavierte durch den Krieg, an Verboten vorbei, durch die Papierratio- nierung, und, mit einer Ausnahme, schwieg es da, wo es nicht sprechen konnte. Keine Nummer wäre erschienen, wenn gesagt worden wäre, was zu sagen war."3
Tucholskys Einfluß war es letztendlich zu verdanken, daß die Theaterzeit- schrift "Schaubühne" ab dem ersten April 1918 in "die Weltbühne - Wochenschrift für Politik, Kunst und Wirtschaft" umbenannt wurde. Durch die politischen Beiträge, die sich gegen den Militarismus und den Untertanengeist richteten, aber für Frieden, Demokratie und Menschlichkeit eintraten, war das Blatt ebenso verhaßt wie beliebt.
Viele Vorausahnungen der einzelnen Autoren bewahrheiteten sich auf erschreckende Weise. Tucholsky schrieb dazu 1930:
"Wir haben uns einige Male den tragischen Spaß gemacht - nach dem Kapp- Putsch, nach der Ermordung Rathenaus -, unsre Voraussagen zusammenzu- stellen: es war erschreckend. Was die Berufspolitiker, diese berufsmäßig Blinden, mit wegwerfendem Pusten durch die Nase abzutun geglaubt hatten, das war fast immer blutige Realität geworden; wir hatten traurig Recht behalten. Jene wußten viel mehr Einzelheiten als wir, aber sie fühlten nichts. Am Zeiger- blatt der Weltbühne kann man die Geschichte der Nachkriegszeit ablesen."1
Die "Weltbühne" hatte sich unter allen Herausgebern ihre Unabhängigkeit bewahrt. Sie ließ sich weder von den Parteien noch von den Lesern beeinflußen. Diese Meister der Satire strickten an ihrem Werk. Dieses Werk war ihre Welt, hier konnten sie lachen und fluchen. Ihre Kraft ging in die Polemik und nicht in Parteiengezänk oder Postengeschiebe.
"So sehr wir mit der Leserschaft in Verbindung stehen: wir haben ihr niemals das Recht eingeräumt, durch Druck oder Drohung, durch Empfehlung oder Anwendung jener legendären 'Beziehungen' unsre Haltung zu beeinflussen. Ich für meinen Teil kann aufhören, zu schreiben - aber ich könnte, solange ich schreibe, es nicht nach dem Diktat eines Verlegers tun.
'Dies', sagte der Verleger, der seine Zeitung verkaufen wollte, 'ist der Maschinensaal...hier sind die Verlagsräume... sehen Sie, das ist die Expedition... hier ist die Anzeigenannahme - und das da, ach Gott: das ist bloß die Redaktion.'
Das Blatt ist unabhängig geblieben, und wenn wir Fehler machten: dann machen wir wenigstens unsre Fehler."2
Den Einfluß der "Weltbühne" beschrieb Tucholsky 1930 als "mittelbar":
"Durch tausend Netzkanälchen laufen aus dieser Quelle Anregungen, Formulierungen, Weltbilder, Tendenzen und Willensströmungen ins Reich - wir folgen hier ganz und gar S. J., der niemals übel genommen hat, wenn man ihn benutzte, nachdruckte, ja sogar ausplünderte: 'Wenn nur das Gute unter die Leute dringt.' Und es gibt heute schon eine Reihe vernünftiger und mutiger Provinzredakteure, [...] sie fangen nicht ohne eignes Risiko die Bälle auf, die von hier aus geschleudert werden, und geben sie weiter."3
Und die Leserschaft der "Weltbühne" schilderte er folgendermaßen:
"Ich mag das Spiel nicht mitspielen, das darin besteht, die eigne Leserschaft für die Aristokratie des Geistes zu erklären, eine billige Art der Abonnentenwer- bung. Aber es sind gute Leute unter denen, die in jeder mittlern und kleinen Stadt die 'Weltbühne' lesen - sie haben sich zum Glück noch kein Knopfloch- Abzeichen ausgedacht, das sie tragen, doch könnten sie sich in jedem Ge-spräch erkennen. Durch Unabhängigkeit des Urteils, durch Sinn für Humor, durch Freude an der Sauberkeit.
Und durch einen Glauben an die Sache, der auch bei uns unbeirrbar steht."4
Am Ende resümierte er:
"Jedes Blatt hat seine Lücken, seine Versager, seine schwachen und seine starken Zeiten. Eins aber ist sicher.
Solange die Weltbühne die Weltbühne bleibt, solange wird hier gegeben, was wir haben. Und was gegeben wird, soll der guten Sache dienen: dem von keiner Macht zu beeinflussenden Drang, aus Teutschland Deutschland zu machen und zu zeigen, daß es außer Hitler, Hugenberg und dem fischkalten Universitätstypus des Jahres 1930 noch andre Deutsche gibt. Jeder Leser kann daran mitarbeiten.
Tut er es in seinem Kreise durch die Tat: es ist unser schönster Lohn. In diesem Blatt sind wir frei und sind wir ganz; auch uns ist die Weltbühne im Andenken an Siegfried Jacobsohn: 'unser geronnenes Herzblut'."1
Seit 1929 schwebte über der Weltbühne ein Verfahren wegen Landesverrats. Grund dafür war der Artikel: "Windiges aus der deutschen Luftfahrt", veröf- fentlicht am 12. März 1929 unter dem Tarnnamen Heinz Jäger. Am 8. August 1929 unterrichtete der Oberreichsanwalt den Preußischen Innenminister, daß er beim Landgericht II beantragt habe, die Voruntersu- chung zu eröffnen. Der Schriftsteller Heinz Jäger und der verantwortliche Schriftleiter der "Weltbühne" hätten die Sicherheit des Reiches gefährdet. Der Autor hieß in Wirklichkeit Walter Kreiser und war ein in Luftfahrtfragen kundiger Journalist. Der Artikel behandelte die verschleierte Aufrüstung speziell der verbotenen Luftwaffe. Im Herbst 1930 besuchte Ossietzky Tucholsky in Schweden, um die Lage zu erörtern. Man kam überein, bei weiterer Zuspitzung der Lage die Redaktion ins Ausland zu verlegen. Nach über zwei Jahren, am 23. November 1931 wurde Ossietzky wegen publizisti- schen Landesverrates zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Er trat seine Haftstrafe am 10. Mai 1932 im Gefängnis Tegel an. Viele Menschen, darun- ter sehr viele Kollegen, waren vor den Toren des Gefängnisses erschienen, um ihm "Lebewohl" zu sagen.
Der zweite Prozeß gegen die Weltbühne ließ nicht lange auf sich warten. Am 1. Juli 1932 fand der sogenannte "Soldatenprozeß" statt. Anlaß dazu war ein Artikel von Kurt Tucholsky, in dem der Satz vorkam: "Sagte ich Mord? Natür- lich Mord. Soldaten sind Mörder." Angeklagt wurde allerdings nicht der sich in Schweden befindende Kurt Tucholsky, sondern der verantwortliche Heraus- geber Ossietzky, der aus dem Gefängnis vorgeführt wurde. Der Prozeß um dieses Zitat, welches heutzutage wieder erbittert diskutiert wird, endete (1932!) mit einem Freispruch! Dieser Freispruch kam durch das Plädoyer des Anwaltes Rudolf Olden zustande. Das Konzept dazu lieferte Kurt Tucholsky. In seiner Rede lieferte Olden den Nachweis, daß militärabträgliche Bemer- kungen sich durch die gesamte Literaturgeschichte ziehen. Von Laotse über das Neue Testament bis Kant, Goethe, Herder, Wilhelm Raabe und andere führte er Zitate an. Diese überzeugten den Staatsanwalt allerdings noch nicht. Nun folgten Zitate von Militaristen, darunter zwei Hohenzollern und - man höre und staune - Hindenburg. "Das gab den Ausschlag: Ossietzky wurde freigesprochen. In seiner Situation klingt es fast zynisch; denn er mußte in seine Zelle nach Tegel zurückkehren."1 1932 - zwei Tage vor Weihnachten wurde Ossietzky aus dem Gefängnis entlassen. Bereits am 27. Dezember erschien sein Artikel "Rückkehr" in der "Weltbühne".
Am 30. Januar 1933 kam Hitler an die Regierung. In der Nacht des Reichstagsbrandes am 27. Februar, wurde Carl von Ossietzky unter dem Vorwand, er hätte seine Finger mit im Spiel gehabt, verhaftet.
Am 13. März 1933 wurde "Die Weltbühne" in Berlin endgültig verboten.
3.2 Zum Aufbau eines Exemplars:
Eine Ausgabe umfaßte ca. 30-40 Seiten. In der Kopfzeile der ersten Seite stand links der Jahrgang, in der Mitte das Datum der Ausgabe und rechts die laufende Jahresnummer.
Unterhalb dieser Zeile begann der Leitartikel, welcher mehrere Seiten umfaßte. Anschließend folgten die Beiträge der verschiedenen Autoren. Politische Beiträge, Theater- und Buchkritiken, Gedichte und Satiren waren auf diesen Seiten zu finden. Danach folgte die Rubrik "Rundschau" bzw. ab 1923 "Bemerkungen". Dieser Teil war zweispaltig gedruckt. Dort fanden sich "kurze Besprechungen und Stimmungsbilder aus deutschen Städten und deren Theatern; Ernsthaftig- keit und Scherze."2 Nach diesem Teil folgte die Rubrik "Antworten": Hier fanden sich echte und erfundene Leserbriefe. Aktuelle, originelle, ärgerliche und ulkige Vorfälle wurden beschrieben. Siegfried Jacobsohn hatte sich außerdem hier ein Forum geschaffen, um mit Witz, Charme und "Galle" seinen Lesern zu antworten, die mit Meinungen der Autoren nicht einverstan- den waren. Er griff hier auch in Diskussionen ein, die in anderen Blättern stattfanden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4 1918-1919: Die verratene Revolution
4.1 Geschichtlicher Rückblick
General Erich Ludendorff trat, nachdem er bereits Hindenburg und den Kaiser informiert hatte, am 29. September 1918 an die Reichsleitung heran und verlangte die unverzügliche Herausgabe eines Waffenstillstandsange- bots. Die Oberste Heeresleitung (OHL), die mit Ludendorff und Hindenburg an der Spitze ihre Macht im Reich in den letzten Kriegsjahren diktatorisch ausgeübt hatte, verlangte außerdem eine Parlamentarisierung im Reich. Ludendorffs Schritt
"traf mit gleichzeitigen Bemühungen der Mehrheitsparteien zusammen, eine arbeitsfähige Regierung unter Einschluß der SPD zu bilden. Dies lief auf die Auswechslung Hertlings hinaus, dessen mangelnde Durchsetzungskraft gegenüber den Eigenmächtigkeiten der OHL allgemein beklagt wurde."1
Prinz Max von Baden wurde nun mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Auch diesem erklärte Ludendorff, erste und wichtigste Aufgabe des zu bildenden Kabinetts aus Liberalen, Zentrumspolitikern und Sozialdemokraten sei die sofortige Bitte um Waffenstillstand.
Am 3.-4. Oktober bot die deutsche Regierung dem amerikanischen Präsidenten Wilson den Waffenstillstand auf der Grundlage seiner 14 Punkte an. So erfuhr am 5. Oktober die deutsche Öffentlichkeit, daß Deutschland gezwungen wäre, um Waffenstillstand zu bitten. Doch
"erst am 26. Oktober wurde die überfällige Verfassungsreform unter dem Druck der dritten Note Wilsons vom Reichstag verabschiedet. Sie verwandelte das Reich in eine parlamentarische Monarchie."2
Die Bismarcksche Reichsverfassung wurde geändert und Ludendorff aus der OHL entlassen. Nun fiel also der demokratischen Regierung und nicht der kaiserlichen Generalität die undankbare Aufgabe zu, "die weiße Fahne zu hissen".
"Und so war es denn auch kein hoher Offizier in großer Uniform, der am Ende - am 11. November 1918 - mit der weißen Fahne aus der vordersten deutschen Stellung hinüberging zum Gegner und in einem Eisenbahnwaggon im Wald von Compiègne den Waffenstillstand zu Lande, zu Wasser und in der Luft im Namen des Deutschen Reiches unterschreiben mußte, sondern der Volksschullehrer Matthias Erzberger aus Buttenhausen in Württemberg, führender Abgeordneter des Zentrums im Reichstag."1
Auf diese Art und Weise konnte das alte Regime alle Verantwortung für die Niederlage und ihre Folgen auf die neue Republik abwälzen.
"Und später konnte die deutsche Rechte dann die Dinge so darstellen, als wäre das 'im Felde unbesiegte' deutsche Heer von feigen Schurken um die Früchte jahrelangen Ringens, um den 'zum Greifen nahen Endsieg' gebracht und 'von hinten erdolcht' worden."2
Bereits ein Jahr später, im September 1919 formulierte Hindenburg in seinem Buch "Aus meinem Leben" die Dolchstoßlegende folgendermaßen:
"Wir waren am Ende! Wie Siegfried unter dem hinterlistigen Speerwurf des grimmen Hagen, so stürzte unsere ermattete Front; vergebens hatte sie versucht, aus dem versiegenden Quell der heimatlichen Kraft neues Leben zu trinken."3
Ende Oktober 1918 beschloß die Seekriegsleitung, quasi in allerletzter Stunde, die bis dahin sorgsam geschonten Schiffe der kaiserliche Hochsee- flotte auslaufen zu lassen. Sie sollte, wie es hieß, in den Ärmelkanal vorsto- ßen, dadurch die alliierten Transporte unterbrechen und somit die Heeres- front entlasten. Dieser Befehl gab allerdings keinen Sinn, da es sich hierbei nur um eine kurze Unterbrechung gehandelt hätte, die keine spürbare Entla- stung gebracht hätte. In Wirklichkeit diente dieser "wahnwitzige" Befehl dazu, ein Schlachtenduell zu entfachen und somit legendenträchtig mit wehender Flagge unterzugehen.
Die Matrosen in Kiel aber verweigerten diesen Einsatz. Diese Meuterei griff schnell auf andere Städte über. In Bayern wurde der bayrische König abgesetzt und Kurt Eisner, der Vorsitzende der dortigen Unabhängigen Sozialdemokraten, wurde Staatsoberhaupt.
Neugebildete Arbeiter- und Soldatenräte riefen zum Generalstreik auf und verlangten den Rücktritt des Kaisers. Schließlich forderten auch die SPD-Führer den Rücktritt des Kaisers, um die Massen zu beruhigen. Friedrich Ebert erklärte dem Reichskanzler:
"Wenn der Kaiser nicht abdankt, dann ist die soziale Revolution unvermeidlich. Ich aber will sie nicht, ja, ich hasse sie wie die Sünde."4
Prinz Max von Baden hatte nun den rettenden Einfall: Er gab die noch nicht erklärte Abdankung des Kaisers bekannt und ernannte Friedrich Ebert zum Reichskanzler. Staatsrechtlich war dieser Akt nicht gedeckt.
"Am 9. November rief der SPD-Abgeordnete Philipp Scheidemann die freie deutsche Republik aus, sehr zum Ärger von Ebert, der 'dunkelrot vor Zorn' wurde und Scheidemann anbrüllte. Zwei Stunden später proklamierte Karl Liebknecht, der Führer des Spartakusbundes, die sozialistische Räterepublik."1
Am 10. November konstituierte sich der "Rat der Volksbeauftragten", dieser bestand aus je drei Vertretern von SPD und USPD.
Am selben Abend erreichte Ebert ein Anruf aus Spa bei Lüttich, dem Sitz der OHL. Am Apparat war General Wilhelm Groener, der Nachfolger Ludendorffs. Dieser bot Ebert eine "loyale Zusammenarbeit" an, wenn dieser versprach, den "Bolschewismus und das Räteunwesen" zu bekämpfen, geordnete Zustände herzustellen und eine Nationalversammlung einzuberufen. Ebert ging auf dessen Vorschläge ein und bedankte sich bei ihm für dessen Vertrauen. Später berichtete Groener:
"Von da an besprachen wir uns täglich abends auf einer geheimen Leitung zwischen der Reichskanzlei und der Heeresleitung über die notwendigen Maßnahmen. Das Bündnis hat sich bewährt."2
Auf diese Art und Weise wurde die neue Republik schnell zum Tummelplatz der Konterrevolution.
Am 24. Dezember meuterte die Volksmarinedivision. Ebert ersuchte die OHL, sofort einzugreifen. Das Quartier der Division wurde vom Militär gestürmt, 67 Menschen getötet. Aus Protest über diese "Blutweihnacht" verließen die Mitglieder der USPD die Regierung. Gustav Noske und Rudolf Wissell von der SPD rückten nach. Noske wurde zum Oberbefehlshaber der Regierungstruppen. Am 4. Januar riefen die USPD und die inzwischen gegründete KPD zur Massendemonstration auf. Sie wollten gegen die Abset- zung des Berliner Polizeipräsidenten Eichhorn (USPD) demonstrieren. Über hunderttausend Menschen gingen auf die Straße, um ihrer Enttäuschung über die "verratene Revolution" Ausdruck zu verleihen. Trotz eines Vermitt- lungsausschusses zwischen Aufständischen und Regierung lehnte Noske jeglichen Kompromiß ab. Der sogenannte "Spartakusaufstand" wurde in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar brutal niedergeschlagen. 180 Spartakisten wurden erschossen. Zwei Monate später brachen erneut Unruhen aus.
Noske ließ 32000 Soldaten unter General Lüttwitz aufmarschieren. Sie schossen auf die unbewaffneten Demonstranten. 1200 Aufständische starben. Am 15. Januar wurden Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg von Bürgerwehr-Leuten ermordet.
Am 19. Januar 1919 fanden die ersten Wahlen zur Nationalversammlung statt. Die Mandate verteilten sich folgendermaßen: SPD 165, Zentrum 89, DDP 74, DNVP 42, USPD 22, DVP 22. Die SPD ging zwar als die stärkste Partei hervor, errang aber nicht die absolute Mehrheit. Sie mußte mit dem Zentrum und der DDP eine Koalition bilden. Ebert wurde Reichspräsident und Scheidemann Reichskanzler, jedoch verzichteten die sozialistischen Parteien darauf, den Verfassungsgebungsprozeß zu bestimmen.
"In der Haltung beider Parteien, insbesondere derjenigen der MSPD-Führung verbarg sich ein formalistisches Verfassungsverständnis, das die Lassallesche Einsicht, daß Verfassungsfragen Machtfragen seien und nicht bloß den rechtli- chen Rahmen politischer Inhalte betrafen, aus den Augen verloren hatte."1
Die parlamentarische Demokratie mit starker Präsidialmacht bekam im Laufe der Jahre fast den Charakter eines Ersatzkaisertums. Die Republik war geschaffen, aber kaum jemand konnte sich mit ihr identifizieren. Sie stand daher von vornherein auf höchst unsicherem Boden. Das Schlimmste aber war, daß die alten Herrschaftsstrukturen nahezu unverändert erhalten blieben:
"Die gesamte innere Verwaltung des wilhelminischen Obrigkeitsstaats blieb intakt erhalten; kein einziger Beamter, gleich ob Landrat, Polizeihauptmann, Zuchthausdirektor oder Staatsanwalt, wurde als Feind der Republik zwangs- pensioniert oder gar zur Rechenschaft gezogen, kein einziger Richter entlassen; und erst recht wurde keiner der kaiserlichen Generäle unter Anklage gestellt, kein Offizier brauchte sich wegen Menschenschinderei oder Kriegsver- brechen zu verantworten. Und so hatten die vorübergehend entmachteten alten Gewalten, vor allem die entschieden republikfeindlichen Militärs, im Handum- drehen das Heft wieder in der Hand."2
Am Beispiel Bayern bzw. München sollen nun die Anfänge der Republik dargestellt werden. Dieses Beispiel wurde gewählt, da sich hier linke Intel- lekt- uelle politisch betätigten, die teilweise wie z.B. Erich Mühsam und Gustav Landauer zum Umkreis der Weltbühne gehörten. In München wurde bereits in der Nacht vom 7. zum 8. November 1918 die Republik ausgerufen. Unter der Führung von Kurt Eisner, einem Berliner Intellektuellen jüdisch-gutbürgerlicher Herkunft, entschiedenem Pazifisten und Vorsitzenden der USPD in Bayern, wurde die Republik Bayern prokla- miert:
"Volksgenossen! Um nach jahrelanger Vernichtung aufzubauen, hat das Volk die Macht der Zivil- und Militärbehörden gestürzt und die Regierung selbst in die Hand genommen. Die bayerische Republik wird hierdurch proklamiert. Die oberste Behörde ist der von der Bevölkerung gewählte Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat, der provisorisch eingesetzt ist, bis eine endgültige Volksvertretung geschaffen werden wird. Er hat gesetzgeberische Gewalt. Die ganze Garnison hat sich der republikanischen Regierung zur Verfügung gestellt. Generalkom- mando und Polizeidirektion stehen unter unserem Befehl. Die Dynastie Wittels- bach ist abgesetzt. Hoch die Republik!
Der Arbeiter und Soldatenrat. Kurt Eisner."1
Der König verließ München und die monarchistischen Minister konnten keinen militärischen Gegenschlag ausüben, da sich die Truppen mit den Revolutionären verbrüderten. Der Vorsitzende der bayerischen MSPD, Erhard Auer, trat, zusammen mit der Führung seiner Partei, in Verhandlun- gen mit Eisner über eine gemeinsame Regierungsbildung ein. Der "Provisori- sche Nationalrat" bestätigte am 8. November 1918 die gemeinsame Regie- rung der beiden sozialistischen Parteien. Eisner wurde Ministerpräsident und Außenminister, Auer wurde Innenminister. Am selben Tag konstituierte sich ein "Revolutionärer Arbeiterrat". Diesem gehörten u.a. Erich Mühsam, Gustav Landauer, Ernst Toller, August Hagemeister, Carl Kröpelin und Max Levien an.
Die äußeren Bedingungen für die Regierung Eisner/Auer wurden immer ungünstiger. Die zurückgekehrten Truppen gestalteten die Lebensmittelver- sorgung zunehmend schwieriger. Anfang Januar mußte die Münchner Stadt- verwaltung 18.000 offiziell registrierte Arbeitslose und deren Familien unter- stützen. Auch in Bayern zeigte sich bereits zwei Monate nach der Regie- rungsübernahme, daß die alten Strukturen in der Verwaltung und in der Politik weiterbestanden. Monarchistisch-reaktionäre Kräfte wagten es wieder - teilweise toleriert und geschützt von führenden Mehrheitssozialisten - in der Öffentlichkeit aufzutreten. Am 12. Januar 1919 fanden die Wahlen zur bayerischen Nationalversammlung statt. Bei diesen Wahlen mußte Eisner eine Niederlage erleben. Seine USPD erhielt nur 2,5% der abgegebenen Stimmen. Stärkste Partei wurde die konservative Bayerische Volkspartei, die 35% der Stimmen erhielt. Zweitstärkste Partei wurde die MSPD mit 33% der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 86,8%. Zum ersten Mal durften Frauen und junge Leute ab 21 Jahren wählen.
"Eisners aussichtslose parlamentarische Lage zwang ihn, sich wieder verstärkt den Räten als Forum seiner Sozialismus-Vorstellungen und damit auch seiner Vorstellungen über die Einbeziehung der Räte in das politische Herrschaftssy- stem zuzuwenden und damit, teilweise ungewollt, die Radikalisierung der bayerischen Räte-Bewegung mit voranzutreiben."1
Die Hetze gegen den noch amtierenden Ministerpräsidenten Eisner und die Räte nahm zu. Die Presse trug wesentlich dazu bei, daß Kurt Eisner täglich Droh- und Schmähbriefe erhielt.
Am 21. Februar 1919, morgens kurz vor zehn Uhr, wurde Kurt Eisner auf dem Weg zum Landtag von Graf Anton Arco-Valley erschossen. Der Landtag wurde eine Stunde später eröffnet. Als erste Handlung verlas Auer einen Nachruf auf Kurt Eisner. Kurz nach dem Ende seiner Rede stürmte ein Mitglied des Revolutionären Arbeiterrates nach vorne und erschoß Erhard Auer und zwei weitere Anwesende.
Aus Protest gegen Eisners Ermordung legten die Arbeiter des Landes mit einem Generalstreik die bayerische Wirtschaft lahm. Eisners Begräbnis wurde zu einer riesigen Massendemonstration.
Am 25. Februar wurde der erste bayerische Gesamträtekongreß in München eröffnet. Die über 300 Delegierten lehnten mit großer Mehrheit den Antrag Erich Mühsams, Bayern zur sozialistischen Räterepublik zu erklären und die gesamte Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt den Räten zu überantworten, ab. Man einigte sich auf ein Kompromißpapier.
Einige Tage nach dem Ende des Rätekongresses trat der bayerische Landtag zu einer Sitzung zusammen. Programmpunkte der Regierung Hoffmann waren die Bekämpfung der Lebensmittelknappheit, Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit, die Freilassung der bayerischen Kriegsgefangenen, die Sozialisierung des Bergbaus und der Wasserkraftwerke und die Wahrung der Eigenständigkeit Bayerns im Reichsverbund.
Doch kaum einer dieser Punkte wurde von der Regierung in die Tat umgesetzt.
Angesichts der sich rapide verschlechternden ökonomischen Lage fanden in München fast täglich Massenveranstaltungen statt, an denen Redner wie der Anarchist Erich Mühsam und der Kommunist Max Levien die Notwendigkeit einer dritten Revolution betonten. Die Forderung nach der Räterepublik fiel zunehmend auf fruchtbaren Boden.
Mehrere Treffen am 4. April 1919 führen trotz der ablehnenden Haltung der KPD letztendlich zum Beschluß, die Räterepublik auszurufen. Am Morgen des 7. April veröffentlichte der Zentralrat die Proklamation der ersten bayeri- schen Räterepublik unterzeichnet u.a. von Gustav Landauer und Erich Mühsam.
Sechs Tage später wurde diese erste Räterepublik von Soldaten der Republikanischen Schutztruppe im Auftrag der nach Bamberg geflüchteten sozialdemokratischen Regierung Hoffmann gestürzt. 13 Räterepublikaner, unter ihnen Mühsam und Soldmann wurden verhaftet und nach Nordbayern gebracht. Im Namen der Garnison München wurde der Kriegszustand verhängt.
Doch bereits im Laufe des frühen Nachmittags, begannen sich die Anhänger der Räterepublik zu organisieren. Es kam zu bewaffneten Auseinander-set- zungen. Zu diesem Zeitpunkt entschloß sich die KPD-Führung, die eigene Mitgliedschaft und die Münchner Arbeiter und Soldaten zum Widerstand für die Räterepublik zu mobilisieren. Unter der Führung des Anarchisten Josef Sontheimer und des KPD-Mitgliedes Rudolf Eglhofer wurde der Putsch niedergeschlagen. Die Führung der zweiten Räterepublik lag in den Händen der KPD. Doch nun bekam die entmachtete Regierung Hoffmann Unter-stüt- zung von Noskes Gardekavallerie Schützendivision und starken Freikorps- Verbänden. Der Kommunist Eugen Leviné organisierte die Verteidigung der Stadt. Er nahm einige politische Gegner in Haft. Zehn davon wurden hinge- richtet. Dieser "Geiselmord" wurde fürchterlich gerächt. Am 30. April 1919 waren die konterrevolutionären Truppen und Freikorps in die bayerische
Landeshauptstadt eingedrungen. Die Freikorps-Söldner schossen auf alles, was sie für "spartakusverdächtig" hielten. Die genaue Anzahl ihrer Opfer ist unbekannt. (Die Schätzungen in den Geschichtsbüchern variieren zwischen 600 und 1200 Toten.) Gustav Landauer wurde von den Soldaten brutal ermordet, Eugen Leviné wurde von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt und sofort hingerichtet. Zwei weitere Mitglieder der Räte-Regierung wurden ebenfalls ermordet, die übrigen zu insgesamt 520 Jahren Gefängnis verurteilt. Das einst so liberale Bayern wurde nun von den rechten Ultras zur "Ordnungszelle" erklärt.
4.1.1Kulturelle und ideologische Strömungen
Mit der Novemberrevolution traten Ende 1918 expressionistische Kulturpro- gramme in den Vordergrund. Viele dieser Konzepte gingen bereits auf die Zeit vor 1914 zurück. Die Expressionisten bekämpften die "satte Bürgerlich- keit, das autoritäre Schulsystem, die patriarchalische Familienstruktur, die Häßlichkeit der modernen Großstädte, den ausbeuterischen Charakter des Kapitalismus, den preußischen Militarismus". Ihr Traum war eine ideale Gesellschaft, in der sich der Mensch in absoluter Freiheit und Ungehemmtheit entfalten konnte.
"Wie fast alle bürgerlichen Rebellionsbewegungen war der frühe Expressionis- mus weitgehend von der Idee der kleinen Gruppe, der Sezession, der geistigen Elite ausgegangen, welche den revolutionären Funken in die notleidende Menge wirft."1
Der Expressionismus war eine ästhetische und weltanschauliche Bewegung, eine
"geistige Auffassungsweise und generelle Bewußtseinsäußerung, die über die Literatur weit hinausreichte, sämtliche Künste - Malerei, Bildhauerei, Architektur, Tanz usf. - umfaßte und im Denken jener Zeit auffällige strukturelle Parallelen besaß.' [...] Viele der in den Bann der expressionistischen Subkultur gezogenen Zeitgenossen waren derselben Überzeugung: 'Durch den Begriff Expressionismus ist uns ein bestimmtes Verhalten im Geistigen bezeichnet. [...]' Ohne hier die pathetischen Oratorien des 'neuen Menschen' mit der expressio- nistischen Anthropologie gleichsetzen zu dürfen, die für seine Botschaft empfänglichen Zeitgenossen glaubten jedenfalls, 'daß er hindeutet auf eine gänzliche Umkehr nicht nur in unserer Kunstauffassung, sondern auch in unserer Lebens- auffassung'."2
Michael Stark bezeichnet den Expressionismus in seiner zeitgenössischen Definition als "Epoche des Großen Geistigen".
"Gegen den diagnostizierten 'Ungeist' der Zeit gerichtet, signalisierte der Verweis auf den 'Geist' einen zivilisationskritischen Idealismus."3
"Und: Expressionismus war eine schöne, gute, große Sache. Solidarität der Geistigen. Aufmarsch der Wahrhaftigen."4
Auch der anarchistische Theoretiker und Schriftsteller
"Gustav Landauer verstand unter einer Revolution die 'Neuregelung und Umwälzung durch den Geist' und stellte für die erstrebte egalitäre Gemeinschaft der Zukunft fest, daß 'die Gerechtigkeit immer von dem Geist abhängen wird, der zwischen den Menschen waltet, und daß es ein vergebliches Bemühen ist, ein für allemal Patenteinrichtungen zu schaffen."5
In seinem Aufsatz, "Anarchismus und Expressionismus bei Mühsam", weist Wolfgang Haug auf die Verwandschaft von Expressionismus und Anarchis- mus hin. Gemeinsam war ihnen das Denken, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, auch "Leo Tolstois urchristlicher Anarchismus wurde gerade von den Expressionisten als geistesverwandt aufgegriffen."
Besonders der "Aktivismus" - als Nebenströmung des Expressionismus "erstrebte ein neues Zeitalter durch Aktivierung des Geistigen und geistige Befreiung des Menschen, bei der dem Schriftsteller eine Führerrolle zufiele."1 Diese betont intellektuelle Richtung versucht durch politisches und gesellschaftliches Engagement eine grundlegende soziale Umgestaltung der Gesellschaft zu erreichen. Diese Nebenströmung wurde von Kurt Hiller begründet, weitere Vertreter waren u.a. Heinrich Mann (der mit seinem 1910 erschienenen berühmten Essay "Geist und Tat" als einer der geistigen Ziehväter des Expressionismus betrachtet werden kann) und Ludwig Rubiner.
Nach 1919 wurde aufgrund der ernüchternden Erfahrungen der Novemberre- volution die Gruppe der "wahren" Expressionisten wesentlich kleiner. Diejeni- gen, die ihren utopischen Hoffnungen treu blieben, sahen, was sich auf der politischen Ebene abspielte: die Niederschlagung des Spartakusauf-standes und das Ende der Münchener Räterepublik. Sie erkannten die "unheilige Allianz" zwischen Reichswehr, Kapital und SPD. Sie dachten weiterhin revolutionär. Die Entwicklung hatte zwar zu einer Republik geführt,
"aber eben zu einer Republik, die - gemessen an ihren Idealen - als 'negative Monarchie', als 'Spießer-Eldorado', als 'Schieber-Republik' weit hinter jenen Zielvorstellungen absoluter Freiheit, absoluter Gleichheit und absoluter Brüder- lichkeit zurückgeblieben war, nach denen sich die Überhaupt-Expressionisten gesehnt hatten."2
4.2 Ignaz Wrobel - "Revolution des Geistes"
.., keine himmlische Macht ist Menschen gegeben. Doch: eine. Die Menschen zu lieben, aber nicht, sie mit F üß en zu treten. Wir speien auf das Militär - aber wir lieben die neue, uralte Menschlichkeit." 1
In diesem Zeitabschnitt wird Tucholskys Nähe zum Expressionismus bzw. Aktivismus deutlich. Als Individualist schloß er sich aber keiner der verschiedenen Gruppen der literarischen Bohème an.
Im ersten unter dem Pseudonym Ignaz Wrobel erschienen Artikel in der Weltbühne, setzte sich Tucholsky mit einem Buch von Josef Hofmiller auseinander. Dieses behandelte Aussagen des Philosophen Fichte und untersuchte, "Inwiefern Macchiavellis Politik auch noch auf unsre Zeiten An-wendung habe". Der Autor wollte offenbar darstellen, daß sich die Politik nach den rein machtpolitischen Interessen eines Landes auszurichten habe: "Dieser Politik durch Humanität, Liberalität oder gar Ethik zu begegnen, käme dem Selbstmord eines Landes gleich."
Ignaz Wrobel stellte diese Aussage in Frage und betonte die seiner Meinung nach unbedingt notwendige Trennung von Gewalt und Ethik:
"Seinen graden Weg für sein Land gehen, über Leichen, über zerstörtes Glück, über Mensch ist eines; und nach der Lehre seines Gottes leben und dabei kümmerlich leben, ist ein andres. Die Ethik aber vorschieben, wenn es mit der Gewalt nicht geht, und die Wolfsklaue aus dem Schafspelz stecken: das zu tun, sei uns versagt. [...] Das ist keine Ethik, der eine höhere Idee - die des Staates - übergeordnet ist. Das ist keine Ethik, die sich mit den Landesfarben anstreichen läßt.
Das ist keine Politik, die nicht den Mut hat, frisch und frank zur Gewalt und nur zur Gewalt zu greifen, sondern die die Ethik wieder braucht, sie mißbraucht. [...] Habt ihr nicht mehr den Mut, das Ideal zu fordern, als sei es erreichbar? Sagt ihr gleich der Menge: Wir fehlen doch, wozu noch streben? Laßt uns schon am ersten Tage sündige Menschen sein! Es ist in diesem Kriege das bittere Wort von dem Moratorium der Bergpredigt gefallen; wir können sie aber nicht außer Kraft setzen, mit rückwirkender Kraft vom ersten August 1914. Man glaubt oder man glaubt nicht. [...]
Wir verdammen diese Politik nicht, weil sie unsittlich ist. Mag sie unsittlich sein, mag sie angewandt werden, weil sie zum Erfolge führt - aber sie ist Politik und nur Politik. Hell leuchtet gegen diesen dunklen Fleck ein strahlender Stern. [...] Einer leuchtet dagegen, der unbedingt war, so unbedingt, daß die Pharisaer vor ihm erschraken, einer, für den Erfolg nicht in Frage kam und nicht Geltung und nicht Macht. 'Indem ein Mann, der in allen Umständen gut sein wollte, unter der Menge Derer, die nicht gut sind, notwendig zugrunde gehen mußte.' Und Christus hing am Kreuz. Warum hatte er auch den Macciavelli nicht gelesen!"1
Dieser Text berührt, man muß ihn mehrmals lesen! Die Brisanz dieses Artikels ist heute noch vorhanden (man denke nur an die Diskussionen, Militär- einsatz in Krisengebiete) und wird wohl immer vorhanden sein.
Dieser Artikel klingt allerdings noch nicht kämpferisch. Ignaz Wrobel beschrieb darin den herrschenden Zeitgeist und setzte seine Vorstellung von Humanität, Liberalität und Ethik dagegen. Durch die Gegenüberstellung von Macchiavelli und Jesus ermöglichte Wrobel dem Leser, diesen krassen Gegensatz und somit die Unvereinbarkeit dieser beiden Lehren zu erkennen. Hier wird Wrobels Aufgabe als Satiriker deutlich:
"Der Satiriker bezieht sich auf die Widersprüche des Lebens und verpflichtet sich zum Widerspruch aufgrund dieser Widersprüche."2
Tucholsky sah sich als einen deutsch-jüdischen Intellektuellen in der Tradition Humboldts.
"Bildung, Kultur und Ästhetik galten seit der Epoche der Aufklärung als wichtige Voraussetzungen für Moral und Vernunft."3
Den Gebrauch von Gewalt lehnte er in jeglicher Form ab. Daher läßt sich auch seine ablehnende Haltung gegenüber dem "Klassenkampf" während dieser Zeit erklären. Er fürchtete den Umsturz, hatte Angst, man könnte ihm seine Ideale wegnehmen. Seine Vorstellung von Erneuerung war eine andere. Er glaubte an das "Gute im Menschen". Daher wollte er die Menschen "aufklären", und sie somit veranlassen, den "moralischen Impera- tiv" zu erkennen. Allerdings lassen sich daraus keine konkreten politischen Ziele ableiten. Michael Hepp zitiert hierzu Georg L. Mosse, welcher die Weltbühnen-Mitarbeiter als "kantianische Sozialisten" bezeichnete. Diese würden "den ewigen Imperativ von Gerechtigkeit und Freiheit sowie kriti- sches, vernunftgeleitetes Denken über die konkrete politische Arbeit stellen."4
Anfang 1919 erschien Wrobels sechsteilige "Militaria"-Artikelserie in der "Weltbühne". Diese Serie bildete den Anfang einer immer wiederkehrenden Militärkritik. Die verderbliche Rolle des Militarismus und seiner Auswüchse wurde von Ignaz Wrobel früh thematisiert und als eine der für die Republik bedrohlichsten Gefahren entlarvt. Im ersten Teil "Offizier und Mann" forderte Ignaz Wrobel:
"den Deutschen den Knechtsgeist auszutreiben, der nicht gehorchen kennt, ohne zu kuschen - der keine sachliche Unterordnung will, sondern nur blinde Unterwerfung."1
Auch hier sind die Vorbehalte gegenüber den "Linken" zu spüren. Der Schluß des Artikels lautet:
"Spartakus ist es nicht; der Offizier, der sein eigenes Volk als Mittel zum Zweck ansah, ist es auch nicht - was wird es denn sein am Ende? Der aufrechte Deutsche."2
Wrobel wollte hier das Individuum ansprechen. Sein Appell galt dem einzelnen Menschen. Dieser sollte seine Einstellung unabhängig vom Geist der Gruppe neu überdenken.
In "Militaria II" geht es um die Verpflegung während des Krieges. Wrobel kriti- sierte hier die Unterschlagung von Lebensmitteln durch die Offiziere. Während diese "über Gebühr gut und saturiert" leben konnten und darüber- hin- aus auch noch ihre Familien aus Heeresbeständen versorgen konnten, mußte der einfache Soldat von "Brot und Marmelade" leben. Eine Woche später behandelte er im dritten Teil "Von großen Requisitionen" die Diebstähle der Offiziere. Opfer waren die Menschen in den besetzten Gebieten.
"Der deutsche Offizier [...] stahl ohne Bedenken, allerdings fast nur im großen Stil."3
"Von kleinen Mädchen" ist der vierte Teil überschrieben. Auch die weiblichen Hilfskräfte, die ins Heer geschickt wurden und die Landeseinwohnerinnen "gehörten" meistens den Offizieren.
"Ein großer Teil der jungen Damen ist in Grund und Boden verdorben nach Hause gekommen. Nicht etwa, weil sie geliebt haben. Sondern weil sie gesehen haben, daß der Mann ihnen - ohne viel Arbeit - alles bot, daß Deutscher auf Deutschem herumhackte, weil der Offizier ihnen in besetzten Schlössern mit unterschlagenen Lebensmitteln, mit widerrechtlich erzwungenen Arbeitskräften, in widerrechtlich angeeigneten Wagen und Equipagen ein Leben vortäuschte, das zu Hause die Eltern ihnen niemals bieten können."4
Der 5. Teil behandelte den vaterländischen Unterricht. Diesen stellte Wrobel als "hinterhältig, von oben herab und durchtränkt von der Unterschätzung aller Menschen, die nicht Offiziere und Regierungsassessoren waren" dar.
"Fast alle deutschen Professoren und fast alle bekannten Schriftsteller" gaben sich dazu her "diesen Unterricht zu vermitteln" und das "Blaue vom Himmel" herunterzulügen "über die Minderwertigkeit der Feinde und über die gottgefällige Verfassung des deutschen Heeres."1
Im 6. und letzten Artikel dieser Serie, "Unser Militär" faßte Ignaz Wrobel die Greueltaten des Militärs nochmals zusammen. Und dennoch:
"Aber unbeirrbar steht der deutsche Spießer, nein, der deutsche Bürger da, [...] und als seien Krieg und Zusammenbruch nicht gewesen, ruft er stolz tönend in die Lüfte: 'Unser Militär!' Wie ist das zu erklären? Wie kann ein Volk gedeutet werden, daß [sic.] nach allem, was geschehen ist, nach allem, was es erfahren und gelitten hat, den verlorenen Krieg als einen kleinen Betriebsunfall ansieht [...] und das heute, heute am liebsten das alte böse Spiel von damals wieder aufnehmen möchte: die Unterdrückung durch aufgeblasene Vorgesetzte, [...] die schimmernden vergötterten Abzeichen, der Götze Leutnant - unser Militär!"2
Ignaz Wrobel erblickte schon die drohende Gefahr:
"Sie zittern und gieren auf den Augenblick, da eine neue Kompromißregierung das neue Volksheer errichtet - 'natürlich nur ein geordnetes Heerwesen mit festen Befehlsverhältnissen'. Selbstverständlich. Sie pfeifen auf alle Prinzipien. Sie stehen auf dem Boden des neuen Staates. Und der Unteroffizier wird wieder den Rekruten ins Kreuz treten - natürlich auf demokratischer Grundlage."3
Um dies zu verhindern und dieser Gefahr wirksam entgegentreten zu können, setzte er wiederum auf die Menschlichkeit. Die Geistigen sollen nun die Macht übernehmen:
"Wir Deutsche zerfallen in drei Klassen: die Untertanen - die haben bisher geherrscht [Anmerkung der Verfasserin: Der Begriff bedeutet: der "widerwärtig interessante Typus des imperialistischen Untertanen, des Chauvinisten ohne Mitverantwortung, des in der Masse verschwindenden Machtanbeters, des Autoritätsgläubigen wider besseres Wissen und politischen Selbstkasteiers"]4 ; die Geistigen - die haben sich bisher beherrschen lassen; die Indifferenten - die haben garnichts getan und sind an allem Elend schuld. Und mit derselben Macht und mit derselben Faust wie die bunten Burschen, aber getrieben von strömendem Herzblut, ringen wir um die schlafenden Seelen Deutschlands. Land! es gibt Höheres, als vor der Geliebten mit einem Rang zu prunken! Land! wir Deutsche sind Brüder, und ein Knopf ist ein Knopf und ein Achselstück ein Achselstück. Kein Gott wohnt dahinter, keine himmlische Macht ist Menschen gegeben. Doch: eine. Die Menschen zu lieben, aber nicht, sie mit Füßen zu treten. Wir speien auf das Militär - aber wir lieben die neue, uralte Menschlichkeit."5
Zunehmend erkannte Tucholsky, daß nur das gemeinsame Bündnis mit allen antimilitaristischen Kräften eine Veränderung bringen konnte. Dies kam zum ersten Mal im Artikel "Die lebenden Toten" von Ignaz Wrobel zum Ausdruck. Wrobel beschrieb in diesem Artikel den Mordprozeß in
Sachen Liebknecht und Rosa Luxemburg. Auf diesen Artikel wird am Ende dieses Zeitabschnitts näher eingegangen.
Dennoch blieb Tucholskys Ziel weiterhin die geistige Revolution. In einem weiteren Artikel "Militaria" wiederholte, verteidigte und untermauerte er die Offizierskritik seiner Militariaserie. Grund dafür waren massive Angriffe der deutschnationalen Presse und des Offiziersbundes. Auf neun Seiten widerlegte er die Argumente, die viele entrüstete Briefe an ihn und den Herausgeber der Weltbühne enthielten:
"Was wir hier betrachten, angreifen, bewerten und für ethisch hoffnungslos halten, ist das Treiben, das sich Tag für Tag draußen abgespielt hat, und über das sich kaum Einer mehr - bis auf die Leidenden - aufhielt. Nicht die großen Skandale sind es, nicht die Sonderfälle, die sich überall einmal ereignen, sondern der tägliche Wust von Unehrlichkeit, Diebstahl an Nahrungsmitteln, den Niemand mehr als Diebstahl empfand, Mißbrauch der Dienstgewalt und brutaler Unterdrückung der fremden Nationen."1
Hier verteidigte Wrobel seine Aufgabe als satirischer Künstler: Er wollte die Welt gut haben, daher kämpfte er gegen das Schlechte an. Und dieser "Kampf eines ehrlichen Mannes", "darf nicht mit dicken Worten zunichte gemacht werden".2
Am Schluß dieses Artikels forderte Wrobel abermals die geistige Revolution:
"Wir werden dafür zu sorgen haben, daß ohne zerschlagene Fensterscheiben und ohne politische Morde in den Köpfen unsrer Volksgenossen eine geistige Revolution entsteht, wie sie bisher gefehlt hat. [...] Wir sprechen zu unsern
Landsleuten, zu dem Deutschland, das wir lieben, und wir wollen, daß es immer und unter allen Umständen Denen den Gehorsam verweigert, die Menschenun- würdiges von ihm verlangen. Menschenunwürdig aber ist eine Disziplin ohne moralische Einsicht, ist die Annahme, Einer stehe vermöge seines Amtes auch menschlich über dem Andern; menschenunwürdig ist die Unterdrückung sogar innerhalb der eignen Nation. Wir bekämpfen nicht den einzelnen Offizier. Wir bekämpfen sein Ideal und seine Welt und bitten alle Gleichgesinnten, an ihrer Zerstörung mitzuhelfen. Nur sie kann uns eine neue, reinere Heimat geben."3
Doch bereits zwei Monate später war seine Hoffnung auf diese geistige Revolution jäh geschwunden. Zurückgekehrt von einer Reise in die Provinz, mußte Wrobel erkennen, daß dort noch viel eklatanter als in der Großstadt, der gesamte Mittelstand von irgendwelchen neuen Gedanken gänzlich unberührt war. Weiterhin wurde dort vom Militär geschwärmt, kritische Gedanken dazu gab es nicht. Vor allem die Jugend, geistiger Hoffnungsträ- ger der Zukunft, stellte in der Provinz eher eine Bedrohung für die Demokra- tie dar:
"Was da heranwächst, läßt die schlimmsten Befürchtungen wach werden. Immer wieder ist mir begegnet, daß um den runden Tisch herum die Aeltern [sic.] noch allenfalls, hier und da, ein klein wenig, herber Kritik zustimmten. Aber die Jungen? Begeisterte Leutnants, begeisterte Regierungsreferendare, begei- sterte Anhänger eines Systems, das der Jugend Ideale aus Gips gab (während die Neuen allerdings nicht einmal dergleichen zu vergeben haben). Wehe der Jugend, die nicht ein Mal in ihren Jahren umstürzlerisch gesinnt ist - hat einmal in diesen Blättern gestanden."1
Wie recht er damit hatte, wissen wir. Allerdings ist dies nicht die einzige richtige Vorhersage dieses Artikels. Betroffen stellt man fest, wie schrecklich wahr die folgende Aussage wurde:
"Die Revolution. Man spricht ungern von ihr. Und wenn, mit unverhohlener Verachtung. Sie ist selbst daran schuld - denn sie ist Keinem ernstlich zu Leibe gegangen. Kämen ihre Gegner heute ans Ruder: wir erlebten in Deutschland eine Menschenschlächterei, von der Liebknechts und Landauers Ermordung ein unzureichender Vorgeschmack war."2
Am Ende dieses Jahres spürt man bereits Tucholskys aufkommende Re-si- gnation:
"Es scheint mir nun einmal an der Zeit, hier öffentlich auszusprechen, was ich seit langem auf dem Herzen habe. Ich weiß, daß das taktisch nicht richtig ist; ich weiß, daß man den Mitkämpfern den Mut nicht nehmen soll, ich weiß auch, daß ich trotzdem nicht aufhören werde, für Menschen gegen das alte deutsche Offizierscorps zu kämpfen: Aber ich muß es einmal sagen: Dieser Kampf scheint aussichtslos."3
Anlaß für diese Aussage war der "Prozeß Marloh". In seinem letzten Artikel des Jahres 1919 beschrieb Wrobel den Mord an neunundzwanzig Menschen der Volks-Marine-Division. Aufgrund des Hinweises eines Spitzels, wonach diese Division einen Putsch plane, wurde der junger Offizier Marloh mit fünfzig Mann entsandt. Ohne besagten Hinweis weiter zu prüfen, besetzte er die Räume der Division und ließ neunundzwanzig der dreihundert Menschen grauenvoll hinrichten. Später wurde er von einem Sondergericht für diese Tat freigesprochen.
Der brutale Mord, die Vertuschung durch die hohen Offiziere und der Verlauf des Prozesses veranlaßten Wrobel zu der Aussage:
"Es scheint aussichtslos. Wir kämpfen hier gegen das innerste Mark des Volkes, und das geht nicht. Es hat keinen Sinn, die Berichte Punkt um Punkt durchzugehen, hier Widersprüche nachzuweisen und da Lügen, Roheiten und Minderwertigkeiten. Daß die Dienststellen der sogenannten Zeugen keinen Mann dieser Gesellschaft auch nur vom Dienst suspendiert haben, war nicht anders zu erwarten. Daß der Reichswehrminister sich der Lämmer annahm, ist selbstverständlich. Er steht und fällt mit diesem Pack. Er hat sie benutzt, sie wollen Lohn. Und er zahlt."4
Wrobel durchschaute hier bereits das Spiel der Militärs und erkannte gleich- zeitig die unsägliche Rolle, die Noske dabei inne hatte. Die Entwicklung der Rechtsprechung erahnte er bereits:
"Ist denn moralische Sauberkeit wirklich nicht mehr das absolut erste Erfordernis des öffentlichen Lebens? Wohin geraten wir? Wo treiben wir hin? Wohin soll es führen, wenn nun auch die Rechtsprechung anfängt, zu wanken: wenn politische Gesichtspunkte ganz offen Sondergerichte beeinflussen? Wie lange noch, und die ordentlichen Gerichte folgen. Und dann ists aus."1
Resigniert mußte Wrobel am Ende dieses Jahres feststellen:
"Pathos tuts nicht und Spott nicht und Tadel nicht und sachliche Kritik nicht. Sie wollen nicht hören. Sie hängen mit ihrem ganzen Herzen an den 'Herren', an Menschen, die nicht einmal leidenschaftlichen Haß verdienen, sondern nur Verachtung. [...] Sie sehen nicht, sie hören nicht, und der himmlische Noske ernährt sie doch.2
Trotzdem geht Wrobel nicht ohne Hoffnung ins neue Jahr, am Ende des Artikels schrieb er:
"Trotzalledem: [...] Das Ziel ist fern. Aber es gibt eins."3
4.3"Die lebenden Toten" - eine Interpretation
Zunächst zum Tathergang. Was war geschehen?
Der nun folgende geschichtliche Exkurs stützt sich wesentlich auf die umfangreichen Recherchen von Klaus Gietinger. Gietinger bezeichnet in seinem Aufsatz den Mordprozeß vor dem Kriegsgericht "als einen der großen Justizskandale unseres Jahrhunderts".
Am Abend des 15. Januar wurden Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg von Bürgerwehr-Leuten und Soldaten in ihrem Wilmersdorfer Unterschlupf aufgespürt und abgeführt. Sie wurden ins Eden-Hotel gebracht. Waldemar Pabst, 1. Generalstabsoffizier der Garde-Kavallerie-Schützen-Di- vision entschied, beide "erledigen" zu lassen. Er schickte Hauptmann Pflugk-Harttung mit dem "Sonderauftrag" los, einige Marineoffiziere aus dem Quartier "In den Zelten" zu holen, die in der Sache behilflich sein sollten. Nachdem diese gefunden waren (darunter war auch der Bruder von PflugkHarttung), wurde folgender Plan beschlossen:
"Eine mit 'Standgericht' bezeichnete Entscheidung wurde getroffen: Pflugk- Harttung, Stiege, Schulze und von Ritgen sollten Liebkenecht im Tiergarten 'auf der Flucht' erschießen. Für die hinkende Rosa Luxemburg konnte dieser Weg kaum gewählt werden, also entschloß sich Pabst, sich von einem Unbekannten 'aus dem Menge heraus' töten zu lassen. Alle Offiziere erklärten sich freiwillig zur Tat bereit, die vier für Liebknecht und Souchon für Luxemburg."1
Ein ebenfalls im Eden anwesender Offizier, Hauptmann Petri, hatte unabhängig und in Unkenntnis der Beschlüsse des ersten Generalstabsoffizieres, dem vor dem Hotel Wache stehenden Jäger Runge den Auftrag gegeben, Liebknecht zu töten.
Als Liebknecht ins Auto vor dem Hotel transportiert wurde, trafen ihn die Kolbenschläge von Runge. Diese Schläge waren allerdings nicht tödlich. Das Auto fuhr an. Um 23.15 Uhr wurde Liebknecht als unbekannter Toter bei der Rettungswache am Zoo eingeliefert.
"Das Mordkommando kam zurück und meldete Vollzug. Souchon ging nach draußen. Pabst ließ den Transport mit Rosa Luxemburg abgehen. Auch diesmal waren die Kolbenschläge Runges nicht eingeplant. Luxemburg wurde ins Auto geworfen wie ein Stück Vieh. Der Wagen fuhr an, von Rzewuski sprang kurz auf, schlug auf die Bewußtlose ein und sprang wieder ab. Mit an hoher Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sprang dann nach weiteren 40 m Fahrt an der Ecke Kurfürstendamm/Nürnberger Straße, Souchon, der dort im Dunkeln kurz gewartet hatte, auf das Trittbrett des Wagens und erschoß Rosa Luxemburg als 'Unbekannter aus der Menge'."1
Die Leiche wurde in den Landwehrkanal geworfen.
Am 8. Mai 1919 begann der Prozeß.
"Durch die gleiche Türe wie die Richter betraten die Angeklagten den Saal, dessen Kopfende ein riesiges Bild Kaiser Wilhelms II. zierte und zeigten sich während der folgenden Tage guter Dinge. [...] Der Prozeß zeichnete sich vor allen Dingen dadurch aus, daß so gut wie alle Uniformierten Lügen auftischten, 'daß sich die Balken bogen'. Man kann sogar sagen: Je höher der Dienstgrad, um so dreister waren die Lügen."2
Der Freund von Pabst und Kaleu Pflugk-Harttung, Canaris, wurde zu einem der Richter bestimmt. Der Kriegsgerichtsrat Jorns bemühte sich um die Vertuschung der Tatbestände und die Begünstigung der Angeklagten. Der Vorsitzende Ehrhardt war stets darauf bedacht, jeglichen Verdacht von seiner Division abzuweisen. Dies führte letztendlich dazu, daß im Falle Liebknecht der Darstellung der Gebrüder Pflugk-Harttung, wonach der schwerverletzte Liebknecht einen Fluchtversuch unternommen habe und von der Begleitmannschaft erschossen worden sei, geglaubt wurde. Somit wurden die Offiziere Pflugk-Harttung, Stiege, Schulze und von Ritgen freige- sprochen. Im Falle Luxemburg lautete, bedingt durch unterschiedliche Zeugenaussagen und die immer noch fehlende Leiche, die Anklage nicht auf Mord sondern auf Mordversuch.
"Somit gab es zwar eine tote Rosa Luxemburg, die noch irgendwo im Landwehrkanal trieb, aber es gab keinen Mörder, sondern nur zwei, die einen Mordversuch begangen hatten. Das Kameradengericht war hier noch weitaus radikaler. Es sprach Vogel auch vom Mordversuch frei, da es annahm, jener unbekannte Marineoffizier, der "siebte Mann" im oder am Wagen, habe die Schüsse abgegeben. Dadurch konnte man im Falle Luxemburg milde Urteile fällen: Runge bekam u.a. wegen versuchten Totschlags zwei Jahre Gefängnis. Vogel wurde vom Vorwurf des versuchten Totschlags freigesprochen und u.a. wegen Beiseiteschaffung einer Leiche zu zwei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt."3
Im Zusammenspiel zwischen Justiz und Division wurde dann aber Vogel die Flucht nach Holland ermöglicht.
Ignaz Wrobel nimmt den Prozeß zum Anlaß, um über die Machenschaften von Militär und Justiz zu schreiben. Das "Vorspiel" für seinen Artikel liefert eine Prosa-Satire von Roda Roda, in der das Zusammenspiel von Justiz und Militär aufgezeigt wird. "Man hat eben die selbe gute Kinderstube."
Der erste Absatz leitet "das Stück" ein. Ignaz Wrobel beschreibt die Mit-wir- kenden. Bei der Beschreibung der Angeklagten erwähnt er George Grosz. Sofort erscheinen vor dem inneren Auge des Lesers die diversen Karikaturen des Künstlers. Die üble Visage des Mörders Runge und die Plakatgesichter der Offiziere werden dadurch noch besser vorstellbar.
Wrobels Artikel ist keine Prozeßberichterstattung im eigentlichen Sinne, sondern zunächst eine satirische Darstellung. Sein Haß gegenüber den Beteiligten wird durch seine ironische Sprache deutlich. Beispiel:
"Stolz steht er da im strahlenden Schmucke seiner Orden, versehen mit viel Vaterlandsliebe und einer leeren Revolvertasche ... Die Zeugen fahren auf ... Aber was wird denn hier gespielt? Eine Tragödie? Rache und Sühne? Kaum, höchstens deren fünfter Akt."1
So wird die Beziehung zum Adressaten aufgebaut. Sein Angriff dient der Abschreckung vor solchen Personen, er weist auf die fehlende moralische Norm dieser Personen hin.
Durch seine Beschreibung wird der ganze Aufsehen erregende Prozeß zur Karikatur eines Prozesses. Das Wesen dieses Vorgangs wird sichtbar gemacht.
Am Ende seiner Berichterstattung erscheint allerdings ein gewisser Wider- spruch:
"Der Fall [Luxemburg] liegt also wesentlich schwerer, und es besteht die Wahrscheinlichkeit, daß das Gericht hier zu einer Verurteilung gelangen wird. Denn das Gericht ist des besten Willens voll. Der Verhandlungsleiter ist ein sympathischer jüngerer Mann, der mit viel Takt und Umsicht arbeitet, wenn ihm auch hier und da einige Suggestionsfragen durchrutschen. Aber was nutzt das alles?"2
Wrobel geht hier eigenartigerweise vom guten Willen des Gerichts aus. Auch scheint er überzeugt zu sein, daß das Gericht zu einer Verurteilung gelangen wird.
Doch im nächsten Abschnitt wechselt er den Tonfall. Die satirisch-überle- gene Distanz weicht der Betroffenheit. Nun tritt Wrobels ideologische Betrachtungsweise in den Vordergrund. Er beginnt mit dem Angriff:
"Ich bin des trocknen Tones nun satt, und es soll einmal gesagt werden, was zu sagen bitter nottut."3
Jetzt durchschaut er den Sinn dieses Verfahrens. Seine Berichterstattung weicht einer allgemeinen Militärkritik:
"Wir pfeifen auf ein solches Verfahren. Wir kennen nun alle, meist aus eigner Anschauung, die Schliche und armseligen Pfiffe dieses Militarismus, der sich hinter die Maske der tadellos korrekten 'Meldung' verkriecht, nachdem er seine
Schiebungen inszeniert hat. So, wie damals auf die Angaben Vogels hin die gesamte deutsche Presse über den Hergang bei der Ermordung belogen worden ist, so kann es diesmal wieder gehen - wer garantiert uns, daß nicht wieder bei den Angeklagten 'Zweckmäßigkeitsgründe' maßgebend sind?"1
Man erkennt, daß der Mord und der Prozeß der Anlaß war, um abermals Kritik am Militarismus zu üben. Dieser Militarismus wird letztendlich durch seinen Einfluß auf das Gericht (möge es noch so "des besten Willens voll" sein), die Bestrafung der Mörder - der Kameraden - verhindern. Mit dem Personalpronomen "wir" vereinnahmt Wrobel den Leser. Das "Wir" steht für das "moralisch Gute" also für "alles Menschliche" und "Fortstreben- de". Im Gegensatz dazu manifestiert sich im "sie", das "moralisch Verwerfli- che" - der Militarismus. Dieser bedeutet, "falsche Kollektivität", "Schiebung", "die alte, schlechte Gesinnung", die "Über- und Unterordnung von lebenden Menschen" und "das Zurückzerrende".
"Hüben wir und drüben sie" - und es gibt keine Brücke.
Im vorletzten Absatz leitet der Autor durch rhetorische Fragen zu seinem persönlichen Bekenntnis über:
"Hetzen wir? Sind wir nicht sachlich genug? Nur ein Mal noch, nur dieses eine Mal noch erlaubt mir, daß mein Herzblut spricht, und nicht das Gehirn. Das soll euch werden: die kälteste und klarste Sachlichkeit. Aber dieses Mal nicht. Aus ihren Gräbern rufen zwei Tote. Ihr könnt die Schreie nicht hören, denn ihr seid taub. Wir aber hören sie. Und vergessen sie nicht."2
Man erkennt, daß der gesamte Artikel dreistufig aufgebaut ist. Mit diesem Stufenaufbau Satire - politisches Manifest - persönliches Bekenntnis wird der Leser emotional in das Berichtete verwickelt. Dadurch, daß er der emotiona- len Bewegung des Autors folgt, findet stufenweise eine Identifizierung mit dem Geschriebenen statt. Letztendlich fühlt sich der Leser dem "Wir" zugehörig und begreift, daß die Sache ihn selbst betrifft. Ihm wird klar, daß nur das gemeinsame Vorgehen gegen den Militarismus die alten Zustände zerschlagen kann.
So kann Wrobels euphorischer Schluß durchaus als Appell an seine Leser betrachtet werden, gemeinsam, im Streben nach Neuem, das "Zurück- schreitende" - den "Kasernenhof" - zu bekämpfen. Gemeinsam bedeutet auch, Seite an Seite mit den Revolutionären und Idealisten. Daher tritt hier zum ersten Mal die Verbundenheit mit diesen in Erscheinung. Sein Schluß klingt siegesgewiß:
"Die drüben kleben zusammen wie die Kletten - wir sind aneinander geschmiedet durch das Gedächtnis an Eisner und seine Brüder. An unsre Brüder. [...] Das Ding liegt so: da steht der Militarismus, da stehen wir. Und weil die Welt nicht in Staaten, wohl aber in Fortstrebende und Zurückzerrende zerfällt, müßt ihr beiseite gehen, in voller Uniform, in Feldbinde, Ordenschmuck und Helm. Und was die Toten rufen, ruft unser Herz: Ecrasez L'infâme!"1
5 1920-1924: Reaktion und Inflation bedro- hen die Republik
5.1 Geschichtlicher Rückblick
Am 10. Januar 1920 trat der Versailler Vertrag in Kraft. Ein Punkt dieses Vertrages war die Begrenzung der Streitkräfte beim Heer auf hunderttausend und bei der Kriegsmarine auf fünfzehntausend Mann. Von der inzwischen 400000 Mann starken Reichswehr hätten also dreiviertel der Streitkräfte, insbesondere ein Großteil der Freikorps, entlassen werden müssen. Der innerliche Protest, mit dem die meisten den Versailler Vertrag hingenommen hatten, schlug nun in offenen Widerstand um. Auf die seit Februar kursieren- den Gerüchte über einen bevorstehenden Militärputsch reagierte die Regie- rung nicht. General Walther Freiherr von Lüttwitz war durch die bevorste- hende Reduzierung der Truppen in seiner militärischen Position unmittelbar betroffen. Eine ihm unterstehende, etwa 5000 Mann starke, schwerbewaff- nete "Elite-Einheit", die "Brigade Ehrhardt", sollte aufgelöst werden. Diese Gruppe, unter der Führung ihres Korvettenkapitän Hermann Ehrhardt, war extrem republikfeindlich und erstrebte eine Neuordnung Deutschlands nach ihren Idealen.
Lüttwitz verlangte bei einem am 10. März stattfindenden Gespräch mit Ebert und Noske die Rücknahme des Auflösungsbefehls und seine Ernennung zum Oberbefehlshaber, außerdem forderte er Neuwahlen des Reichstages und die Berufung von politisch unabhängigen Fachministern.
Als seine Forderungen abgelehnt wurden, versuchte er diese mit Gewalt durchzusetzen. Er befahl nun seiner "Brigade Ehrhardt", am nächsten Tag in Berlin einzumarschieren und "das rote Pack" davonzujagen. Nun verständigte General Ludendorff diejenigen, welche die Regierung übernehmen sollten. Unter ihnen der ostpreußische Landschaftsdirektor Wolfgang Kapp (vorgesehen als Reichskanzler) und Anführer der rechten Verschwörer- gruppe "Nationale Vereinigung", Oberst Bauer, Chef der GardekavallerieSchützendivision und Hauptmann Waldemar Papst.
"Die Putschisten waren durchaus bereit, auf Reichswehr und Polizei zu schie- ßen, wogegen die Sicherheitskräfte entschlossen waren, die bedrohte Reichs- regierung nicht zu verteidigen. Ebert und Noske waren also von ihren gesamten Streitkräften, mit denen sie die Revolution in Deutschland blutig niedergeworfen hatten, teils nun selbst unmittelbar bedroht, teils im Stich gelassen."1
Das Kabinett floh zunächst nach Dresden, dann nach Stuttgart.
Vor ihrer Flucht verfaßten die sozialdemokratischen Kabinettsmitglieder einen Aufruf an die Bevölkerung. Dieser forderte zum Widerstand auf und proklamierte den Generalstreik.
Der Generalstreik begann bereits am Sonntag, dem 14. März, in Berlin und dehnte sich innerhalb eines Tages auf ganz Deutschland aus. Eine spontan solidarische Arbeitnehmerschaft, bestehend aus SPD, USPD und KPD-Mit- gliedern, Mitglieder der liberalen und christlichen Gewerkschaftsverbände und Mitgliedern des Deutschen Beamtenbundes legte binnen kürzester Zeit, den gesamten Staats-, Wirtschafts- und Verkehrsapparat lahm und beraubte die Putschisten jeglicher Möglichkeit, die Regierung zu übernehmen. Der machtvolle Streik veranlaßte letztendlich die DDP-Kabinettsmitglieder und die nach Stuttgart einberufene Nationalversammlung, Verhandlungen mit Kapp und Lüttwitz kompromißlos abzulehnen.
"Das Scheitern des Putsches entsprang dem Dilettantismus Kapps und seiner militärischen Parteigänger, die sich gegenüber dem passiven Widerstand der Ministerialbürokratie und der Reichsbank nicht durchzusetzen vermochten und denen jede politische Übersicht fehlte."2
Die SPD schien nun bemerkt zu haben, daß ein Pakt mit den Konter-revolu- tionären auch für sie selbst verhängnisvoll war. Aus dem Fluchtort Stuttgart wieder in Berlin angekommen, versprachen die sozialdemokratischen Kabinettsmitglieder den Gewerkschaftsführern einige Punkte des "Neunpunk- te-Programms der freien Gewerkschaften" zu erfüllen. Ihr wichtigstes Anlie- gen war es allerdings, "Ruhe und Ordnung" wiederherzustellen und den Generalstreik zu beenden.
Als im März eine von der Arbeiterschaft gegründete "Rote Armee" die örtli- chen Reichswehr-Garnisonen in die Flucht schlug und im Begriff war, das Ruhrgebiet zu erobern, wurde das Bündnis mit den Militärs abermals gesucht. Die Reichswehr ging mit äußerster Brutalität gegen die aufständi- schen Arbeiter vor. Abermals waren die "Linken" diejenigen, gegen die die Regierung vorging, während die Vergehen der "Rechten" kaum gesühnt wurden. Letztendlich wurde weder die Reichswehr neu organisiert und demokratisiert, noch wurde ein einziger Putschist ernsthaft zur Rechenschaft gezogen. General von Lüttwitz konnte ins Ausland reisen, kehrte bald wieder nach Schlesien zurück und wurde 1925 amnestiert. Kapp ging nach Schwe- den und Kapitän Erhardt tauchte in Bayern unter und half dort beim Aufbau der nationalsozialistischen Arbeiterverbände.
Am 6. Juni erhielt die SPD die Quittung: Sie erhielt nur noch die Hälfte der Stimmen (5,6 Millionen), während sich die Stimmen der USPD mehr als verdoppelten (4,9 Millionen). Die Kommunisten, welche zum ersten Mal antraten, bekamen auf Anhieb 440000 Stimmen. Die bürgerlichen Parteien hatten ebenfalls mit starken Verlusten zu kämpfen, während sich die Mandate der beiden Rechtsparteien verdoppelten. Die Folge war eine Regie- rung, be-stehend aus Zentrum, Demokraten und DVP. Die SPD war nicht mehr beteiligt. Sie tolerierte allerdings die neue Regierung. Die Reichswehr spielte auch in den nächsten Jahren ihr republikfeindliches Spiel und entwickelte sich zunehmend zu einem "Staat im Staat". Am 10. Mai 1921 bildete sich ein neues Reichskabinett unter der Führung des badischen Zentrumspolitikers Joseph Wirth. Dieser war anfangs in der Reparationsfrage zur Annahme des Londoner Ultimatums bereit, um eine Besetzung des Ruhrgebietes zu verhindern. Zusammen mit seinem Wieder- aufbau- und späteren Außenminister Walther Rathenau wurde er zum Haupt- vertreter einer "Erfüllungspolitik" gegenüber den Siegermächten. Durch den Versuch einer Erfüllung wollte er den Alliierten nachweisen, daß dieser Vertrag praktisch unerfüllbar ist und somit neu verhandelt werden muß. Bei den "Rechten" wurde der Ausdruck "Erfüllungspolitik" bald zum Schimpfwort. Vor allem die Hintermänner der ehemaligen Freikorps und die rechtsradika- len Organisationen begannen, den Haß gegen die "Erfüllungspolitiker" zu schüren. Diese Hetzkampagne forderte bald ihre Opfer. So wurden u.a. am
10. Juni 1921 der USPD-Abgeordnete Otto Gareis, am 26. August 1921 der 41 Zentrums-Abgeordnete und Unterzeichner des Versailler Friedensvertrages Mathias Erzberger und am 24. Juni 1922 schließlich Außenminister Walther Rathenau ermordet. Eine daraufhin von der Regierung erstellte Gesetzesvor- lage, die republikfeindliche Agitationen von rechts unter Strafe stellen sollte, wurde durch den Widerstand Bayerns und unter dem Einfluß der bürgerli- chen Parteien im Sinne eines allgemeinen Staats- und Verfassungsschutzes entschärft.
"In der Folgezeit rächte es sich, daß der Justizapparat unverändert aus dem Kaiserreich übernommen worden war. In seinen Händen erwies sich die Waffe des Republikschutzes als stumpf, wenn sie sich gegen den Extremismus von rechts richtete, während sie Kommunisten mit unnachsichtiger Härte traf."1
Im Zusammenhang mit den Reparationsverhandlungen mußte die Regierung Wirth zurücktreten. Mitte des Jahres hatte der beschleunigte Verfall der Reichswährung begonnen. Ebert beauftragte nun den Direktor der HAPAGReederei Wilhelm Cuno mit der Bildung der Regierung. Die "Regierung der Wirtschaft" wurde am 14. November 22 gebildet.
Cuno ersuchte Frankreich um einen Zahlungsaufschub der Reparationen. Frankreich lehnte dies ab und besetzte das Ruhrgebiet. Nun begann die Lage zu eskalieren. Einerseits die Wirtschaft: Die Inflation, die im Spätherbst 1923 ihren Höhepunkt erreichte, als der Wert des nordamerikanischen Dollars die Billionengrenze überschritt, führte dazu, daß weite Kreise der Bevölkerung, einschließlich des Mittelstandes ("Stehkragenproletariat") verarmten. Erst die Rentenmark, eingeführt durch das Kabinett der großen Koalition unter Stresemann (DVP), setzte dieser Entwicklung im November 1923 ein Ende.
Andrerseits die Politik: Die revolutionären Unruhen führten dazu, daß am 27. September 1923 der Reichspräsident den Ausnahmezustand für das Reichs- gebiet verhängte. Die vollziehende Gewalt des Reiches wurde auf den obersten militärischen Befehlshaber, General von Seeckt, übertragen. Dieser ging nun mit aller Härte gegen die "linken" Regierungen in Sachsen und Thüringen vor. Thüringen wurde militärisch besetzt. Den Einsatz gegen einen wirklichen Feind der Republik, das "ultrarechte" Bayern, verweigerte Seeckt hingegen. Dieser General von Seeckt spielte eine überaus zwielichtige Rolle: So knüpfte er seit 1923 enge Verbindungen zu Ludendorff und den Führern der paramilitärischen rechten Wehrverbände, um sie im Falle eines Konflikts in die Reichswehr einzugliedern. Er schreckte auch nicht vor einer regen Zusammenarbeit mit den nationalistischen Verbänden einschließlich der sog.
Schwarzen Reichswehr zurück.
"Zugleich entwickelte von Seeckt Pläne zur Übernahme der Macht durch das Militär. Sein 'Regierungsprogramm' sah unter anderem vor: berufsständischer Umbau der Verfassung, Verbot aller sozialistischen Parteien und Gewerkschaf- ten, Aufhebung des Tarifvertragssystems. Unterstützt wurde er bei diesen Plänen nicht nur von einflußreichen Kreisen der Schwerindustrie, sondern offenbar auch von Reichspräsident Ebert. Hugo Stinnes schilderte dem ameri- kanischen Botschafter die Pläne: Sobald die für den November befürchteten kommunistischen Umsturzversuche begännen, 'werde eine Militärdiktatur mit Zustimmung Eberts das parlamentarische System aufheben'. Anlaß der Befürchtungen war unter anderem die Aufnahme von KPD-Ministern in die SPD-Minderheitsregierungen in Thüringen und Sachsen. Der Hitler-Putsch vom 9. November 1923 durchkreuzte jedoch alle Pläne, denn von Seeckt wollte die Macht auf äußerlich legale Weise übernehmen, nicht durch einen Putsch."1
So rettete paradoxerweise Hitler mit seinem Putsch die Republik aus dieser schweren Krise.
"Sein operettenhaft theatralischer Putschversuch vom 8./9. November 1923 [...] hatte nicht nur den Führer der NSDAP selbst, sondern auch die Rechte insgesamt diskreditiert.2
Die Wahlen zum 2. Reichstag am 4. Mai 1924 brachten erhebliche Gewinne für die Kommunisten und Rechtsparteien. Durch die Annahme des Dawes- plans beruhigte sich die Lage. Charles Dawes, der Vizepräsident der USA, schlug Anfang 1924 ein weitreichendes Anleihesystem vor, welches die deutsche Wirtschaft wieder auf Hochtouren bringen sollte. Dadurch sollte diese zum einen gegen den Kommunismus immunisiert werden und zum anderen in die Lage versetzt werden, die unterbrochenen Reparationszah- lungen fortzusetzen. Die Periode der "relativen Stabilisierung des Kapitalis- mus" begann. Die Wahlen zum 3. Reichstag, am 7. Dezember 1924 brachten jetzt eine Stärkung der gemäßigten Parteien. Die Regierungskoalition bestand nun aus DDP, DVP, DNVP, Zentrum und Bayerischer Volkspartei. Reichskanzler wurde der parteilose Hans Luther. Die SPD spielte wiederum den stillen Teilhaber.
5.1.1 Kulturelle und ideologische Strömungen
Die radikalen Expressionisten gerieten ab 1920 in eine politische, soziale und kulturelle Abseitslage.
"Seit 1922 war der Expressionismus verleumdet; Noskes Feldzüge, der Wunsch nach Ruhe und Ordnung, die Lust an den gegebenen Verdienstmög- lichkeiten und an der stabilen Fassade haben ihn erledigt. Diese Lust hieß 'Neue Sachlichkeit'."1
Nach der Phase des Umbruchs bekannten sich immer mehr Expressionisten zur neuen Republik. "Erkenntnis", "Besinnung" und "Verantwortung" waren die Gebote der "Neuen Sachlichkeit". Einige der Expressionisten richteten sich in der Demokratie ein und arrangierten sich, andere blieben innerhalb kleiner linksradikaler Zirkel und Parteien ihren Idealen treu, konnten jedoch keine größere politische Wirksamkeit mehr erreichen.
5.2 Ignaz Wrobel - Warnungen an Parlament und Regierung
"(...)Immer und immer wieder raffen wir uns auf; immer und immer wieder haben wir geraten und zu helfen versucht; immer wieder, im Interesse der Sache und im Interesse der Republik, haben wir geschwiegen und da nichts gesagt, wo wir vielleicht hätten schaden können - immer und immer haben wir Stange gehalten.
Wofür eigentlich -? 2
Tucholskys Strategie begann sich nach 1920 zu verändern. Ihm wurde bewußt, daß seine Appelle an die Menschlichkeit nicht ausreichten. Er wollte an das Volk und seine Regierenden herankommen. Ihnen helfen, die Mißstände zu erkennen.
Im Artikel "Das leere Schloß", der am 19. Februar erschien, zeigte Wrobel nochmals die Entwicklung seit der Revolution auf. Bedrohlich schwebt über der Republik der Geist des Kaiserreiches, und die Regierung schaut hilflos zu. "Das leere Schloß" wird am Ende dieses Abschnittes und im didaktischen Teil dieser Arbeit ausführlich behandelt.
Am 25. März, knapp zwei Wochen nach dem Putschversuch, erschien der Artikel "Kapp-Lüttwitz". Wrobel machte hierfür die Regierung durch ihr "Nichtstun" verantwortlich:
"Die alte Regierung Ebert-Bauer hatte sechzehn Monate durchgeschlafen. Sie ist gewarnt worden, sie sah nicht, was um sie herum leise oder auch manch- mal recht vernehmlich vorging, was sich vorbereitete, heranschlich: sie schlief."3
Um ihre gesellschaftliche Stellung innezubehalten, malten die Offiziere "die Bolschewisten an die Wand". Die Regierung vertraute ihnen.
Wrobel stellte nun die Situation nach dem Putsch dar, interessant ist seine Beschreibung über das Verhalten der Presse:
"Der erwartete Jubel der Bürgerschaft blieb aus. Keine Jungfrauen schwenkten Tücher, kein Blumenregen, nichts. Die Deutsche Tageszeitung stellte sich selbstverständlich den Verschwörern zur Verfügung - bis zum dritten Tage; dann verließ diese Ratte das sinkende Schiff. [...] Die anderen warteten ab. (Daß sie, wenn Kapp Erfolg gehabt hätte, fast alle umgefallen wären, braucht wohl nicht erst gesagt zu werden.) [...] Der Streik setzte ein. Es muß gesagt werden, daß die Demokraten die schwere Schuld, die sie durch Duldung der Vorbereitung eines solchen Putsches auf sich geladen haben, in den drei kriti- schen Tagen wettzumachen suchten. Sie hielten mit den Arbeitern zusammen und verweigerten der Regierung Kapp die Gefolgschaft. Die Reaktionäre verhielten sich feige abwartend. Die große Masse der Bürger blieb auch dieses Mal indolent."1
Am Ende dieses Abschnittes stellte Wrobel die rhetorische Frage: "Und nun?" Seine Antwort darauf war ein langer Forderungskatalog, zusammengefaßt forderte er:
- Die Forderungen, die man der Regierung abgerungen hat, müssen durchgesetzt werden.
- Es muß praktische Folgen haben, wenn man in einer demokratischen Republik monarchistisch, militaristisch, nationalistisch agitiert. Diese Männer müssen entfernt werden.
- Unser Geld darf nicht für unnütze Truppen als Arbeitslosenunterstützung hinausgeworfen werden. Hier muß Ordnung geschafft werden.
- Publizisten, welche dauernd daneben raten, muß die Berechtigung abgesprochen werden, noch ernstlich mitzureden.
- Die Republik muß Männer aus ihren Ämtern und Betrieben heraussetzen, welche glauben, "daß Menschentöten im Kriege kein Mord ist, daß Waffen Argumente sind" und "die Militärs dürften [...] als Staat im Staate das eigene Volk schädigen."
- Entfernung der konservativen Preußenoffiziere aus der Reichswehr. { Sofortige Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit.
- Verwandlung der Reichswehr in eine zuverlässige Volksmiliz.
- Aufhebung der Technischen Nothilfe
- Auflösung sämtlicher Einwohnerwehren
Des weiteren forderte Ignaz Wrobel, die Aufklärung von Staates wegen: Aufklärung darüber:
- daß ein Offizier auch nur ein Mensch ist, und vielfach nicht einmal der beste
- daß der Offizier, genau wie jeder andre Staatsbürger, den Gesetzen unterworfen ist
- daß Hochverräter nicht immer Ballonmützen und rote Schlipse tragen
- daß rohe Gewalt auch dann zu verachten ist, wenn sie sich militärisch kostümiert
- wie sehr die "nationalen" Parteien an diesem unabsehbaren Unglück die Schuld getragen haben
- über die Schuld der reaktionären Offiziere und Beamten
Vor allem forderte er - und hier wird wieder sein Weitblick deutlich - die Reorganisation der Schule:
"Da steckt das Unheil, da die zukünftige Generation, da unsre Hoffnung und unsre Furcht. Den Kindern muß - nicht Parteipolitik -: demokratische Gesinnung eingepflanzt werden. Politik gehört in die Schule, hat immer hineingehört, solange sie monarchistisch gefärbt war. Pensioniert lieber nationale Lehrkräfte mit vollem Gehalt, als daß Ihr die Kinder noch einmal zu einer Generation werden laßt, die, wie die von 1914, ein Blutbad bejubelt."1
Der Appell am Ende des Artikels drückt eine gewisse Hoffnung auf die Zukunft aus:
"Wenn die Republik Deutschland, erweckt durch den Militärputsch, Das nachholt, was sie im November 1918 versäumt hat: dann ist es nicht umsonst gewesen."2
Doch bereits einen Monat später sah sich Ignaz Wrobel im Artikel "Militärbilanz" veranlaßt, seine Warnungen zu bekräftigen. Grund dazu war die Tatsache, daß die Regierung sich offenbar nicht traute, die Anführer des Putsches zu bestrafen. Anhand zahlreicher aktueller Beispiele zeigte er die nach wie vor bestehende verderbliche Rolle des deutschen Militarismus auf. Sein Resümee barg nicht mehr allzuviel Hoffnung:
"Auch die Warnungen, auch dieses Tatsachenmaterial, auch diese Deduktionen werden nicht gehört, werden nicht beachtet werden. Der zweite Putsch kommt und muß kommen. Und dann glückt er. Und die neuen Gewaltherrscher werden dann nicht so töricht sein wie die matten Demokraten, die da vermeinen, mit papiernen Verfügungen sei etwas getan."3
Dennoch wiederholte und verdeutlichte Wrobel nochmals seine Forderungen. Nur mit der totalen Reorganisation könne mit der Tradition gebrochen werden und Deutschland zu einem "reinen" Land gemacht werden. Von nun an begnügte sich Kurt Tucholsky nicht mehr, nur zu reden und zu schreiben, sondern wollte auch politisch aktiv mitarbeiten. Er trat am 1. Mai 1920 in die USPD ein. Auch in den folgenden Artikeln wandte sich Tucholsky verstärkt an die gewählten Volksvertreter. In zahlreichen Artikeln stellte er diesen die Gefahren für die Republik dar und forderte sie zum Handeln auf.
"Seine bislang eher spöttischen Bemerkungen über Regierung und Minister wichen langsam einer nüchterneren Bestandsaufnahme; bei aller Schärfe der Kritik war eine gewisse Solidarität jedoch nicht zu verkennen.4
Im September 1921 stellt Wrobel in einer Buchkritik die für ihn wichtigste Publikation der letzten drei Jahre vor. Das Buch "Zwei Jahre Mord" von E. J. Gumbel. Dieser hatte von 1918-1920 alle politischen Morde (von rechts und von links) gesammelt und deren gerichtliche Aburteilung aufgezeichnet.
Wrobel nahm dieses Buch zum Anlaß, um nochmals zurückzublicken. Die Revolution und ihre Niederschlagung, die Aufstände der Arbeiter, der Kapp- Lüttwitz-Putsch und immer wieder die unsägliche Rolle der Militärs, von deren brutalem Vorgehen einige Beispiele berichten, werden hier nochmals erwähnt. Dann die politischen Morde:
"Es wurden, systematisch, alle irgend erreichbaren Führer der Opposition hingemordet. Ach, und was verstanden diese Soldatengehirne nicht alles unter 'Opposition'! Zu dumm und zu faul, etwas andres als Dienstvorschriften, Jagdhumoresken, die Tägliche Rundschau, ein Blatt ähnlichen Kalibers oder Zoten zu lesen, richteten sie sich in ihrem Haß gleichmäßig gegen Demokraten, Bolschewisten, Dada-Leute, moderne Maler und Nationaloekonomen. Unver- dächtig war, wer Schmisse auf den Gesichtsbacken und jenes vorschriftsmäßig deutsche Bullenbeißergesicht trug, in dem die richtige Mischung von Kellner und Assessor ganz realisiert war."1
Nun folgt eine Aufzählung der bekanntesten Ermordeten, welche "zerstampft, zu Tode geprügelt, von hinten erschossen, erschlagen, ins Wasser geworfen und mit 'Fangschüssen' erledigt" wurden.
Die Summe, der von rechts ermordeten Personen war 314. Gegenüber stehen während dieser zwei Jahre 14 Morde der Kommunisten. Zur gerichtlichen Aburteilung schrieb er:
"Das aktenmäßige Material Gumbels versetzt uns in die Lage, klipp und klar festzustellen: Wie da - in den Jahren 1913 bis 1921 - politische Morde von deutschen Richtern beurteilt worden sind, das hat mit Justiz überhaupt nichts zu tun. Das ist gar keine. Verschwendet ist jede differenzierte Kritik an einer Rechtsprechung, die Folgendes ausgesprochen hat: Für 314 Morde von rechts
31 Jahre 3 Monate Freiheitsstrafe, sowie eine lebenslängliche Festungshaft. Für 13 Morde von links 8 Todesurteile, 176 Jahre 10 Monate Freiheitsstrafe. Das ist alles Mögliche. Justiz ist das nicht. Ganz klar wird das, wenn wir das Schicksal der beiden Umsturzversuche: Kapps und der münchner Kommuni- sten vergleichen, zweier Versuche, die sich juristisch in nichts unterscheiden: Die Kommunisten haben für ihren Hochverrat 519 Jahre 9 Monate Freiheits- strafe erhalten. Eine Todesstrafe hat man vollstreckt. Die Kapp-Leute sind frei ausgegangen."2
Wrobels Befürchtung über die zukünftige Rolle der Justiz, die er bereits 1919 im "Prozeß Marloh" geäußert hatte, war Realität geworden. Seine Warnung am Ende war auch für die republikanischen Politiker bestimmt:
"Wir Andern aber vergessen viel zu rasch. [...] Jene dagegen wiederholen Tag um Tag und Tag um Tag, seit zwei Jahren: den Schwindel vom Dolchstoß, die Legende vom Scheidemann-Waffenstillstand, der doch eine Monarchenniederlage war, die historischen Unwahrheiten vom U-Boot-Krieg und die Lüge vom Erzberger-Frieden. Und sie drehen die Geschichte unermüdlich so lange bis auch sie ihnen und ihrer Existenz recht gibt.
Und wir? Wir trommeln nicht. Wir reden immer zu uns. Wir glauben, es sei nicht unterhaltend, den Leuten Das einzuhämmern, was sie doch erst einmal wissen müßten, bevor sich die Grundlage für ihre Wandlung bilden kann. Geld fehlt. Freunde fehlen. Zeitungen schweigen. Immer wieder? Nie genug. Blut steht auf dem Spiel."3
Durch das Personalpronomen "Wir" sprach Wrobel die Regierung und die republikanischen Politiker - zu denen er ja inzwischen selbst gehörte - direkt an. Auf diese Weise solidarisierte er sich mit ihnen und hoffte, nun endlich gehört zu werden.
Fünf Monate später erschien unter der Rubrik "Rundschau", ein überaus engagiert geschriebener Artikel "Die Reichswehr". Hier spürt man, daß Wrobel bereits zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit schwankte. Der Beginn des Artikels klingt hoffnungslos:
"Dies soll hier nur stehen, um in acht Jahren einmal zitiert zu werden. Und auf daß Ihr dann sagt: Ja - das konnte eben Keiner voraussehen!"1
Doch schon beim nächsten Abschnitt war er wieder zum weiterkämpfen bereit:
"Ich halte es für meine Pflicht, noch einmal die beiden sozialdemokratischen Parteien auf die Gefahr aufmerksam zu machen, die von der Reichswehr droht."2
Wrobel zählte nun zahlreiche Schikanen der Militärs, insbesondere der Offiziere gegenüber ihren Untergebenen, auf und erwähnte Beispiele, die ihre republikfeindliche Haltung deutlich machten. Offenbar gingen seine Warnungen in erster Linie an die Mehrheitssozialisten, ihnen wollte er die Augen öffnen:
"Der Milliarden-Etat geht Jahr um Jahr, mit schönen Sparsamkeitsreden begleitet, im Reichstag durch - die Abgeordneten der Mehrheitssozialdemokratie versagen bei Wehrfragen in den Ausschüssen und im Plenum. Die Unabhängigen allein schaffens nicht."3
Nochmals forderte er zum Durchgreifen auf. Auch hier schwang wieder eine gewisse Hoffnung mit:
"Fast gänzlich unbeachtet, in aller Stille reift hier ein Werk, das heute noch abzutöten ist. Ueber die Notwendigkeit einer Reichswehr läßt sich streiten - über die Beschaffenheit dieser Reichswehr gibt es nur eine Meinung: sie muß geändert werden."4
Diese Hoffnung fehlte bereits wieder im nächsten Abschnitt:
"Einst wird kommen der Tag, wo wir hier etwas erleben werden. Welche Rolle die Reichswehr bei diesem Erlebnis spielen wird, beschreiben alle Kenner auf gleiche Weise. Der Kapp-Putsch war eine mißglückte Generalprobe. Die Aufführung ist aufgeschoben."5
Wie recht er damit hatte, wissen wir. Es war zwar keine acht sondern elf Jahre später, als die folgende Vorhersage Wirklichkeit wurde:
"Ich will aber nicht in acht Jahren hier eine Serie Standgerichte haben, die die gewissen raschen Kneifer nicht, wohl aber alle Andern treffen werden. Ich will nicht meine Steuern für Menschen rausgeworfen wissen, die nichts andres im Kopf haben als ihre überlebte Zeit und ihre Ideale - Ideale, deren Unwert nur noch von ihren forschen Vertretern übertroffen wird."1
"Ich will nicht." - Er allein konnte es aber nicht verhindern; (er schaffts nicht). "Viele wollen nicht." Diese Äußerung könnte wieder an die MSPD gerichtet sein. Bei den "vielen" waren auch die Wähler der Mehrheitssozialdemokraten dabei. Daher hielt er es
"für eine Pflichtverletzung der beamteten und gewählten Volksvertreter, sich auf Meldungen zu verlassen, die verlogen sind, und auf Gruppen zu hören, die warten und warten...Ihre Zeit kommt."2
Am Ende des Artikels steht weder ein Appell noch ein Aufruf. Der letzte Satz lautet:
"Bedankt euch in acht Jahren bei dieser Regierung, diesem Staatsrat, diesem Reichstag."3
Dieser Satz läßt erkennen, Wrobel gab langsam auf. Der Schwerpunkt des Gewichts verlagerte sich hin zur Hoffnungslosigkeit.
Vielleicht weil die Politiker auf die vielen Hinweise von Ignaz Wrobel nicht hörten, erschien am 22. Juni ein Leitartikel von Kurt Tucholsky. In diesem Artikel: "Was wäre wenn...?" spielte er die Rolle eines Hellsehers, der aus der Zukunft berichtete. Auf diese Art und Weise konnte Tucholsky aufzeigen, wohin es zwangsweise führen mußte, wenn die Warnungen von Ignaz Wrobel nicht gehört wurden. Dem Autor war es durch die Ein-bezie- hung der Zukunft möglich, die Gefahren aus zwei Zeiten zu beleuchten. Bestimmte Institutionen vor denen Wrobel warnte, spielten in der Zukunftsbe- schreibung Tucholskys eine andere Rolle. Anhand dieses Rollenwechsels ließ sich die Gefahr, die von dieser Institution in der damals gegenwärtigen Situation ausging, noch stärker hervorheben. Ein Beispiel anhand eines Zitates aus dem Tucholsky-Artikel:
"Die Rechtspresse jubelte ungehemmt. Sie die vorher von nichts gewußt hatte, die alle Warner und Propheten verhöhnt hatte, 'sie hätten vielleicht den Hitzschlag' - sie floß über die Ränder vor Freude. Las man ihre Artikel, so mußte man glauben, Deutschland sei vier Jahre hindurch von blindwütigen Bolschewiken regiert worden und käme nun endlich wieder an die einzige rechtmäßige Gewalt."1
Hier wurde die neue Rolle der Rechtspresse deutlich. Während Wrobel in zahlreichen Artikeln vor dieser Presse gewarnt hatte, entlarvte diese Zukunftsbeschreibung Tucholskys das wahre Gesicht dieser Zeitungen und verdeutlichte die Gefahr, die von ihnen ausging.
Zwei Tage nach dem Erscheinen dieser düsteren Zukunftsprognosen, wurde eine davon schon zur bitteren Wahrheit:
"Ein Minister war erschossen worden;"2
Reichsaußenminister Walther Rathenau wurde am 24. Juni 1922 durch rechtsextreme, antisemitische Nationalisten ermordet. Endlich schien die Regierung die Gefahren für die Republik zu erkennen.
"Der Trauerakt für Rathenau wurde die 'erste große und eindrucksvolle Selbst- darstellung der Republik', und im Innenministerium dachte man über weitere Aktivitäten nach, mit denen den Bürgern ihr Staat nähergebracht werden konnte."3
Tatsächlich waren mit dem SPD-Innenminister Adolf Köster und seinem Ministerialdirektor Arnold Brecht zwei überzeugte Republikaner ins Innen-mi- nisterium des Kabinetts von Reichskanzler Wirth gelangt, welche auch nicht vor konsequenten Maßnahmen zum Erhalt der Republik zurückschraken. Die aufgeschreckte Stimmung nach dem Attentat ließ Ignaz Wrobel wieder hoffen. Drei Wochen nach dem Attentat erschien Wrobels Leitartikel, "Die zufällige Republik" in der Weltbühne. Wrobel erläuterte dort, daß bisher keine seiner Forderungen erfüllt wurde, er stellte nochmals eindringlich die Verfeh- lungen der Republik dar und zeigte abermals die Gefahren für sie auf. Wiederum stellt er Forderungen auf:
"
- Umwandlung der Reichswehr in eine Volksmiliz. Entfernung aller überflüssigen und gegenrevolutionären Generale und Offiziere.
- Entmilitarisierung der Schutzpolizei. [...] Zwangspensionierung und Maßregelung aller unzuverlässigen Elemente, besonders in der Provinz.
- Reformierung der Justiz - ganz besonders der Staatsanwaltschaften, die auf dem Disziplinarwege zu erfassen sind. Rücksichtslose Säuberung der Justiz von allen monarchistischen Elementen.
- Demokratisierung der Verwaltung. Durchgreifende Verfolgung jeder republikanischen Beschwerde. Entlassung aller Beamten, denen antirepublikanische Politik nachzuweisen ist, mit Entziehung der Pension. Aufhebung aller dem entgegenstehenden Vorschriften.
- Stärkung des Reichs den Ländern gegenüber.
- Völlige Umformung der Lehrkörper auf Schulen und Hochschulen. Sofortige Aufhebung aller Zwangsmaßregeln, auch der indirekten, die darauf abzielen, aus den "körperlichen Leibesübungen" der Studenten eine neue Wehrpflicht zu machen.
- Sofortige Amnestie für die politischen Häftlinge aller Art, soweit sie republikanisch sind. [...]
- Aufhebung des § 360 des Reichs-Strafgesetzbuches, Ziffer 8. Diese Vorschrift stellt das unbefugte Tragen von Orden und Ehrenzeichen unter Strafe, ebenso die unbefugte Führung des Adelstitels. Dieser monarchistische Unfug verdient nicht , verboten zu werden - man muß ihm seinen Wert nehmen. [...] Diese Mätzchen der Monarchie müssen der allgemeinen Wertlosigkeit verfallen.
- Vor allem aber: Aufklärung und Propagierung der neuen Ideen einer neuen Republik.
Dies sind unsre Forderungen. Werden sie befolgt, haben wir ein neues lebenskräftiges Land. Werden sie es nicht, haben wir in Wochen oder Monaten eine elende und von aller Welt verachtete Reichsverweserschaft."1
Am Ende des Artikels untermauerte er nochmals diese Forderungen, indem er an die Republikaner appellierte:
"Bleiben die Republikaner wiederum in den Versammlungssälen und packen sie die ungetreuen Amtsdiener ihres eignen Landes nicht in den Büros, auf den Kasernenhöfen, in den Polizeiwachen, auf den Gerichten, in den Landratswohnungen, schlagen sie diese größenwahnsinnigen Recken, die von einer Welt geistig und militärisch krumm geprügelt worden sind, nicht zu Boden -: dann ist es mit dieser zufälligen Republik zu Ende"2
Tucholsky beließ es aber nicht nur bei einigen aufrüttelnden Artikeln oder Reden, sondern engagierte sich wieder in vielfältiger Weise. So arbeitete er mit Karl Vetter, dem politischen Redakteur der "Berliner Volks-Zeitung" und Vorstandsmitglied des "Deutschen Demokratischen Reichsbundes", ein 99-Punkte-Programm zur "Verlebendigung der bis dahin trockenen Republik von Weimar" aus, das beide dem Innenminister Köster vortrugen. Dieses Programm enthielt offenbar Vorschläge zur Ausrichtung der ersten Verfas- sungsfeier. Diese Vorschläge zur "Inszenierung der Republik", wurden zwar von den Politikern des Innenministeriums skeptisch betrachtet, dennoch schrieb Ministerialdirektor Brecht zahlreiche Briefe an Schriftsteller und Künstler, in denen er sie um Mithilfe bei der geplanten Veranstaltung bat.
"Auch der "Deutsche Republikanische Reichsbund" rief in den Zeitungen dazu auf, den 11. August als "Geburtstag der Reichsverfassung" im Berliner Lustgarten mit einer großen Kundgebung zu feiern. Das Ergebnis war überwältigend. Statt der erwarteten 50000 Besucher kamen über 500000."3
25000 Fackeln brannten, Musiken spielten, junge Talente rezitierten, Journalisten und Gewerkschafter hielten 5-Minuten-Reden.
"Ein großer Fackelzug bewegte sich dann zum Staatstheater, wo der offizielle Staatsakt stattfand. Als Reichspräsident Ebert und Reichskanzler Wirth den Festakt verließen, um den ankommenden Demonstrationszug mit einer kurzen Rede zu begrüßen, wurden sie mit minutenlangen Hochrufen empfangen. 'Die Internationale brauste auf hinreißend die dritte Strophe des Deutschlandliedes (der Text war vorher in die Menge geworfen worden).' Die 'Berliner Volks-Zeitung' erschien am nächsten Tag mit der Schlagzeile: 'Die Republik muß leben, und wenn wir sterben müssen!' [...] Innenminister Köster bedankte sich bei den Organisatoren: 'Was diese Versammlung und der Fackelzug vor das Schauspielhaus an diesem Tag für die Republik gewonnen haben, brauche ich ihnen nicht zu sagen.'"1
Nach diesem Fest blieb jedoch alles beim Alten. Diejenigen Politiker, die wie der SPD-Innenminister Köster oder sein Ministerialdirektor Brecht eine gewisse Veränderung anstrebten, wurden von ihren Koalitionspartnern, den Zentrumspolitikern deutlich gerügt. Die Gesetzesvorlage einer "Re-publik- schutzverordnung", die den Zweck hatte die Gefahr von rechts einzudämmen, wurde letztendlich durch den Einfluß der bürgerlichen Parteien im Sinne eines allgemeinen Staats- und Verfassungsschutzes entschärft.
So mußte Tucholsky erkennen, daß auch dieses Mal seine Hoffnungen nicht erfüllt wurden, die Aussichtslosigkeit seiner Bemühungen bedrückte ihn - er resignierte.
"Tucholsky hatte eine schwere Depression, und verschiedene Anzeichen deuten darauf hin, daß er in diesem Herbst einen ersten Selbstmordversuch unternahm."2.
Die Anzahl seiner Artikel im ersten Halbjahr 1923 läßt ebenfalls auf eine Krise bei Tucholsky schließen. So erschienen in der "Weltbühne" nur noch zwei Artikel von Ignaz Wrobel, seither waren es ca. 15-20 Artikel pro Halbjahr. Er verabschiedete sich am 1. März von seinem freien Schriftsteller- tum und trat im Bankhaus Bett, Simon & Co eine Stelle als Volontär an. Im ersten der beiden Artikel (der zweite war nur ein kurzer Rundschau-Arti- kel) beschrieb er seine eigene Totenmesse. Dieses "Requiem" ist eine humorvolle Satire, gespickt mit einem guten Schuß Selbstironie. Er rechnete mit sich und seiner Umwelt ab. Hier ein Zitat, das seine Selbstironie darstellt:
"Und der Redner sprach: 'Geehrte Trauerversammlung! Wir stehen am Grabe von Kaspar Theobald Peter Kurt Ignaz Wrobel. Ein schwerer Schlag hat uns und ihn getroffen. Der Entschlafene wurde geboren am 9. Januar 1890 in Podejuch bei Stettin und besuchte dortselbst bis zu seiner endgültigen Pubertät die Fürsorgeanstalt für geistig zurückgebliebene, aber uneheliche Kinder; im Jahre 1908 wurde er in die Schule für eheliche Kinder versetzt. Nachdem ihm zugleich mit General Mackensen das Doktorat einer deutschen Universität für den Wiederbeschaffungspreis von 350 Mark verliehen worden war, trug er einen vom damaligen Kaiser entliehenen Rock und bekleidete denselben vom Jahre 1915 bis 1918. Nach siegreicher Durchdringung Rumäniens trat der Verblichene in eine berliner Zeitungsredaktion ein, woselbst er durch rasche Verjagung der zahlungsfähigen Inserenten und Abonnenten bald eine beliebte Persönlichkeit wurde. Als nur noch der Chefredakteur und er das von ihm redigierte Blatt lasen, wurde er Stellungsloser und bezog von der Stadt Berlin eine Rente."1
Aber auch mit der Politik rechnete Wrobel nochmals ab:
"Geehrte Trauerversammlung! [...] Er glaubte an keinen Zusammenbruch. Er sah, daß die Pazifisten zumeist beleidigter Landsturm ohne Waffe waren - und er sah, wie der altdeutsch angestrichene Apparat nur funktionierte, wenn er sich mausig machen konnte. Und weil die meisten Erfolge auf Mißverständnis- sen beruhen, so darf gesagt werden: Er hat viel Erfolg gehabt. Und aus diesem Paradeis mußte er hinfort, aus diesem schönen Lande scheiden! Wie wird er es ohne Deutschland da drüben aushalten? Ohne diese Nation von Biertrinkern, Diensttuenden, Diensthabenden und Dienstmännern? Ohne diese herzigen Knaben, die schon in früher Jugend in Sportclubs und Wandervereinen sich für die hohe Aufgabe ihres Lebens übten: organisiert zu werden, um selbst einmal zu organisieren? Wie werden ihm seine betulichen Landsleute fehlen, denen man nur eine Arbeit und einen Zweck vorzuhalten brauchte, um zu bewirken, daß sie sich besinnungslos, vor Eifer glühend in dieselben stürzten und Alles um sich herum vergaßen - auch, wozu sie eigentlich auf der Welt waren! Wie wird ihm all das fehlen!"2
Am Ende des Artikels verabschiedete er sich folgendermaßen:
"[...] und ihr [der Sonne - Anm. d. Verfasserin -] freundlicher Schein fiel auch auf den granitenen Grabstein, mit dem sich der gute Ignaz Wrobel rechtzeitig eingedeckt hatte. In silbernen Buchstaben war da zu lesen: HIER RUHT EIN GOLDENES HERZ UND EINE EISERNE SCHNAUZE GUTE NACHT -!"3
Auch im zweiten Halbjahr 1923 erschienen nur drei Artikel von Ignaz Wrobel in der "Weltbühne". Überhaupt war Tucholskys Stimme in der Öffentlichkeit kaum noch zu vernehmen. Nicht einmal zu politischen Ereignissen wie dem Hitler-Putsch äußerte er sich. Seine Artikel beschränkten sich auf Bücher und Schauspieler. So erschien am 26. Juli 1923 ein Leitartikel unter dem Titel "Die Kegelschnitte Gottes". Ignaz Wrobel rezensiert hier ein Buch von Sir Galahad. Dieser, ein Asiate, beschrieb Europa "mit seinen gebildeten, unverbildeten Augen." Dieses "mit solcher Kühnheit, mit so göttlicher Frech- heit, mit so erhabener und erhebender Ehrfurcht, mit so viel Liebe und mit so viel Haß" geschriebene Buch empfand Wrobel als "das Stärkste, was gegen diesen Kontinent in der heutigen Literatur zu finden ist". Durch den Beginn dieses Artikels läßt sich Wrobels Schweigen nachvollziehen:
"Wie mir wohlwollende Bankdirektoren oft während einer Verdauungspause versichern, 'schreit diese Zeit gradezu nach Satire'. Aber außer dem Geschrei 'Juden raus!' und 'Wie steht der Dollar?' habe ich noch nichts Rechtes gehört - wie genau ich auch in die Zeit hineingehorcht habe. Nein, nach Satire schreit diese Zeit nicht. Aber wir schrieen, leidend unter der Zeit, bliebe uns nicht der Schrei im Halse stecken. Und schrieen wir auch, des Hasses voll gegen Das, was ist, und voll der Liebe für Das, was fern ist und nicht ist - was hülfe es uns?"4
Obwohl er die Gefahren nicht benannte, spürte er, daß über kurz oder lang etwas Schreckliches heraufziehen wird, welches das Reich zum zerfallen bringen würde:
"Aber man schämt sich fast, gegen dieses Judentum, gegen diese Marke Zivilisation, gegen diese Maschinenethik anzugehen, da sie noch Edelwuchs und feinster Adel sind gegen Das, was da auf der anderen Seite heraufzieht. [...] Der ärgste Kapitalist ist eine Rettung gegen das Andre."1
Auch der Schluß deutet auf seine Krise hin, als er bekannte:
"Nein, auch ich gehe nicht so, wie ich gehen müßte. Auch ich lebe nicht so, wie ich leben müßte. Selbsthaß ist der erste Schritt zur Besserung."2
Mit dem Artikel "Reisende meidet Bayern", der am 7. Februar 1924 in der "Weltbühne" erschien, verabschiedete sich Ignaz Wrobel aus Deutschland. Dieser Artikel ist eine Fortsetzung des bereits am 27. Januar 1921 erschienenen "Rundschau"-Artikels. In beiden Artikeln kritisiert Wrobel die Behandlung von Reisenden in Bayern. Er beschrieb die Schikanen, welche vor allem republikanische und jüdische Touristen von den Ordnungskräften über sich ergehen lassen mußten und rief am Ende zum Boykott dieses Landes auf. Im Frühjahr 1924 fuhr er nach Frankreich.
"Als Tucholsky am 6. April 1924 den Zug nach Paris bestieg, war das sozusa- gen Rettung in letzter Sekunde, denn seine Depressionen und Selbstmordge- danken hatten sich in den letzten Monaten zunehmend gesteigert. Erst die Aussicht auf ein Leben in 'Freiheit', also im Ausland, ließ ihn wieder hoffen. Aufatmend verließ er das 'Gefängnis Deutschland', um von da an nur noch zu Besuch zurückzukommen."3
5.3 "Das leere Schloß" - eine Interpretation
Den Vorspann dieses Artikels bildet eine Erzählung. Man könnte sich den Erzähler umringt von einer Schar Kinder, am Feuer sitzend, vorstellen. Die Stimme des Erzählers klingt geheimnisvoll, die Kinder lauschen gebannt Dieser Vorspann dient dem Autor dazu, Spannung zu erzeugen. Am 10. November 1918 verläßt der Kaiser sein Schloß (Metapher für das Zentrum der Macht) und flieht nach Holland. "Ende 1918 und Anfang 1919" besetzte die meuternde Volksmarinedivision Schloß und Marstall. Dieser Aufstand der von Berliner Arbeitern unterstützt wird, wird von konter-revolu- tionären Truppen blutig niedergeschlagen. Seit dieser Zeit steht das Schloß leer.
"Die Regierung wohnt in der Wilhelm-Straße." Die republikanische Regierung hat ihren Sitz an einer Straße, die zu Ehren des Kaisers dessen Namen trägt. Das leere Schloß und der Sitz der Regierung in der Wilhelmstraße deuten bereits in der Einleitung auf die Schwäche der Regierung hin. Doch dieses Zentrum der Macht ist nicht leer. "Eine im Nachtwind lohende weiße Frau", Allegorie für den "monarchistischen Geist" wohnt in diesem Schloß.
Durch die rhetorische Frage und deren Antwort am Ende, "Und tagsüber? Tagsüber regiert er.", erreicht Wrobel, daß die Spannung nochmals gesteigert wird. "Zwangsläufig" muß weitergelesen werden.
Ignaz Wrobel blickt zunächst in die Vergangenheit.
Die folgenden fünf Abschnitte zeigen stufenförmig den Verlauf der Gescheh- nisse ab der Revolution bis zur Gegenwart auf. Jede Stufe behandelt eine Gruppe, die durch ihr "Tun oder Nichttun", den gegenwärtigen Zustand zu verantworten hat. Das Vorhandensein der einen Stufe ermöglicht den Schritt zur nächsten.
Zunächst war da "die Revolution, die Macht schuf".
1. "Weil sie sich nicht so recht trauten", wurde diese Macht von "den Leuten" nicht genutzt. Hier sind die "Durchschnittsdeutschen" gemeint.
2. Dadurch konnte die Revolution sabotiert werden. Das alte Recht blieb erhalten. Hier sind die Reaktionäre gemeint.
3. "Die neuen Männer" arbeiteten lieber mit den Reaktionären zusammen, anstatt "ihre Macht aus sich selbst zu stabilisieren". Hier ist das Parlament gemeint. Wrobel liefert dazu folgendes Bild:
"Die neuen Männer schwammen wie eine dünne Fettschicht auf dem Meer, und dann kam die riesige Wasserflut der Reaktionäre, mit denen sie arbeiteten."1
Dieser Ausspruch erscheint in Wrobels Artikeln häufig. Mit dem Bild der "schwimmenden Fettschicht auf dem Wasser" verdeutlicht Wrobel die Schwäche der Regierung. Träge und faul schwimmt sie oben und läßt sich - wie die Frau Major, die fast in Fett und Selbstzufriedenheit erstickt - von den alten reaktionären Kräften, dem alten Verwaltungsapparat tragen. Die Fettschicht schwimmt nur deshalb oben, weil sie leichter als Wasser ist. Sie wird also vom Wasser getragen. Dadurch, daß sie oben schwimmt, bemerkt sie die gewaltige Wassermenge nicht, die unter ihr "brodelt". Fett gemischt mit Wasser gibt eine Emulsion. Wenn sich aber nun eine riesige Wasserflut mit der dünnen Fettschicht vermischt, bleibt von der Fettschicht nicht mehr viel übrig. Das Fett wird im Endeffekt von dieser Wasserflut "geschluckt".
4. Dadurch wurde es versäumt den Verwaltungsapparat zu "reorganisieren". Hier sind die Beamten gemeint.
5. Die republikanische Regierung wird nun "vom eigenen Apparat ausgehöhnt". Hier ist die Regierung gemeint.
Ignaz Wrobel kommt nun zur Darstellung der Gegenwart. Die nächsten zehn Abschnitte beschreiben zehn Beispiele. In diesen werden konkrete Situationen aufgezeigt, die die Republik gefährden.
Zwei weitere Beispiele folgen durch den Leserbrief "einer alten Dame" und den "vertraulichen Bericht eines Offiziers". Diese, scheinbar nicht von Wrobel stammenden Berichte, verleihen dem Artikel mehr Authentizität. Der Leser- brief der alten Dame spricht besonders das Gefühl der Leser an. Durch den Vergleich der "Oberstwitwe" mit den armen kinderreichen Frauen erscheint die Ungerechtigkeit besonders krass. Der Bericht des Offiziers beschreibt die politische Situation in der Provinz. Dieser Bericht kann als der Höhepunkt des gesamten Artikels gesehen werden. Er gibt einen Ausblick in die Zukunft. Bei der Lektüre dieses Berichtes erkennt man Ähnlichkeiten zu vorausgehen- den und nachfolgenden warnenden Artikeln von Wrobel. Der Schreibstil, vor allem die scharfe und klare Sprache, die Ausrufesätze und die kurzen Fragen, zeigt Parallelen zum Schreibstil von Ignaz Wrobel, so daß Zweifel an der Echtheit dieses Offiziersberichtes angemeldet werden darf. Die Vermu- tung liegt nahe, daß Wrobel einen oder mehrere Berichte aus der Provinz mit persönlichen Erfahrungen1 verbunden hat, um diesen "vertraulichen Bericht eines Offiziers" zu fertigen.
Dem Bericht zufolge sind die Reaktionäre, auf der Suche nach geeigneten Mitteln die Republik auszuhöhlen, inzwischen fündig geworden. Mittels einer beispiellosen Hetzkampagne gegen die Juden fällt ihr Vorhaben zusehends auf fruchtbaren Boden.
" - nun, da hat man ja immer noch in der großen Kiste ein paar Mittelchen, die geschickt angewandt, als Mittel zum Zwecke dienen. Mit USP und KPD ist es nichts, also nun so ein bißchen feuchtfröhliche Judenhetze. Sie glauben nicht, welche Formen das hier angenommen hat. In der gemeinsten Weise wird hier ein Haß ausgesät, der, wenn er aufgeht, die bedenklichsten Folgen haben kann. Hier hat man ein scheinbar ganz neutrales Mittelchen, um den Brand zu entzünden. [...] Es ist bezeichnend, daß die Judenhetze grade von denen kulti- viert wird, die früher Vaterlandswohl in Erbpacht zu haben vorgaben."2
Es ist überaus erstaunlich, wie Ignaz Wrobel bereits 1920 das Unheil an den Juden vorausahnte:
"Wohin soll das führen? Hier sammelt sich im stillen ein Haß an, der, zum Brand entfacht, fürchterlich in die Erscheinung treten muß. Unsre Provinz ist bislang die ruhigste gewesen, nie ist es gelungen, uns Niedersachsen aufzuputschen, aber jetzt mit der infamen Judenhetze, da heißt es: auf dem Posten sein. Es wird gar nicht mehr diskutiert, daß die Juden umgebracht werden sollen, sondern nur, wie man sie umbringen will."3
Wenn diese Art zu hetzen, bereits 1920 auf so fruchtbaren Boden fiel, drängt sich der Verdacht auf, daß Daniel Jonah Goldhagen mit seinem umstrittenen historischen Buch "Hitlers willige Vollstrecker" so unrecht doch nicht haben kann, wenn er behauptet,
"daß der eliminatorische Antisemitismus, der diese gewöhnlichen Deutschen bewegte, während der NS-Zeit und auch davor schon in der deutschen Gesell- schaft extrem stark verbreitet war. [...] Als Hitler an die Macht kam, fiel es ihm deshalb nicht schwer, zuerst für die ungewöhnlich radikalen Verfolgungen während der dreißiger Jahre - von denen alle Deutschen wußten und gegen die sich kaum grundsätzlicher Widerspruch erhob - viele gewöhnliche Deutsche zu mobilisieren. [...] Obwohl die meisten Deutschen von selbst niemals auf die Idee gekommen wären, die radikalen Konsequenzen ihrer Meinung von den Juden zu ziehen und auszuführen, was das für Hitler möglich, weil die gesamte eliminatorische antisemitische Politik der Nationalsozialisten diese weitverbrei- tete, längst bestehende Vorstellung vom Wesen der Juden zur Grundlage hatte."4
Die Warnungen dieses vertraulichen Offiziersberichtes sind an die Regierung gerichtet. Dadurch, daß Wrobel einen Angehörigen eines von den Regieren- den angesehenen Berufszweiges zu Wort kommen läßt, der zudem selbst "ein vierzig Jahre alter Politiker" ist, erhöht er die Chance, daß seine Warnungen von der Regierung endlich wahrgenommen werden. Der Offizier bezieht durch die Personalpronomen "wir" und "unser" andere Politiker mit ein und fordert diese zum unverzüglichen Handeln auf.
Die Beispiele, mit denen der Offizier seine Aufforderung zum Handeln begründet, sollten eine demokratischen Regierung aufhorchen lassen. Insbesondere die Parlamentsmitglieder jüdischen Glaubens möchte er durch seine Darstellung besonders ansprechen. Sein Aufruf zum sofortigen Handeln wird am Ende mehrmals wiederholt.
"Das [die judenhetzerischen Aufputschungen] ist Spekulation auf die niedersten Leidenschaften, um politischen Dunkelmännern zur Erreichung ihrer Ziele zu dienen. Ich bin kein Schwarzseher, aber hier muß etwas geschehen, etwas mehr als bisher. [...] Hat Berlin die Monarchie geschmissen, nun, so schmeißt die Provinz die Republik. Jedes Mittel ist recht dazu. Sollte dies nicht der Gedankengang sein? Für mich steht es fest, daß der Beginn der Offensive gegen die Republik mit einem Judengemetzel beginnen wird. Jetzt ist es noch Zeit, Gegenmaßregeln zu treffen. Worte nützen nichts, Taten! [...] Zugefaßt, frisch ans Werk, jede Minute ist kostbar. [...] Es ist dringendste Gefahr im Verzuge.'"1
Nun schlüpft der Autor wieder in die Rolle des Ignaz Wrobel. Mit einem weiteren Beispiel, das die Gefahr, die von der bürgerlichen Presse ausgeht, darstellt und das fehlende "geistige Gegengewicht" bemängelt, leitet er über zum nächsten Teil des Artikels.
Der Tonfall wechselt, Wrobels Sprache wird anprangernd. Man spürt seine Wut, wenn er auf die Schwäche und die Hilflosigkeit der Regierung hinweist. Dadurch, daß er einzelne Wörter oder kurze Sätze wiederholt, klingen seine Schilderungen noch eindringlicher.
Hier drei Beispiele:
-"Sie können ja nicht - ! Sie wirken wie Familienväter, die der Frau was befehlen, aber die Frau steckt sich die Haare auf und geht ihre Wege. Und Vater schüttelt traurig den Kopf ... Sie können ja nicht."
-"Sie paktieren ängstlich mit einer Welt, die sie nie für voll nehmen wird, und die sie haßt, haßt, haßt."
-"Statt hier zu sagen: Nein! [...] Statt hier ins Mark zu treffen.."2
Und weil die Regierung kein Interesse daran hatte, dem reaktionären Treiben ein Ende zu bereiten, war für Ignaz Wrobel der Weg den die Republik nehmen würde bereits 1920 vorgezeichnet:
"Und Geschehnis gliedert sich an Geschehnis, und Keiner will sehen, wie wir offenen Auges ins Verderben laufen. Weit, weit hinter das Jahr 1914 zurück."3
Nach der Kritik an der Regierung folgt die Kritik am
"Durchschnittsdeutschen". Wrobel beschreibt diesen ebenso, wie Heinrich Mann seinen "Untertan" beschrieben hat. Indem sich "der Untertan" mit der Macht identifizierte, konnte er scheinbar an ihr teilhaben. Indem er nach oben "kuschte", konnte er aber auch nach unten treten, also selbst Macht ausüben.
Seine Vorwürfe sind als Frage formuliert: "Wißt ihr nicht, daß...". Dadurch regt er die Leser zum Nachdenken und Überprüfen dieser Aussagen an. Weil dieser "Durchschnittsdeutsche" Angst vor dem "Fortschritt" (steht für Demokratie) hat, befürwortet er "das Zürückzerrende"1 (steht für die Reaktion bzw. den Militarismus).
Mit kurzen und ausrufenden Sätzen prangert er wiederum das Versagen der Regierung an, nicht in der Lage zu sein, "Mut und Macht" zu demonstrieren, und damit den sich damals nicht trauenden "Untertanen" den Weg nach vorne gewiesen zu haben.
Die explosive Sprache kennzeichnet seine Wut. Trotzdem bemerkt man, daß diese emotionale Kritik letztendlich einen Appell darstellt. Er möchte die Regierung aufrütteln:
"Um zu regieren: dazu gehören vor allem einmal Mut und Macht. dazu gehört die - nicht nur figürliche - große Geste, die da sagt: Jetzt sind wir die Herren! Wir wohnen im Schloß! Wir herrschen! Wir repräsentieren! Wir decken das Alte auf und zeugen Neues! Wir. Wir. Wir."2
Diese Zeilen sind im Präsens geschrieben, sie lassen dadurch immer noch die Möglichkeit offen, den beschriebenen Zustand herbeizuführen. Das "wir" deutet auf Wrobels Verbundenheit hin.
Der nächste Absatz klingt provozierend:
"Aber freilich: dazu müßte man irgendeine Mehrheit seines Landes hinter sich haben. Man hatte sie einmal. Es ist das genau fünfzehn Monate her. Vorbei, vorbei."3
Vor allem die letzten beiden Worte klingen hämisch. Man hat den Eindruck, daß Wrobel mit dem "vorbei, vorbei" eine Reaktion bei den Regierenden auslösen will, die ihn vom Gegenteil überzeugt. Wenn diese Reaktion aller- dings nicht eintritt, wird der Zustand des nächsten Abschnittes eintreten. Die Aussage dieses Abschnittes soll offenbar nochmals zum intensiven Nachdenken anregen:
Wohin gleiten wir? Dahin, wohin uns ein spießiger und kurzstirniger Kommodore gesteuert hat - und wohin wir doch wohl schließlich, wenn denn die Weltgeschichte einen Sinn haben sollte, zu gehören scheinen."1
Am Schluß kommt Wrobel wieder auf das "berliner Schloß" mit seinem Geist zurück. Diese Erzählung bildet demnach den Rahmen für seinen Artikel. Die weiße Frau steht für das kaiserliche Deutschland. Dieser Geist tritt in Gestalt einer Frau auf. Überhaupt finden sich im gesamten Artikel immer wieder Vergleiche zwischen einer Frau und dem kaiserlichen Deutschland. So wird z.B. im folgenden Satz die Mutter mit dem geflohenen Kaiser vergli- chen:
"Alle Leute gingen herum wie die Kinder, wenn Mutter fortgegangen ist - man war frei, aber man traute sich nicht so recht."2
Im folgenden Satz wird die Frau mit der "Reaktion" verglichen, die den Befehl des schwachen Familienvaters (der Regierung) ignoriert:
"Sie wirken wie Familienväter, die der Frau was befehlen, aber die Frau steckt sich die Haare auf und geht ihre Wege. Und Vater schüttelt traurig den Kopf..."3
Auch die Frau "Major", die inzwischen "Oberstwitwenpension" erhält, steht mir dem kaiserlichen Deutschland in Verbindung.
Mit dem Begriff "Geist" verweist Wrobel ironischerweise auf die "ungeistigen Hohenzollern". Dieser Begriff wird hier zunächst positiv verwendet. Mit diesem Hinweis möchte Wrobel darstellen, wie wenig dieses Adelsge- schlecht zum "deutschen Geist" beigetragen hat.
Andererseits steht der Begriff für "Spuk" oder "Gespenst". So kann der gesamte Artikel als Aufforderung betrachtet werden, mit diesem "Spuk" endlich aufzuräumen. Die Regierung ist in ihrem derzeitigen Zustand aller- dings zu schwach dazu. Wenn sich dieser Zustand nicht ändert, bleibt der geflohene Kaiser ("der atlantische Admiral"), Vorsteher dieses Schlosses. Sein Ge-spenst steht bereits wieder vor den Türen und weht durch die öden Korridore (der Ämter).
Wieder kann man sich den Erzähler umringt von einer Schar Kinder, am Feuer sitzend, vorstellen. Die Stimme des Erzählers klingt geheimnisvoll, die Kinder lauschen gebannt. "...Wenn ihr hübsch leise seid, könnt ihr sie [die weiße Frau] kichern hören."4
Die Kinder trauen sich aber nicht so recht.
6 1925-1929: Die Republik beschreitet ihren Weg
6.1 Geschichtlicher Rückblick
Mitte der zwanziger Jahre kontrollierte ein gewaltiger Pressekonzern einen Großteil der gesamten deutschen Presse.
Der Geheimrat Alfred Hugenberg, deutschnationaler, dem ultrarechten Flügel zugehöriger Reichstagsabgeordneter, war Besitzer dieses Konzerns. Um die Mitte der zwanziger Jahre kontrollierte der Hugenbergkonzern mindestens zwei Drittel der gesamten deutschen Presse. Die damals größte Filmherstel- lungs- und Vertriebsgesellschaft, die Ufa, gehörte ebenfalls zu diesem Konzern.
Die Entwicklung dieses Medienkonzerns, seines Drahtziehers, seine Verflechtungen und seinen Einfluß auf die Öffentlichkeit stellt Bernt Engel- mann in seinem "Antigeschichtsbuch" relativ kompakt dar. Da vor diesem Hintergrund Wrobels Kritik an der Presse, vor allem der Provinzpresse verständlich wird, werden diese Untersuchungen in den Anlagen wiederge- geben.
Im Januar 1925 wurden die Deutschnationalen zum erstenmal Regierungspartei. Luther bildete mit ihnen eine rechte Koalitionsregierung. Diese Regierung gab gleich zu erkennen, daß sie anstatt des Achtstundentages, eine Verlängerung der gesetzlichen Arbeitszeit auf 10 Stunden täglich für "unabdinglich" hielt. Diese Äußerung löste bei den Linksparteien, einschließlich der SPD und der Arbeiterschaft, große Empörung aus. Bevor sich diese Empörung aber durch gemeinsames Handeln Luft machen konnte, verdrängte ein Ereignis diese "Klassenkampf-Stimmung". Der Tod Friedrich Eberts am 28. Februar 1925 und die Frage, wer sein Nachfolger werden sollte, ließ alles andere in den Hintergrund treten.
"Eberts Tod stürzte die bürgerliche Republik und die noch ungefestigte Demokratie in eine schwere Krise. Das Amt des Reichspräsidenten war von den Vätern der Weimarer Verfassung mit beinahe diktatorischen Vollmachten ausgestattet worden. Das Staatsoberhaupt konnte die Länder mit Waffengewalt zur Einhaltung der Verfassung und zur Wiederherstellung von "Sicherheit und Ordnung" zwingen, dazu auch die wichtigsten Grundrechte außer Kraft setzen, vom Parlament verabschiedete Gesetze blockieren und einen Volksentscheid erzwingen, auch den Reichstag vorzeitig auflösen. Seine Machtfülle war also ungleich größer als die des Kanzlers."1
Im ersten Wahlgang bekam keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit.
SPD, Zentrum und Demokraten stellten nun einen gemeinsamen Kandidaten auf. Ihre Wahl fiel auf den Zentrumsmann Dr. Marx. Die Kommunisten stellten Ernst Thälmann auf. Auch die rechten Parteien einigten sich auf einen Kandidaten: Der 78jährige kaiserliche Generalfeldmarschall Paul v. Benekkendorff und v. Hindenburg sollte ihrer Meinung nach zukünftiger Präsident der Weimarer Republik werden.
Der achtundsiebzigjährige General, der sich vom politischen Leben zurückge- zogen hatte, ließ sich für die Kandidatur freilich erst gewinnen, als Emissäre der DNVP, darunter Großadmiral von Tirpitz, an sein vaterländisches Pflichtgefühl appellierten und ihm zusicherten, daß die Parteien der Rechten geschlossen für ihn einträten."2
Die "Hugenberg-Presse" trug wesentlich zum Wahlausgang bei. Der von ihr als "Retter des Vaterlandes" und "Garant einer Bewahrung Deutschlands vor der roten Flut" angepriesene Feldmarschall, gewann die Wahl. Er erreichte 14,65 Millionen Stimmen. Dr. Marx erhielt 13,75 Millionen und Ernst Thälmann 1,9 Millionen Stimmen.
Hindenburg erntete nun die Früchte der Stabilisierungspolitik, die die Sozialdemokraten und ihre bürgerlichen Verbündeten betrieben hatten. Amerikanische Kredite bewirkten einen wirtschaftlichen Aufschwung, der Reichshaushalt verzeichnete sogar Überschüsse und die Außenpolitik hatte inzwischen unter Minister Stresemann erhebliche Fortschritte in der Entspannung erreicht (z.B. Aufnahme in den Völkerbund). Diese Fortschritte wurden allerdings von seiten der Rechten und der "Hugenberg-Presse" zu Hetzkampagnen gegen die "Verzichtregierung" mißbraucht.
Die Reichstagswahlen vom 20 Mai 1928 brachten den Regierungsparteien und der NSDAP starke Einbußen, hingegen konnten die Sozialdemokraten und die Kommunisten Gewinne verbuchen. Ein Sozialdemokrat, Hermann Müller, übernahm das Kanzleramt. Das neue Kabinett, bestehend aus DVP, Zentrum, Bayrischer Volkspartei, Demokraten und SPD, hatte eine sichere Mehrheit im Reichstag. Müllers Forderungen - u.a. allgemeine Abrüstung, Hilfe für die Landwirtschaft, Bekämpfung der Wohnungsnot in den Städten, soziale Verbesserungen für die Arbeiterschaft, Garantie des Achtstundentags und die Erklärung, daß man vorhätte, die Todesstrafe abzuschaffen - wurden kaum kritisiert. Man hielt die Weimarer Republik jetzt für konsolidiert. Doch der Schein trog.
Die Rechten begannen sich zusammenzufinden. Sie wollten den Sturm auf die Republik wagen, ehe sie noch stabiler geworden war. Hugenberg übernahm die Führung der Deutschnationalen.
"Der Reichspräsident, die Generale, das Offizierskorps der Reichswehr, die meisten hohen Richter und Beamten sympathisierten mit den Deutschnationa- len; die adligen Grundbesitzer und die konservativen Bauern, die Führung der evangelischen Kirche, das Reichsbankpräsidium, zahlreiche Industrielle und Bankiers sowie ein bedeutender Teil des Mittelstands war deutschnational gesinnt."1
Der deutschnationale Frontkämpferbund "Stahlhelm", der bereits knapp eine halbe Million Mitglieder zählte, vollzog auf Hugenbergs Drängen einen weite- ren Rechtsruck. Im September 1929 überraschte Hugenberg die Öffentlich- keit mit einer rechtsoppositionellen Einheitsfront. Hugenberg, der Stahlhelm- führer Seldte, Hitler und die Führer weiterer rechter Gruppen beantragten ein Volksbegehren mit dem Ziel, den Young-Plan scheitern zu lassen. Dieser Plan sah eine starke Senkung der Reparationszahlungen und eine sofortige Räumung des besetzten Rheinlandes vor.
Trotz massiver Propaganda durch die Hugenberg- und Nazi-Presse (sie sprachen von der "Versklavung" Deutschlands), stimmten nur 5,8 Millionen Wähler gegen den Young-Plan. 21 Millionen Stimmen hätte dieser Antrag bedurft, um angenommen zu werden.
Am 3. Oktober 1929 starb im Alter von 51 Jahren, Reichsaußenminister Dr. Gustav Stresemann. Der ursprünglich rechts stehende Nationalliberale hatte seit 1923, zuerst als Reichskanzler, dann als Außenminister aller folgenden Regierungen eine Politik der Aussöhnung mit Frankreich betrieben. 1926 erhielt er, zusammen mit seinem französischen Kollegen Aristide Briand, den Friedensnobelpreis. Sein Tod führte zu einer Schwächung des Bündnisses zwischen Volkspartei, Zentrum und SPD.
Am 24. Oktober 1929 fielen die Kurse an der New Yorker Börse geradezu ins Bodenlose. Die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von der US-Wirtschaft führte dazu, daß Deutschland von dieser Krise am stärksten betroffen war. Es kam zu Konkursen und Bankzusammenbrüchen. Bereits Ende 1929 gab es wieder 14,6 Prozent Arbeitslose. Die republikfeindliche Stimmung wuchs. Die Hetzkampagne der "Schlüsselfigur" Hugenberg fiel allmählich auf frucht- baren Boden.
6.1.1 Kulturelle und ideologische Strömungen
Vertreter der "Neuen Sachlichkeit" waren Pragmatiker oder Realpolitiker, sie überzeugten ihre Anhänger durch Nüchternheit. Ihr Ideal war eine reibungslos funktionierende Planungsgesellschaft jenseits aller Radikalideologien mit dem Ziel der industriellen Produktionssteigerung.
Teile des fortschrittlichen Mittelstandes, Intellektuelle und Gewerkschaftsfüh- rer gingen dazu über, die USA als das maßgebliche Vorbild der zukünftigen Entwicklung in Deutschland hinzustellen. Man sah die USA als ein Land des Pragmatismus, des Tatsachenkults, der sachbezogenen Arbeitsverhältnisse.
"Der Amerikanismus der mittleren zwanziger Jahre ist daher nicht nur ein Produkt des Dawes-Plans und des mit ihm verbundenen Dollarsegens, sondern muß ideologisch in wesentlich größeren Zusammenhängen gesehen werden. Er beruht auf einer mit Furcht gemischten Bewunderung von dem mächtigsten Industriestaat der Erde, der aus dem Ersten Weltkrieg als die Weltmacht Nr. 1 hervorgegangen war und sich damit - gewollt oder ungewollt - allen anderen westlichen Industrienationen als politisches, gesellschaftliches und kulturelles Vorbild aufdrängte."1
6.2 Ignaz Wrobel - "Revolution des Proletariats"
"Man kann aber keinen politischen Kampf ohne Klarheit führen, ohne ein dogmatisch starres Programm, das doch wieder biegsam und elastisch sein mußwie bester Eisenstahl - mit Gefühlen allein kann man keine Revolution machen. Aber ohne sie auch nicht." 1
Tucholsky war von Paris bald "völlig betrunken". Anders als in Berlin fühlte er sich hier zu Hause. Wie im Brief an Siegfried Jacobsohn (veröffentlicht am 3. Januar 1924 in der "Weltbühne") angekündigt, bekam er "im Ausland unter richtigen Menschen wieder einen klaren Kopf, Übersicht und Festigkeit". Er brach sein Schweigen und schrieb wieder.
Ignaz Wrobel formulierte seine Artikel über Deutschland und die Deutschen jetzt scharf und unerbittlich. Weitere Warnungen an die Regierung und an die Politik schienen ihm zwecklos. Er begann diese Republik zu hassen und ging zum Frontalangriff über.
Nun wollte Tucholsky das Volk aufwühlen. Den Massen galt seine Hoffnung, sie wollte er überzeugen und gewinnen.
Kurt Tucholsky hatte sich, wie in seinem Artikel "Horizontaler und vertikaler Journalismus" vom 13. Januar 25 beschrieben, mit den Lebensumständen der Arbeiter direkt befaßt. Zusammen mit Harry Graf Kessler, einem Re-dak- teur der Monatszeitschrift "Die Deutsche Nation", hatte er bereits 1920 die "Wohnhöllen" der Proletarier besucht. Der Anblick dieses Elends hatte bereits damals seine Einstellung zum Proletariat verändert:
"Ich habe immer wieder und wieder grade in diesem Deutschland, grade unter diesen erbärmlichen Lebensumständen, in diesen mit Menschen vollgepfropften Stuben, in diesen Tuberkuloselöchern so viel Herzensgüte gefunden, so viel Idealismus, so viel Herzenstakt , daß die Phrase, 'die Revolution ist nur eine Lohnbewegung', doch wohl falsch sein muß."2
Ignaz Wrobel widmete sich jetzt auch Themen, die speziell die Arbeiter ansprachen. Als Beispiel wäre hier ein mehrseitiger Artikel, über die geplante Streichung des Achtstundentages in Deutschland zu nennen. Am Ende dieses Artikels zitierte er Karl Marx.
Durch die Lektüre von Marx, Lenin und Trotzki und seine Auseinanderset- zung mit der Entwicklung in Rußland, entwickelte sich Tucholskys politische Einstellung immer weiter nach links.
Bereits Wrobels erster Artikel aus Frankreich "Sechzig Photographien" war ein Appell an den einfachen Menschen, an den Arbeiter und Proletarier. Dessen Gefühl sprach er durch seine Beschreibung von Kriegsphotogra- phien an, auf denen deutsche Soldaten tot und lebendig abgebildet waren. Er fand diese "Andenken aus dem Weltkrieg" in einem englischen Ansichtskartengeschäft in Paris und beschrieb sie:
"Ein tiefer Graben, unten, gekrümmt, hingepackt, schon halb vergraben, die Leichen. Ringsherum die trostlose Landschaftslosigkeit des Kriegsschauplatzes zweier Welten. 'Dead Germans'. Ein Bündel Kleider, wie ein Haufen Flicken, heraus ragen zwei Paar Stiefel: dies waren Menschen. 'Wondet Boche'. Im Graben, an einer unendlich langen leeren Bahnstrecke liegt ein dunkler Haufen, auf dem Bilde bewegungslos. Zerschossene Deutsche, verstümmelte Deutsche, verweste Deutsche, Deutsche verschüttet und Deutsche friedlich im Tode schlafend - und ein Gerippe in Uniform. Und noch ein Gerippe. Und auf einem Bild eine riesige Grube mit Schädeln, mit Knochen und spitzen Beinen."1
Bereits der nächste Satz deutet auf die Sinnlosigkeit dieses Sterbens hin:
"Und damit der Beschauer auch das anheimelnde Bild des Friedens vor sich habe: der alte Hindenburg, gut genährt, aber streng blickend, Blech an Deutsche verteilend. Und, wahrhaftig: 'Kaiser, von Kluck, Crownprinz' (r - nicht l), 'G. H. Q.' Da steht der Selige, lächelt vergnügt und verleiht gleichfalls. Und wieder der Kronprinz, wie er die Andern grüßt, die Andern, die in den Tod gehen."2
Dem ehemaligen gehorsamen Soldaten, der bereit war zu leiden und zu sterben, zeigte Wrobel durch diese satirische Darstellung die Ungerechtigkeit des Krieges auf. So konnte beim Leser der Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit erkannt werden.
Als er eine Photographie beschrieb, spürt man förmlich wie er mit dem Finger auf den einfachen Mann zeigte und sagte: "Das bist Du!" Er schrieb:
"Da gehen sie. Da gehen Proletarier in Lumpenjacken, in den zerfetzten Röcken ihres Kaisers, vorn und an den Seiten berittene Soldaten, die den Auftrieb begleiten, Männer und Frauen stehen dabei, mit Rädern und Körben, und sehen zu. [...] Diese Bilder rufen. Sie sagen aus von unermeßlicher Qual, von Hunger und Durst, von Hitze und Kälte, von Schmerzen, von faulenden Wunden, von Erniedrigungen, von Stumpfsinn, von Ungeziefer, von stinkendem Stroh, von menschlichen Niedrigkeiten, von Wahnsinn und Tierheit, von Schmerz und Todesnot und endloser, unmenschlicher Einsamkeit."3
Bei der nächsten Photographie beschrieb er "die Anderen":
"Da sind sie noch einmal, die jungen Herren und die ältern, die der Krieg jung - und wie jung! - werden ließ, sie spielen Guitarre, und einer hat den Stiefel auf die Schultern des andern gelegt, Volksschullehrer, Baumeister, Bankbeamte, sie sind alle sehr vergnügt: eine Uniform und eine Seelenlosigkeit."1
Am Ende folgte der direkt an den Arbeiter gerichtete Aufruf:
"Du schießt drüben immer den Kamerad Werkmeister tot - niemals den einzi- gen Feind, den du wirklich hast. Dein Blut verströmt für Dividende. Dein bißchen Sterben, dein armseliges Verrecken wird mühsam mit einer Gloriole von Romantik umkleidet, erborgt aus den Emblemen von Jahrhunderten, entlie- hen aus verschollenen Zeiten. Wirf deine Flinte weg, Mensch! Es wird immer Kriege geben? Solange du willst, wird es sie geben. Nagle dir diese Bilder an die Wand, zeig deinen Kindern, was das für eine Schweinerei ist: der Krieg; was das für eine Lüge ist: der Krieg, was das für ein Wahnsinn ist: der Krieg! Und dann setze dich mit deinen Arbeitsgenossen auf der andern Seite hin, vertraue ihnen, denn es sind dieselben armen Luder wie du - und gib ihnen die Hand. Nieder mit dem Staat! Es lebe die Heimat!"2
Im zweiten Halbjahr 1924 ist Ignaz Wrobel wieder mit 26 Artikeln in der Weltbühne vertreten. Diese Artikel fesseln. In ihnen kommt die ganze Wut zum Ausdruck, die Wrobel auf die Deutsche Republik hatte. Immer wieder verglich er die Deutschen mit den Franzosen und immer wieder schnitten die Deutschen in diesen Vergleichen sehr schlecht ab. Einerseits die geistlosen, untertänigen und kleinbürgerlichen Deutschen, andererseits die weltoffenen, taktvollen und klugen Franzosen. Wrobel schämte sich inzwischen, diese Deutschen als Landsleute zu haben.
Am 28. Juli 1924 erschien ein Artikel, in dem Wrobel abermals die schrecklichen Zustände im Krieg beschrieb. Dieser Artikel kam nach einer Besichtigungsfahrt der Stadt Verdun zustande, welche Wrobel in einer Gruppe mit einem Stadtführer unternahm. Wiederum beschrieb er das Leiden des einfachen Soldaten und stellte die Sinnlosigkeit dar:
"Hier sind eine Million Menschen gestorben. Hier haben sie sich bewiesen, wer recht hat in einem Streit, dessen Ziel und Zweck schon nach Monaten Keiner mehr erkannte. Hier haben die Konsumenten von Krupp und Schneider-Dreu- zot die heimischen Industrien gehoben. (Und wer wen dabei beliefert hatte, ist noch gar nicht einmal sicher.)"3
Auch hier appellierte er an das Gefühl und wollte vor allem die einfachen Menschen ansprechen:
"Und die Eltern? Dafür Söhne aufgezogen, Bettchen gedeckt, den Zeigefinger zum Lesen geführt, Erben eingesetzt? Man müßte glauben, sie sprächen: Weil Ihr uns das Einzige genommen habt, was wir hatten, den Sohn - dafür Vergel- tung! Den Sohn, die Söhne haben sie ziemlich leicht hergegeben. Steuern zahlt man weniger gern. Denn das Entartetste auf der Welt ist eine Mutter, die darauf noch stolz ist, das, was ihr Schoß einmal geboren, im Schlamm und Kot umsin- ken zu sehen. Bild und Orden unter Glas und Rahmen - 'mein Arthur!' Und wenns morgen wieder angeht - ?"1
Wrobel stellte den Krieg als Ausbeutung der Arbeiter dar. Die Rüstungsindustrie und letztendlich das Kapital führt Krieg. Ein Krieg geht auf Kosten der Soldaten und letztendlich der Arbeiter:
"Da kämpfen sie, Brust an Brust: Proletarier gegen Proletarier, Klassengenos- sen gegen Klassengenossen, Handwerker gegen Handwerker. Da zerfleischten sich einheitlich aufgebaute oekonomische Schichten, da wütete das Volk gegen sich selbst, ein Volk, ein einziges: das der Arbeit. Hinten rieb sich Einer voll Angst die Hände."2
Durch diese Beschreibung wies Wrobel den Arbeiter auf seinen wirklichen Feind hin. Die Aufforderung zum Klassenkampf folgte aber nicht, stattdessen erschien im vorletzten Abschnitt des Artikels eine Zeitungskritik:
"Ist es vorbei - ? Sühne, Buße, Absolution? Gibt es eine Zeitung, auch nur eine, die nachher zugegeben hätte: 'Wir haben geirrt! Wir haben uns belügen lassen!'? (Das wäre noch der mildeste Fall.) Gibt es auch nur eine, die nun den Lesern jahrelang das wahre Gesicht des Krieges eingetrommelt hätte, so, wie sie ihnen jahrelang diese widerwärtige Mordbegeisterung eingebläut hat? 'Wir konnten uns doch nicht verbieten lassen!' Und nachher? Als es keinen Zensor mehr gab? Was konntet Ihr da nicht? Habt Ihr einmal, ein einziges Mal nur, wenigstens nachher die volle, nackte, verlaust-blutige Wahrheit gezeigt? Nachrichten, Nachrichten wollten sie alle. Die Wahrheit will keine."3
Der Artikel endete mit einer Vorhersage:
"Und aus dem Grau des Himmels taucht mir eine riesige Gestalt auf, ein schlanker und ranker Offizier, mit ungeheuer langen Beinen, Wickelgamaschen, einer schnittigen Figur, den Scherben im Auge. Er feixt. Und kräht mit einer Stimme, die leicht überschnappt, mit einer Stimme, die auf den Kasernenhöfen halb Deutschland angepfiffen hat, und vor der sich eine Welt schüttelt in Entsetzen: 'Nochmal! Nochmal! Nochmal - !"4
Kurt Sontheimer wirft zwar in seinem Standardwerk "Antidemokratisches Denken der Weimarer Republik" den linksintellektuellen Schriftstellern mangelnde Unterstützung der bestehenden Republik vor, verkannte allerdings nicht den Wert ihrer pazifistischen Werke:
"Entgegen einer Welle der Heldenverehrung und der blinden Begeisterung für Kriegsspiel und Wehrertüchtigung rissen diese pazifistischen Literaten dem Krieg die heroische Maske vom Gesicht. Sie wollten im Angesicht der Reaktion die Idee der wahren demokratischen und sozialen Republik nicht untergehen lassen. Von diesem politischen Standort her war der Faschismus und der in seinen Bannkreis geratene Deutschnationalismus in seiner Gefährlichkeit für den Fortbestand der Republik am klarsten zu erkennen."5
Im Oktober erschien Wrobels Artikel "Gewehre auf Reisen". Hier stellte er ein Buch vor, das "den deutschen Waffenschmuggel der letzten Jahre auf Grund von Quellen ausführlich behandelt." Den Anlaß zu diesem Artikel könnte die damalige heimliche Aufrüstung der Armee durch die Reichswehrführung gegeben haben. Die Reichswehrführung hatte das Ziel, das deutsche Volk "wehrhaft" zu machen und entgegen den Bestimmungen des Versailler Vertrags heimlich eine schlagkräftige Armee aufzubauen. Von Anfang an wurden geheime Waffenbestände angelegt. Teile der Industrie arbeiteten zu diesem Zweck mit dem Heereswaffenamt zusammen. Wrobel stellte hier die "jämmerliche Rolle der deutschen Justiz" dar, die den "ahnungslosen Engel" spielte. Auch die Republik wäre "schwächlich, nachgiebig unsicher" und lasse "das Wichtige unangetastet"
Am Ende dieses Artikels blickte er wieder in die Zukunft:
"Aber es ist gewiß, daß das Land in seiner jetzigen, völlig unveränderten Geistesverfassung wieder in eine Katastrophe hineintaumeln wird, genau wie im Jahre 1914: dummstolz, ahnungslos, mit flatternden Idealen und einem in den Landesfarben angestrichenen Brett vor dem Kopf. Dann gehen wieder Gewehre auf Reisen.1
Am 18. November erschien der Artikel "Der Fall Nathusius". Wrobel berichtet dort von einem deutschen General, welcher von den Franzosen verhaftet wurde, weil er im Verdacht stand, während des Krieges Möbel in Lille gestoh- len zu haben.
Diese Verhaftung konnte Wrobel nicht gutheißen. Zum ersten Mal kritisierte er das Verhalten Frankreichs. Er wies auf seine "Militaria-Aufsätze" hin, in denen er 1919 "die Brutalitäten, die Dummheiten, die Rohheiten, die Unter- schlagungen und Diebstähle [...] gekennzeichnet hatte". Da aber "der Krieg ein Verbrechen in Reinkultur war" komme "die gerichtliche Verurteilung einzelner Individuen wegen einzelner Delikte nach einem solchen Massen- verbrechen ungefähr dem Versuch gleich, dem Soldaten, der am Kriege teilgenommen hat, eine Geldstrafe wegen ruhestörenden Lärms und wegen unbefugten Waffengebrauchs aufzubrummen. [Satzbau leicht verändert - Anm. der Verfasserin]."2
In diesem Artikel riß er verschiedene Themen an. Man hat den Eindruck, es handle sich um Geistesblitze. Beispielsweise erwähnte er zwischen zwei Sätzen, die sich mit den Möbeldiebstählen beschäftigten, plötzlich den ehemaligen Kaiser. Er schrieb:
"Den in Doorn traf es überhaupt nicht. Er erklärte gleich, nur vor seinen Gott zum Beten, aber nicht vor ein menschliches Gesicht treten zu wollen, und beschäftigte sich im übrigen damit, aus der Untertanenrepublik des Herrn Ebert an Geldeswert herauszuschlagen, was irgend herauszuschlagen war."1
Um diesen Einwand verstehen zu können, ist ein geschichtlicher Exkurs notwendig:
Nachdem Wilhelm II. erzwungenermaßen abgedankt hatte, entschwand er (man könnte auch sagen, er wurde fahnenflüchtig) am 10. November nach Holland. Dort baute er sich Haus Doorn bei Amerongen für 1,35 Millionen holländische Gulden zu einem repräsentativen Schloß, seinem Ruhesitz aus.
"In den Jahren 1919/20 'entnahm' er aus seinem im Vaterlande zurückgebliebenen Vermögen genau 69063535,- Mark. Außerdem zahlte das geschlagene und völlig verarmte Deutsche Reich seinem teuersten Pensionär Monat für Monat rund 50000 Mark Rente - erst unter der Reichspräsidentschaft Friedrich Eberts, dann unter der des Generalfeldmarschalls Paul von Hindenburg [...] und schließlich auch unter der 'Führer'schaft Adolf Hitlers."2
Der "steinreiche Rentner", Wilhelm II., starb erst im Sommer 1941 im Alter von 82 Jahren.
Wrobel verglich dieses Gerichtsverfahren mit einem Privatstreit zwischen "Müller und Schulze um des Nachbarn Esel". Auf der anderen Seite stünde die "barbarische Weltungeheuerlichkeit". Die Diskrepanz zwischen dem Krieg einerseits und dem Gerichtsverfahren andererseits "reizte zur Satire, wenn es nicht stets so traurig endete".
Der darauffolgende Absatz erinnert ein wenig an den Artikel "Macchiavelli". Wrobel fragte unter Erwähnung der Bergpredigt nach dem Übergang zwischen dem Mord, der mit "einem Blechstück" belohnt wurde und dem, der mit Zuchthaus bestraft wurde.
Bei der Lektüre dieses Artikels wird allmählich klar, daß Wrobels angeschnittene Themen, seine Gedankensprünge ein Ziel hatten. Und wie weitblickend er damals war, wird beim Lesen folgender Zeilen bewußt:
"Jeweils ganze Völker mit dem Fluchwort des 'Prestige' in die Fahnentollheit zu hetzen, das arme Luder Staat, hörig den Großbauern und den produzierenden, transportierenden Kaufleuten unterworfen, als einen Götzen aufzublähen, den die Machtlosen anzubeten haben, ein Regierungsgebäude, Annex der Börse, siegreich oder im Racheschwur zu beflaggen: das ist ein Verbrechen, gegen das sich alle Anständigen zu wehren haben. [...] Hier und nur hier liegt das tiefe Problem europäischer Unfruchtbarkeit. Sie spielen Staat, Immer noch spielen sie Staat und haben nicht eingesehen und wollen nicht einsehen, daß sie längst Beute und Spielball einer über alle Grenzpfähle hinauslangenden Internationa- len von Händlern geworden sind, die Gesetze machen und anwenden lassen, wie das Geschäft es befiehlt."3
Jetzt wird deutlich, daß Wrobel, sinnbildlich auf einem Podest zwischen Frankreich und Deutschland stehend, einen enormen "Weitblick" hatte. Er erkannte das Prinzip der Nationalstaaten als die Quelle allen Übels. Und weil von diesem Spiel nicht abgesehen wird, weil Grenzen nicht abgeschafft werden, wird weiterhin der Krieg gutgeheißen und die Reklame für einen neuen betrieben. Von seinem Podest aus konnte Wrobel klar in die Zukunft blicken, er schrieb:
"Dieser neue wird die 'Zivilbevölkerung' eines Besseren und Tödlicheren beleh- ren. Man wird die Städte vergasen, und Schützengräben und Schlachtfeld wird Haus, Keller und Bodenluke sein. Ich wünschte, es würde so. Vielleicht würden dann die heillosen Staatsuntertanen einsehen, was Krieg ist. Je größer die Masse der Verlierenden sein wird, um so gefährdeter wird die Stellung der Kriegsgewinnler werden."1
Sein "Wunsch" bewahrheitete sich. Durch dieses "Bewahrheiten" sind wir zwar heutzutage Wrobels damaligen Forderungen eine gutes Stück nähergekommen. Dennoch regt sich - vor allem in rechten Kreisen - der Widerstand, wenn es, wie Wrobel forderte, darum geht "Grenzpfähle zu zerschlagen" und die "Staatsgrenzen abzuschaffen." Sein Schluß ist daher heute noch aktuell und sollte zu denken geben:
"Im Mittelalter wars die Kirche. Tausende und Hunderttausende haben sich ihr unterworfen ohne Einsicht und gegen bessere Einsicht, weil sie Zehntausende verbrannt hat. Sie war Gemeingut, kleineres Übel, verklemmter Schmerz. Die ihrem Jahrhundert voraus waren, heulten es in ihre Tagebücher oder wählten sonderbar verschnörkelte Formen, um vermummt vor ihre Zeitgenossen zu treten. Wer Ohren hatte, der sollte hören... Die Kirche hat viel Gutes getan, aber sie lastete auf Allem, was da frei war, und drehte das Rad der Zeit perpe- tuierlich zurück. Im Mittelalter war es die Kirche. Heute ist es der Nationalstaat."2
Drei Monate später kommen diese Gedanken in Wrobels Leitartikel "Zwischen zwei Kriegen" nochmals zum Ausdruck. Er kritisierte dort die fehlende Annäherung der beiden Länder Frankreich und Deutschland. Dieje- nigen, die bewußt an einer Annäherung der beiden Völker arbeiteten, die pazifistischen Politiker und die Künstler, würden sich nur in ihren Kreisen bewegen. Die pazifistischen Politiker wären im jeweils anderen Land unbekannt und die Künstler wären wie vor dem 1. August 1914 ohne Einfluß auf die Massen. Die Presse, die durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, die Massen der Länder einander näherzubringen, nutzte ihre Chance nicht. Dadurch, daß in Deutschland
"die kleine Lokalpresse fast ganz in den Händen reaktionärer Buchdruckereibe- sitzer ist, hat man von Frankreich eine gradezu groteske Vorstellung. Es ist für einen anständigen Berichterstatter unmöglich, in diesen Zeitungen aufklärend zu wirken; sie wollen das gar nicht. Neben den unsinnigen Depeschenfetzen nichts Gescheites über Frankreich, nie eine Schilderung der französischen Familie, der französischen Studenten, der französischen Geistlichkeit, nichts. Die Kinderei, erwachsene Menschen mit doppelten Ehebrüchen, pariser Raubmördern, ältern Kokotten in Longchamps zu unterhalten, wird in Text und Bildern von den Verlegereien eifrig gefördert. Die paar Ausnahmen zählen nicht. [...] In Frankreich ist mehr guter Wille, sich zu informieren, aber die Quellen rieseln dünn."1
Der Schluß des Artikels war wieder eine Voraussage, bei der er allerdings die Hitler-Anhänger unterschätzte:
"Wir gehen nicht den Weg des Friedens. Es ist nicht wahr, daß freundliche Gespräche am Genfersee den Urgrund künftiger Kriege aus dem Wege räumen werden: die freie Wirtschaft, die Zollgrenzen und die absolute Souveränität des Staates. Die Kinder unsrer bekanntesten Männer haben alle Aussicht, unbekannte Soldaten zu werden. Deutschland hat nicht nötig, sich in eine Monarchie zu verwandeln - diese Republik tut es auch, und viel gefährlicher als bärtige Wotan-Anbeter sind die philosophischen Verfechter eines schwarz-rot- goldenen Befreiungskampfes. Wir stehen da, wo wir im Jahre 1900 gestanden haben. Zwischen zwei Kriegen."2
Er behielt recht. 14 Jahre später begann der Zweite Weltkrieg, dessen Verlauf er in seinem "Brief an einen bessern Herrn" in gespenstisch genauer Voraussage bereits im März 1925 beschrieb:
"[...] das imperialistische Deutschland ist wieder eine europäische Macht gewor- den. Nun, da es so weit ist, hat sich der neue Aufschwung zu einem Vorschlag an das Ausland verdichtet: Anerkennung des halben Versailler Vertrages. Der Westen soll in Ruhe gelassen werden, Deutschland wird die Rheingesänge abbauen, Deutschland will keineswegs etwas gegen Frankreich unternehmen. Gegen wen denn -? Gegen Polen. Man kann auch auf einem andern Wege als über Belfort der Stadt Paris beikommen - nämlich über Warschau. Während die deutsche Politik der letzten vierzig Jahre nur auf einer vorhandenen oder herbeigesehnten Uneinigkeit zwischen England und Frankreich aufgebaut war, drehen sich nun die deutschen Außenpolitiker nach der andern Seite und unter- nehmen das Gefährlichste, weil zunächst Erfolgreiche und dann erst zu einer Katastrophe Führende, das es für uns gibt: eine aggressive Ost-Politik.
Die Rektifikation der Ostgrenzen Deutschlands liegt hart an der Notwendigkeit. Der Polnische Korridor ist zwar bis auf den heutigen Tag niemals eine Prestige- frage der deutschen Nation gewesen - Sie werden ihn in kürzester Zeit dazu gemacht haben. [...]
Die Ostgrenze Frankreichs steht in des Wortes wahrster Bedeutung bombenfest. Hier in Polen sehen Sie ein Loch. Das ist schlau, aber nicht klug. Sie können fast Alles, was nun folgen wird, ohne Mühe erreichen. Ihr Plan gleicht gewissen deutschen Komödien: die ersten beiden Akte sind ausgezeichnet, aber nach der großen Pause wird es nicht weitergehen."3
Um die Genauigkeit seiner Vorhersagen herauszustellen, soll nun ein direk- ter Vergleich mit dem historischen Verlauf des Zweiten Weltkriegs erfolgen.
Also zunächst wird Alles klappen. Sie können den Anschluß Österreichs errei- chen, der für Sie unerläßlich ist, Durchdringung Österreichs mit dem preußi- schen Schwung. Vorbei ist es dann in Wien mit der republikanischen
Reichswehr; vorbei mit gewissen demokratischen Tendenzen, die in diesem Stumpf vorhanden sind; vorbei auch mit der leisen Anmeierei an die Entente, der man immer mit einem Blinzler sagen konnte: Wir sind nicht so schlimm wie unsre reichsdeutschen Brüder! "1
Am 12. Februar 1938 drohte Hitler dem Österreichischen Bundeskanzler Kurt v. Schuschnigg mit dem Einmarsch der Wehrmacht, wenn er die Freiheit der Nazis in Österreich behindere. Daraufhin ließ Schuschnigg einen Volksentscheid "für ein freies und deutsches, unabhängiges und soziales, für ein christliches und einiges Österreich" ausschreiben. Dies wurde am 12.03.1938 von Hitler mit der ohnehin beschlossenen militärischen Besetzung und "Eingliederung" Österreichs beantwortet.
Die deutschen Truppen wurden von der Bevölkerung überschwenglich begrüßt. Unter "Volksjubel und Kirchengeläut" wurde die "Wiedervereinigung der Ostmark" mit dem Reich vollzogen.
Mit der Besetzung Österreichs hatte Hitler die Tschechoslowakei umklam- mert.
"Die Tschechoslowakei wird nicht so leicht zu fangen sein. Aber das ist auch gar nicht nötig. Dieser Staat, durchsetzt von Leuten, die keine Tschechen sind, oft noch geschüttelt von Nationalitätskämpfen, wenn auch bemerkenswert gut geführt, stellt für Sie, der Sie nicht anders als militärisch denken können, keine erhebliche Gefahr dar. 'Mit den Tschechen werden wir schon fertig werden.' Fertig ja - es fragt sich nur, wer am Schluß fertig ist."2
Mit Propaganda-Kampagnen wurden die dreieinhalbmillionen Deutsche in der Tschechoslowakei von Berlin aus zu Protesten gegen "das tschechische Joch" und zu Provokationen ermuntert.
Breite Unterstützung erhielt Hitler von der Sudetendeutschen Partei unter der Führung von Konrad Henlein. Diese Partei, die 92% der deutschen Stimmen hinter sich hatte, trug mit ihrer nationalsozialistischen Politik seit den Sommermonaten 1938 bewußt zur Verschärfung der Spannungen bei, indem sie den Anschluß an das Reich forderte. Hitler bot der sudetendeutschen Minderheit in einer Rede am 12. 09.1938 militärische Unterstützung an. Um den Frieden zu retten, schlugen die Engländer ein Treffen vor. Am 22.09.1938 kamen der britische Premier Sir Neville Chamberlain, der französische Ministerpräsident Edouard Daladier und der italienische Diktator Mussolini zu einer Blitzkonferenz nach München. Das "Münchner Abkommen" - ohne Beteiligung der tschechoslowakischen Regierung geschlossen - enthielt die Zustimmung der Westmächte zur Abtretung der sudetendeutschen Gebiete an das Reich.
Viele Menschen glaubten, der Friede sei gerettet, aber schnell zeigte sich, daß Hitler die Appeasement-Politik als prinzipienlose Schwäche ansah.
Am 15.03.1939 besetzte die deutsche Wehrmacht den Reststaat der Tschechoslowakei. Die Besetzung dieses von Nicht-Deutschen bewohnten Gebietes zeigte endgültig die Gewaltpolitik Hitlers auf.
Um den Rüstungsrückstand gegenüber Deutschland aufzuholen, beschleunigten England und Frankreich ihre Rüstungen. Darüberhinaus gaben sie Polen weitgehende Garantien.
"Bleibt Polen. Sie kalkulieren so: Die Polen sind für den Anfang zu überrennen. Dazu ist nötig, daß Sie sich vorher mit Rußland verständigen. Nun ist ja den Russen allerlei zuzutrauen - nur nicht, daß sie mit Ihnen gegen Polen und Rumänien dieses große Geschäft machen, bei dem Jeder glaubt, den Andern hinterher schon betrügen zu können. Das ist die alte deutsche Politik: fremde Völker wie stabile Posten in die Rechnung einzustellen. Manchmal bleibt ein Rest."1
Tatsächlich spielte das Verhalten der Sowjetunion eine entscheidende Rolle für den weiteren Verlauf. Ein gemeinsames Vorgehen in einem britisch-fran- zösisch-sowjetischen Dreibund mit Einschluß Polens kam trotz langwieriger Verhandlungen nicht zustande. So ein Bündnis hätte das Dritte Reich mit einem Zweifrontenkrieg bedroht und damit vielleicht Hitler zurückgeschreckt. Stattdessen wurde zum Erstaunen der Weltöffentlichkeit ein deutsch-sowjeti- scher Nichtangriffspakt unterzeichnet. In einem geheimen Zusatzprotokoll wurde Osteuropa zwischen Hitler und Stalin aufgeteilt. Der Landgewinn für Hitler und Stalin entsprach beider Interessen. Jetzt konnte Hitler seinen Überfall auf Polen riskieren.
Am 01.09.1939 begann der deutsche Angriff auf Polen. Am 17.09. marschierte die Rote Armee in Polen ein. Polen wurde in einem "Blitzkrieg" unterworfen und zwischen Deutschland und der Sowjetunion aufgeteilt. Ignaz Wrobel irrte sich in diesem Abschnitt seiner Vorhersage. Er war überzeugt, daß die Sowjetunion keine Verbindung mit den Deutschen einge- hen würde. Dieser Irrtum läßt sich nachvollziehen, wenn man dem Datum des Artikels die Ereignisse in der Sowjetunion gegenüberstellt: Lenin war gerade ein Jahr tot. Der daran anschließende jahrelange Machtkampf, um die Führung in der Partei zwischen Stalin und Trotzki hatte erst begonnen. Beim Erscheinen dieses Artikels war also weder der Nachfolger Lenins noch dessen Politik bekannt. So konnte Wrobel nur von einer Fortsetzung der bestehenden Außenpolitik ausgehen. Diese sah eine Ausweitung der bolschewistischen Herrschaft ohne "Annexion" und in Einklang mit dem "Selbst-bestimmungsrecht" in Verbindung mit der "Weltrevolution" vor.
"Und nun sind Sie also im besten Zug, sich den Rücken zu decken, den sie dem Westen zugewendet haben. England scheint Ihnen schon gewonnen, denn darin sind Sie so optimistisch wie Herr Stahmer in London, der aus einem Händedruck des Herrn Chamberlain fröhliche politische Folgerungen zieht. Von Frankreich fürchten Sie im Augenblick nichts. Es scheint Ihnen Alles in schön- ster Ordnung.
[...] Sie haben heimgefunden. Es sieht also günstig für Sie aus -? Sie werden also Erfolg haben -? Sie werden also Deutschland zu einem mächtigen Staat machen -? Zu dem mächtigsten Ost-Europas, Vor-Asiens -? Sie werden glücklicherweise keinen Erfolg haben."1
Am 03.09.1939 erklärten England und Frankreich - entgegen Hitlers Erwar- tung - Deutschland den Krieg. Zu diesem Zeitpunkt waren sie nur bedingt kriegsbereit, daher gab es an der Westfront nur geringfügige Kriegs-handlun- gen. Im Mai und Juni 1940 wurden Belgien, Holland, Luxemburg und Frank- reich überrannt. Der größte Teil Frankreichs wurde besetzt. Die Bombardie- rung Englands brachte den Deutschen allerdings nicht den gewünschten Erfolg, so daß eine Landung in England unterbleiben mußte. Im September 1940 wurde zwischen dem Deutschen Reich, Italien und Japan ein Dreimächtepakt geschlossen, dessen Ziel die "Neuordnung" Europas und Asiens nach dem Wunsch der Aggressoren war.
"Der Gedanke, die Deutschen, die im Westen nicht einmal die fünfte Stelle einnehmen können, zu den Engländern des Ostens zu machen, ist nicht so schlecht. Da gibt es viele Klingelleitungen zu legen, viele Fabriken zu errichten, viel zu organisieren."2
Am 22. Juni 1941 überfiel die deutsche Armee ohne Kriegserklärung die Sowjetunion. Die Vernichtung der slawischen "Untermenschen" begann. Der deutsche "Lebensraum" sollte nach Osten erweitert werden und das Land ausgebeutet werden.
Aber sie kennen die Welt nicht. Sie vergessen, daß die Welt heut noch und in den nächsten zehn Jahren einem großen Saal gleicht, in dem eine mächtige Schlägerei aufgeflammt ist, mit großem Krach, Hinauswurf von hundert Leuten, mit einer Galerie, die eingestürzt ist, und einem Polizeiaufgebot, das Verhaftun- gen vorgenommen hat. Und weil Sie immer nur in einer (heute erweiterten) Kaste gelebt haben, weil Sie schlau, aber nicht klug sind, gewitzt, aber nicht weise, gerissen, aber nicht vernünftig - deshalb machen Sie sich einen falschen Begriff von den Dingen, die Deutschland schon einmal an den Rand des Unter- gangs gebracht haben: von den Imponderabilien. Gibt es in diesem Saal jetzt wieder einen Ruhestörer - und sei es selbst einer, der Skandal macht, weil man ihm seine Brieftasche gestohlen hat, also einer, der im Recht ist -: seien Sie überzeugt, daß eine Welt aufsteht und ruft: 'Ruhe'. [...] Sie glauben nicht, wie heute, heute noch, die absolute, über alle wirtschaftlichen Erwägungen hinaus- langende Einheit der ganzen Welt vorhanden ist für den Fall, 'daß Deutschland wieder anfängt'."3
Im Winter 1941/42 begann sich mit der deutschen Niederlage vor Moskau die militärische Wende des Krieges abzuzeichnen. Gleichzeitig erfolgte die Ausweitung zum Weltkrieg. Die Kriegserklärung Hitlers an die USA am 11.12.41 machte die größte Wirtschaftsmacht der Welt zum Gegner Deutsch- lands. Die USA unterstützte ihre Verbündeten mit umfangreichen Materiallie- ferungen. Bald hatten die alliierten Luftstreitkräfte die Luftherrschaft über Deutschland errungen und zerstörten systematisch zahlreiche Städte und Industrieanlagen.
Im Januar 1943 verlor die deutsche Armee bei Stalingrad rund 200000 Mann, durch die Landung der Amerikaner in Marokko im Mai abermals 250000. Von jetzt an waren die deutschen und verbündeten Truppen überall auf dem Rückzug. In Rußland, Frankreich und Italien begannen im Juni 1944 die letzten großen Offensiven. Diese endeten mit der deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945. Deutschland war besiegt, seine Städte zum großen Teil zerstört. Ein alliierter Kontrollrat in Berlin, der sich aus den Oberkommandierenden der vier Besatzungsmächte - England, Frankreich, der Sowjetunion und den USA - zusammensetzte, bildete das alliierte Regierungsorgan.
Wrobels Beschreibung des Kriegsverlaufes ist unglaublich. Fast könnte man meinen, hier handle es sich um das Drehbuch zum Film "Zweiter Weltkrieg". Selbst wenn strategische Überlegungen in diese Verlaufsplanung mit einge- flossen wären, bleibt es dennoch verwunderlich, wie genau die jeweiligen Reaktionen der einzelnen okkupierten Länder beschrieben wurden. Von Tucholsky ist bekannt, daß er während seiner Frankreichzeit in französisch pazifistischen Zentren aktiv war. Außerdem hatte er Zugang zu wichtigen gesellschaftlichen Kreisen und kannte führende Politiker persönlich. Man könnte also vermuten, daß diese Kontakte mit dazu beitrugen, hinter die Kulissen zu schauen und somit den Verlauf eines fiktiven, von Deutschland begonnenen Krieges nachzuvollziehen.
Zehn Tage nach der Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten erschien ein Leitartikel von Ignaz Wrobel in der "Weltbühne".
"Dem der Krieg wie eine Badekur bekommen ist, der wird Präsident der Deutschen Republik, die es nun wohl nicht mehr lange sein wird. Sie hats verdient."1
Wrobel erkannte die Situation: Wenn ein Militarist und Monarchist zum Staatspräsidenten einer demokratischen Republik gewählt wird, dann ist deren Ende vorbestimmt.
Er verteidigte zunächst die Kommunisten, die bei dieser Wahl das Zünglein an der Waage gebildet hatten und den Ausschlag dafür gaben, daß Hindenburg Gewinner dieser Wahl wurde.
"Sie wollten eben nur demonstrieren, sie haben demonstriert, und das kam dem alten Mann zu gute. Was hätten sie von Marx auch erwarten sollen? Mehr als zum Tode verurteilen [...] kann selbst Herr Hindenburg sie nicht."1
Er klagte die Linken an (hier waren offenbar die Sozialdemokraten gemeint - Anm. der Verfasserin), die durch ihre chaotische Kandidatenaufstellung im ersten Wahlgang letztendlich Hindenburg ermöglichten. Außerdem hätten sie sich im Gegensatz zum "Reichsblock" an den politischen Gegner nicht herangewagt. Sie hätten in Respekt zu Hindenburg aufgesehen, ihn angehimmelt, dann aber empfohlen, Marx zu wählen. Wrobel sah voraus, wie es weiterging:
"Der kaiserliche Statthalter ist in der denkbar schlimmsten Gesellschaft. Sie wird ihn beraten? Sie wird regieren. Und er wird tun, was er sein ganzes Leben getan hat: er wird unterschreiben.
Er wird unterschreiben: Die Reinigung der Verwaltung - soweit sie noch notwendig sein sollte. Die letzten republikanischen Richter werden bald ausge- haucht haben. Die Schule wird völlig in Nationalismus verkommen. Die Reichs- wehr gehorcht dem neuen Mann blind. [...] Kritik am kaiserlichen Feldmarschall wird auf Grund des Gesetzes zum Schutz der Republik bestraft werden, und für den Rest und den neuen Anfang hätten wir den Artikel 48 der Reichsverfassung, die der Tirpitz-Kandidat beschwören wird. Wie seinen Soldateneid."2
Wrobel sprach nun die rund siebzehn Millionen Wähler an, die Hindenburg nicht gewählt hatten:
"Es gibt eine Anzahl Deutscher, die zu Hindenburg nicht in Verehrung aufblik- ken, die ihn ihm nicht die Idealgestalt unsrer Zeit sehen, die seine Qualitäten nicht schätzen, und die ablehnen, mit diesem Mann in irgendeiner Form identifi- ziert zu werden. Wir lehnen ihn ab - auch dem Ausland gegenüber."3
Auch hier erschien wieder seine Aufforderung zum europäischen Denken:
"Diese lächerliche [sic.] Rücksichten, 'man dürfe sich nach außen hin nicht kompromittieren', haben hier aufzuhören. Wenn es unter den Demokraten, den Sozialisten und selbst unter den Pazifisten noch Leute gibt, die für ultraschlau halten, 'Taktik' mit den vollendet gut informierten Franzosen und Engländern zu treiben, so muß ihnen gezeigt und gesagt werden, daß sie ultradumm sind. Wir pfeifen auf ihr Nationalgefühl Anständigkeit."4
Für Frankreich befürchtete Wrobel, daß die Wahl Hindenburgs dem "Radikal- sozialisten" Herriot angelastet würde, welcher bis zum April Ministerpräsident war. Außerdem könne sich durch den nun wahrscheinlich stärker werdenden Einfluß der Rechten, die Zusammensetzung des Kabinetts Briand verändern, und dadurch dessen Friedenspolitik gefährdet sein.
Am Ende des Artikels forderte Wrobel abermals, den Nationalismus in Deutschland endlich abzulehnen:
"[...] solang sie nicht mutig und scharf ohne jede Rücksicht auf Situation, Presti- ge, Ausland, Presse und Gegenpartei den verruchtesten und seelenlosesten Nationalismus abgelehnt haben: so lange ist an keine Heilung zu denken. Was nun -? Nun eine bittere, schreckliche, blutige Lehre. Die tausendfach verdient ist."1
Ende des Jahres 1925 erschien der Artikel "Abreißkalender". Wrobel stellte hier einen Kalender vor, welcher vom Verlag Carl Hoym bzw. der KPD herausgegeben wurde. Unter Zuhilfenahme der "Tendenzphotographie" - einer Photographie mit "kurzer schlagender" Unterschrift - wurden Situatio- nen satirisch beleuchtet. Wrobel sah diese Art der Photographie schon länger als eine "gefährliche Waffe im politischen Kampf". Sein "Deutschland- buch", das 1929 erscheinen sollte, benutzte ebenfalls diese Art der Darstel- lung.
Mit der überaus positiven Beschreibung dieses Kalenders, seiner Bilder und Texte deutete Wrobel seine damalige politische Meinung an. Dem kämpferischen Geist der KPD und ihrer proletarischen Anhänger galt seine Hoffnung, wenngleich er von ihren Führern nicht allzu viel hielt.
Einzelne Kalenderblätter, die Wrobel beschrieb, dienten ihm zum histori- schen Rückblick. So weckte ein Photo von der Leiche Karl Liebknechts seine Erinnerungen an "die Straßengespräche der Bürgerlichen" und an die "Komödie von Gerichtsverhandlung".
Den Hohn und Spott, dem Friedrich Ebert im Kalender ausgesetzt wurde, nutzte nun auch Wrobel, um seine Wut und Empörung gegen den ersten Präsidenten der Republik und seiner SPD Ausdruck zu verleihen:
"Der Mann wird in diesem Kalender als Verräter an seiner Klasse gezeichnet - und hier wird vielleicht der Republikaner stocken. Er sollte das nicht tun. Die persönliche Rechtlichkeit des ersten Präsidenten steht hier nicht zur Diskussion - sie ist kein Verdienst, sondern eine Selbstverständlichkeit. Wenn aber heute allen Ernstes versucht wird, diesen mittelbegabten Funktionär, der seine eigne Stunde, aber niemals die des Reiches begriff, neben Bismarck zu stellen - so muß man doch wohl den übereifrigen Demokraten, die dergleichen aus tiefer Brust herausrollen, raten, sich Bäffchen umzubinden, damit sie sich nicht bepredigen."2 Wrobel begründet, warum der Vorwurf des Verrates an seiner Klasse berech- tigt ist:
"Aber vom Mittag des 9. November an Angst vor dem Bolschewismus haben; Auswüchse einer Revolution verhindern wollen, die überhaupt noch nicht da war; nach rechts und immer nur nach rechts sehen; mit Hilfe der übelsten Erscheinungen des Militärs eine Heeresmacht wiederaufrichten, die die Pest dieses Landes gewesen ist: das ist Verrat an der Arbeiterklasse und an der Idee der Revolution. Und Fritz Ebert durfte das nicht, er hatte nicht das Recht, so zu handeln, denn er war ein Beauftragter, ein vom Volk Beauftragter. Vielleicht war das seine persönliche Politik... Es waren aber die Arbeiter, die ihn zum Vorsitzenden gemacht hatten, die Arbeiter, die ihre Knochen im Krieg zu Markte getragen hatten, während er in Stabsquartieren den artigen Sozialde- mokraten machte, die Arbeiter, die reinen Tisch haben wollten. Diesen Willen hat er verfälscht, aufgefangen und abgeleitet. Er ist schuldig."1
Wrobel beschuldigte Ebert und seine Genossen, "die anständige Opposition" in den Reihen der SPD stets unterdrückt zu haben und dadurch schuldig geworden zu sein an "den Arbeitermorden", an "diesem Richtertum" und an der "feigen Personalpolitik".
Diese Anschuldigungen bewirkten einen Diskussionsprozeß, der in den folgenden Ausgaben der "Weltbühne" ausgetragen wurde. So schrieb Robert Breuer in der Ausgabe 52 einen Leitartikel "Die Revolution des Vierten Standes". Dort verglich er die Kritik Wrobels mit ähnlicher Kritik kurze Zeit nach der Französischen Revolution. Breuer vertrat die Meinung, daß ein Sieg des Proletariats nur von kurzer Dauer gewesen wäre, da dieses nicht in der Lage war, Produktion und Wirtschaft zu führen.
Am 12. Januar erschien Wrobels "Antwort auf die Antwort". Unter dem Titel "Die Ebert-Legende" bekräftigte er nochmals seine Vorwürfe gegen den "Verräter Ebert" und zeigte dem ehemaligen Pressechef Eberts, Robert Breuer, die Unhaltbarkeit eines Vergleichs der Jahre 1789 und 1918 auf. Wrobel war der Meinung, daß das Land am 9. November 1918 "weder reif noch präpariert" für die völlige Umgestaltung der Wirtschaftsform war, jedoch habe Ebert den demokratischen Erneuerungswillen des Volkes verhindert. Die Reformen seien von Ebert im Keim bekämpft worden, und somit habe er der Reaktion zum Sieg verholfen. Von dieser Schuld könne Ebert niemand reinwaschen, so Wrobel.
Zwei Wochen später erschien unter dem Titel "Mildernde Umstände für Ebert" ein weiterer Diskussionsbeitrag. Hellmut v. Gerlach (er war 1918/19 Staatssekretär im preußischen Innenministerium) übernahm Eberts Verteidi- gung. Im Gegensatz zu den Anschuldigungen des "Staatsanwaltes Wrobel", versuchte er aufzuzeigen, warum Ebert in bestimmten Situationen so handelte bzw. so handeln mußte. So hätte er z.B. auch nicht den Mut gehabt, die reaktionären Verwaltungsbeamten kurzfristig durch republikanische
Neulinge zu ersetzen. Zu diesem Zeitpunkt hätte es überhaupt keine eingear- beiteten Verwaltungsbeamten mit "Linksgesinnung" gegeben und somit hätte die Gefahr bestanden, die "Maschine" am Weiterlaufen zu hindern. Gerlach widersprach Wrobels Behauptung, die Verwaltung sei heute noch reaktionär.
Er war der Auffassung, daß von Jahr zu Jahr mehr demokratisch gesinnte Männer in die Verwaltung gekommen seien. Eberts Verdienst sei es gewesen, in einer schwierigen Zeit Nerven, Energie und Menschenverstand zu behalten und somit das drohende Chaos abgewehrt zu haben.
Da das weitere Eingehen auf diese Diskussionsbeiträge den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, möchte ich wieder auf den Ursprungsartikel zurück- kommen. Allerdings erschien es mir wichtig, diese Diskussion hier zu erwäh- nen. Zum einen kann man daran die Liberalität der Zeitschrift "Weltbühne" erkennen, welche es ermöglichte, verschiedene Ansätze und Meinungen zu einem Thema offen darzustellen und zu diskutieren. Zum anderen wird bei der Lektüre dieser Beiträge klar, daß genau diese Ansätze der Interpretation der Politik Eberts, heute noch in den Geschichtsbüchern zu finden sind. Dies macht abermals deutlich, daß die politische Richtung des Historikers wesent- lich an seiner Interpretation von Geschichte beteiligt ist.
Doch nun zurück zum Artikel.
Die nächsten Sätze machen Wrobels politischen Weg deutlich:
"'Reichsbanner! Zurück zur Klassenfront!' heißt eine eindrucksvolle Photogra- phie des Kalenders. Man sollte sich auch hier besinnen, und ich hoffe, daß man nachdenkt. [...]
Der Kalender aber ist ein Zeugnis und ein Dokument. Ein Zeugnis für eine Partei, die trotz der allerelendesten Führung eine immanente Kraft besitzen muß, größer als die Sturheit ihrer Bezirksfeldwebel. Ein Dokument unsrer Zeit - unsrer Kämpfe, dessen, was uns angeht."1
Auch der Schluß des Artikels zeigt auf, in welcher Partei er inzwischen seine Ansprüche am ehesten verwirklicht sah:
"Wer einen solchen Abreißkalender herausgeben kann, so frisch, so neu, so spritzig-jung, so kämpferischen Geistes und der Unbedenklichkeit voll - der zeigt, daß er lebt.
Wenn die KPD nun noch Führer hätte, dann könnte jeder Tag von den 365 ein Gedenktag fürs nächste Jahr werden."2
Bereits nach der Wahl Hindenburgs forderte Kurt Hiller in der Nr. 21 der "Weltbühne" eine Formierung einer "Deutschen Linken" auf der Basis marxistischen Gedankenguts.
"Anfang 1926 schaltete sich Tucholsky in diese Diskussion ein und erklärte, das von Hiller entworfene Programm wäre gut und richtig, es enthalte das notwen- dige Minimum an wirtschaftlichen und politischen Forderungen. Indem er nun der Verwirklichung marxistischer Theorien zustimmte, indem er fortan für die revolutionäre Verwirklichung einer sozialistischen Ordnung wirkte, vollzog sich ein einschneidender Wandel in der Zielsetzung seines publizistischen Schaffens."1
Die "Goldenen Zwanziger" werden heute als ein Zeitabschnitt der Stabilisierung der Weimarer Republik gesehen. Auch damals war man in bestimmten demokratischen Kreisen überzeugt, daß nun der republikanische Gedanke gesiegt hatte. Ignaz Wrobel erkannte aber gerade in diesen Stabilisierungstendenzen einen weiteren Etappensieg der Reaktion. Den Sieg des republikanischen Gedankens entlarvte er als "optische Täuschung".
Sein Artikel "Der Sieg des republikanischen Gedankens", der am 14.
September 1926 erschien, gibt diese Meinung wider. Dieser "Sieg" bedeute nicht, daß republikanische Ideen und politischer Kampf die Reaktion bezwun- gen hätte, sondern im Gegenteil, durch die ständige Anbiederung an die Reaktionäre, wäre letztendlich deren politische Gesinnung übernommen worden.
"Sie geben Tag für Tag eine Position nach der andern auf. Sie rücken den alten, verfaulten, verbrecherischen Idealen immer näher, bekennen sich zur absoluten Souveränität des Staates, zum Recht, Kriege zu führen, zur wirtschaftlichen Autokratie, zum Großdeutschtum, zum Autoritätsgedanken - nur sagen sies mit ein bißchen andern Worten. Und man fühlt gradezu, wie das die Gegner umwimmert, die ja tausendmal mehr gesunden politischen Instinkt haben; [...]
Und weil von Jahr zu Jahr immer mehr kluge Leute der deutschen Reaktion, des deutschen Imperialismus, des deutschen Militarismus begreifen lernen, daß die Brüder auf der andern Seite ja im Grunde gar nicht so gefährliche Löwen sind, sondern lauter Weber, Zettel geheißen, weil sie allmählich merken, daß man auf trocknem Wege viel weiter kommt als auf blutigen, daß man auch mit Diesen da 'arbeiten' kann - so arbeiten sie. Gut drei Viertel ist schon verarbeitet."2
Um die Anbiederung an die Reaktion zu belegen, beschrieb Wrobel folgendes Beispiel:
"Schon die Feigheit, am 9. November keine Feier zu wagen, zeigt, wes Ungei- stes Kinder hier ihr Spiel treiben. Alles, was gegen das Regime, das Deutsch- land in so unnennbares Unheil gerissen hat, sprechen könnte, ist sorgfältig ausradiert, und der zu nichts verpflichtende 11. August ist so recht ihr Wahrzei- chen. Eine Verfassung zu feiern, deren öffentliche Lektüre Lachsalven wecken müßte, von der - bis auf den § 48 - auch nicht ein Buchstabe jemals befolgt worden ist, die man getrost beschwören kann, weil sich das hübsch photogra- phiert - solche Verfassung an einem Tage zu feiern, der noch dazu in die Schul- ferien fällt: das ist ein schöner republikanischer Gedanke."3
Ein Konflikt, der für die Nation von Belang sein könnte, würde "diese Art Republikaner" sofort umknicken lassen und hier sah Wrobel die wirkliche Gefahr:
"Und es stehe hier zum Nachschlagen: Dieselben Phrasen, mit denen Deutsch- land 1914 in den Krieg getaumelt ist, werden dann zu lesen und zu hören sein; dieselbe Denkart wird Siege erträumen, wo nur Aktienkonsolidierung und menschliches Elend zu holen ist, Erweiterung der Beamtensphäre und Befriedi- gung von Kasteneitelkeit - dieselbe falsche Philosophie und wirtschaftliche Ignoranz wird Alle zu Etat-Bewilligern machen und noch die widerwärtigsten Militärverbrechen bejahen, weil die 'dienstlich notwendig' sind. Brave Kinder."1
Kurt Tucholsky befand sich wieder in Deutschland, er hatte nach Jacobsohns Tod die Leitung der "Weltbühne" übernommen. Im April erschien Wrobels dreiteilige Artikelserie "Deutsche Richter". Diese Serie war Ignaz Wrobels radikalste Kampfansage an die deutsche Justiz. Sein Urteil über diese Richter sollte treffen. In seiner Verallgemeinerung kamen die vielen negati- ven Erfahrungen zum Ausdruck, welche ihm in den letzten Jahren immer wieder Anlaß zur offenen Kritik gegeben hatten. Ihm war bewußt, daß es auch (wenige) Ausnahmen unter den Richtern gab, daher schrieb er:
"Kollektivurteile sind immer ungerecht, und sie sollen und dürfen ungerecht sein. Denn wir haben das absolute Recht, bei einer Gesellschaftskritik den niedersten Typus einer Gruppe als deren Vertreter anzusehen, Den, den die Gruppe grade noch duldet, den sie nicht ausstößt, den sie also im Gruppen- geist bejahend umfaßt."2
Im ersten Teil wurde die Unzulänglichkeit der deutschen Richter beschrieben, die ihren Nachwuchs selbst auswählen.
"Die Gruppe wählt sich hinzu, wer sich dem Gruppengeist anpaßt - immer adäquate, niemals heterogene Elemente."3
Dieser Gruppengeist spräche eine andere Sprache als das Volk. Der überwiegende Teil der Volkes hätte daher kein Vertrauen in diese Justiz.
Der zweite Teil befaßte sich mit den "Folgen dieses Kastengeistes". Ein Symptom "sei die Stellung des deutschen Richters zu jeder Autorität". In fast allen Strafprozessen würde der "Vorgesetzte" Recht bekommen. Ignaz Wrobel war sich bewußt, daß sich bei dieser Vorbildung und soziologi- schen Auswahl keine Besserung einstellen wird. Im Gegenteil. - Die folgen- den Sätze wurden dann auch einige Jahre später zur bitteren Wahrheit:
"Angemerkt mag sein, daß der heutige Typus noch Gold ist gegen jenen, der im Jahre 1940 Richter sein wird. Dieses verhetzte Kleinbürgertum, das heute auf den Universitäten randaliert, ist gefühlskälter und erbarmungsloser als selbst die vertrockneten alten Herren, die wir zu bekämpfen haben. Während in der alten Generation noch sehr oft ein Schuß Liberalismus, ein Schuß BordeauxGemütlichkeit anzutreffen ist, ein gewisser Humor, der doch wenigstens manchmal mit sich reden läßt, da lassen die kalten glasierten Fischaugen der Freikorpsstudenten aus den Nachkriegstagen erfreuliche Aspekte aufsteigen: wenn diese Jungen einmal ihre Talare anziehen, werden unsre Kinder etwas erleben. Ihr Mangel an Rechtsgefühl ist vollkommen."1
Im letzten Teil der Serie nannte Wrobel einige "kleinern Mitteln", wie man sich gegen diese Justiz schützen könne. Neben der öffentlichen Kontrolle durch die republikanische Presse und die Öffentlichkeit der Verfahren forderte er proletarische Organisationen auf, "vom Klüngel abgesprengte und gesinnungstüchtige Juristen" für ihre Zwecke dienstbar zu machen, und somit den Arbeitern Rechtsschutz zu gewähren.
Trotz allem glaubte Wrobel nicht mehr an die "Evolution im Strafrecht":
"Administrative Evolution ist ein Schlagwort für Ängstliche. Seine Erfolglosigkeit ist durch die Zahl eines Jahres bewiesen, in dem man nicht gewagt hat, diese Beamten, diese Richter auf die Straße zu setzten, [und hier bezieht er sich auf die Äußerungen von Hellmut v. Gerlach - Anm. der Verfasserin:] 'weil sie doch die Bestimmungen so schön kannten': 1918.
Es gibt, um eine Bureaukratie zu säubern, nur eines. Jenes eine Wort, das ich nicht hierhersetzen möchte, weil es für die Herrschenden seinen Schauer verlo- ren hat, weil es für uns andre eine Hoffnung ist. Dieses Wort bedeutet: Umwäl- zung. Generalreinigung. Aufräumung. Lüftung. [...] Die Schande dieser Justiz, - die Schande solchen Strafvollzuges: - nieder mit ihnen. Und das Gesetzbuch um die Ohren aller, die sich mit Erwägungen, mit Bedenken und mit wissen- schaftlichen Hemmungen dem wichtigsten Ziel entgegestellen, das einen anständigen Menschen anfeuern kann: Recht für die Rechtlosen."2
Jenes eine Wort hatte er allerdings am Ende der beiden anderen Artikel erwähnt. Im ersten Artikel schrieb er:
"...gibt es nur ein einziges Mittel: Die Zerschlagung dieser Justiz durch einen siegreich beendeten Klassenkampf."3
Im zweiten Artikel war dieser Aufruf noch schärfer formuliert:
"Gibt es keine Gegenwehr? Es gibt nur eine große, wirksame, ernste: Den antidemokratischen, hohnlachenden, für die Idee der Gerechtigkeit bewußt ungerechten Klassenkampf."4
Diese Formulierung zeigt deutlich, wie weit sein Haß gegen diese "demokratische Republik" bereits reichte.
Im Mai gab Kurt Tucholsky die Redaktion der "Weltbühne" an Carl von Ossietzky ab und fuhr nach Dänemark. Dort schrieb er vermutlich den satirischen Artikel "Dänische Felder" welcher am 26. Juli, einen Tag vor seiner Rückreise nach Paris, unter der Rubrik "Bemerkungen" erschien.
Auf diesen Artikel werden ich am Ende dieses Zeitabschnittes ausführlich eingehen.
Anfang 1928 erschien der Artikel "Briefe an einen Fuchsmajor". Durch Zufall hatte Ignaz Wrobel eine kleine Broschüre erworben:
"Briefe an einen Fuchsmajor" von einem Alten Herrn. Dieses Buch war "eine durchaus ernstgemeinte Anweisung, junge Füchse zu brauchbaren Burschen und damit zu Mitgliedern der herrschenden Kaste zu machen. Es ist wohl das Schlimmste, das gegen die deutschen Corps-Studenten geschrieben worden ist."1
Auf fünf Seiten stellte Wrobel zunächst diese Broschüre vor, indem er immer wieder einzelne Passagen daraus zitierte und anschließend kommentierte. Anschließend resümierte er:
"Und nun will ich euch einmal etwas sagen: Wenn man bedenkt, daß Zehntau- sende junger Leute so, sagen wir immerhin: denken wie das hier (und man sehe sich die Photographie an, die dem Buch voranprangt) - wenn man bedenkt, daß das unsre Richter von 1940, unsre Lehrer von 1940, unsre Verwaltungsbeamten, Polizeiräte, Studienräte, Diplomaten von 1940 sind, dann darf man wohl diesen Haufen von verhetzten, irregeleiteten, mäßig gebildeten, versoffnen und farbentragenden jungen Deutschen als das bezeichnen, was er ist: als einen Schandfleck der Nation, dessen er sich zu schämen hat bis in (sic.) dritte und vierte Glied."2
Wrobel beschrieb anschließend die Zustände an den deutschen Universitä- ten und stellte die Gesinnung und Geisteshaltung der Studenten dar.
Diese Gesinnung vor Augen prognostizierte er die Zukunft. Seine Voraussa- gen sind bissig und scharf formuliert. In ihnen schwingt die ganze Wut und Verachtung für diese "verhetzten Kinder" und dieses "neue Deutschland" mit. Auch hier sollte er mit seinen Prophezeiungen recht behalten. In den Univer- sitäten
"versteht man die Verfassung der nächsten Generation, die in brutaler, durch keine Rotweingemütlichkeit gemilderte Denkungsart die Lehren der Reaktion aufnimmt. Da ist das neue Deutschland; nämlich nicht jenes, das meditieren und Bücher schreiben darf, sondern jenes, das zu befehlen haben wird. [...] Denn das Schauerliche an dieser Geistesformung ist doch, daß sie den Deutschen bei seinen schlechtesten Eigenschaften packt, nicht bei seinen guten; daß sie das anständige, humane Deutschland niedertrampelt; daß sie sich an das Niedrige im Menschen wendet, also immer Erfolg haben wird; daß sie mit Schmalz arbeitet und einem Zwerchfell, das sich atembeklemmend hebt, wenn das Massengefühl geweckt ist. Und daß sie kopiert wird. Diese Studenten sind Vorbild für alle jungen Leute, die keinen sehnlichern Wunsch haben, als an möglichst universitätsähnlichen Gebilden zu studieren und es denen da gleich- zutun; mit hochgeröteten Köpfen den Corpsier zu markieren und einer im tiefsten Grunde feigen Roheit durch das Gruppenventil Luft zu schaffen. Der Abort als Vorbild der Nation."3
In der folgenden Aussage spürt man abermals seine Resignation:
"...sie haben mehr Lebenskraft. Kein Gegenzug hält sie in Schach. Keine deutsche Jugend steht auf und schüttelt diese ab. Keine Arbeiterschaft hat zurzeit die Möglichkeit, die Herren dahin zu befördern, wohin Rußland sie befördert hat."1
Mit seiner Aussage am Schluß des Artikels sollte er ebenfalls recht behalten:
"Deutschland ist im Aufstieg begriffen. Welches Deutschland? [...] Das Deutschland jener jungen Leute, die schon so früh 'alte Herren' sind und die für ihr Land einen Fluch darstellen, einen Albdruck und die Spirochäten ( = biegsa- me, sich aktiv bewegende schraubenförmige Bakterien - Anm. der Verfasserin) der deutschen Krankheit."2
Eineinhalb Jahre nach der Artikelserie "Deutsche Richter" erschien abermals eine dreiteilige Serie. Unter der Überschrift "Beamtenpest" beschäftigte sich Wrobel wiederum ausführlich mit einem Berufsstand, der wie das Militär und die Justiz immer wieder im Zeichen seiner Kritik stand. Auch hier setzte Wrobel zum Rundumschlag an. Er beschimpfte die deutschen Beamten als geltungssüchtig, obrigkeitshörig und reaktionär. Wie bereits bei der Richtern sah er auf friedlichem Wege keine Aussicht auf Veränderung :
"Solche aufgeblähten Beamtenkörper abzuschaffen, die überflüssig sind, unfruchtbar, unproduktiv und fast immer reaktionär, ist auf dem Wege der Evolution unmöglich. Jeder Reformversuch muß ja von einem von ihnen gemacht werden; jeder Reformversuch endet gewöhnlich damit, daß der Dreck, statt herausgekehrt zu werden, von einer Ecke in die andre umgelegt wird; jeder Reformversuch beläßt, wenn man es richtig ansieht, alles beim alten. Eine wirkliche Änderung? Dazu hat der liebe Gott die Revolution erfunden. Luftreini- gungen, die von Zeit zu Zeit erfolgen müssen, wenn nicht alles ersticken will. Dann gehts wieder für eine Weile."3
Beim nächsten Satz verteidigte er die Zustände in Rußland:
"Daß sich auch in Sowjet-Rußland eine neue Bureaukratie herausbildet, brauchen wir den Russen nicht zu erzählen, die es besser wissen als wir und die sich wenigstens bemühen, sie zu bekämpfen [...]."4
So wie hier nahm er auch in anderen Artikeln für die Sowjetunion Stellung. Auf der Basis der Russischen Revolution schwebte Wrobel eine Generalrei- nigung, eine radikale Umwälzung für Deutschland vor. Er bewunderte Lenin als Führerpersönlichkeit, kritisierte allerdings einen dogmatisierenden, moskauhörigen Leninismus, wie ihn die Führer der deutschen Kommunisten vertraten.
Ende des Jahres bot Ignaz Wrobel in seinem Artikel "Gebrauchslyrik" den Kommunisten die Zusammenarbeit an. Mit diesem Angebot wollte er eine Einheit zwischen Intellektuellen und Kommunisten bilden, um gemeinsam gegen die Zustände in Deutschland angehen zu können. Die Intellektuellen sollten die Rolle des Helfers und nicht die des politischen Führers überneh- men.
"Die proletarische Bewegung hat keine Zeit und keine Kraft, uns zu hätscheln. Wer ihr dienen will, der soll ihr dienen - aber so wenig er davon große Einkünfte erwarten kann und darf, so wenig hat er für sich eine Stellung zu beanspruchen, die ihn über den Proletarier erhebt, dessen Kamerad er doch grade sein will. Insbesondere halte ich den helfenden Intellektuellen dieser Gattung nicht für geeignet und legitimiert, den Arbeitern politischer Führer zu sein."1
Wrobel begründete diese Ansicht folgendermaßen:
"In einer Kampfbewegung kann man sich nur durch zwei Dinge als Führer legiti- mieren: durch politische Einsicht von überragendem Maß oder durch Opfer. Lenin hat beides getan. Wer aber nur besser schreiben kann als ein Proletarier; wer nur dessen Schmerzen so ausdrücken kann, daß jener sie nun doppelt und dreifach als aktivistisches Stimulans fühlt; wer ein Mann der Formulierung und weniger der Tat ist, der biete seine Hilfe an, tue sein Werk und schweige. Führer sollen andere sein."2
Allerdings war ihm offenbar bewußt, daß viele Kommunisten diese Hilfe ablehnen würden. So behauptete er, daß die SPD, solange sie mit Intellektuellen zusammengearbeitet habe, gut gefahren sei. Erst als sie diese zurückgestoßen habe, wäre sie auf der ganzen Linie "verstumpft". Wrobel appellierte an die KPD:
"Sieht die KPD, die heute die Rolle der SPD in Deutschland spielt, nicht, was für Folgen die Verkafferung der 'Sozialverräter' gezeigt hat? Beabsichtigt die KPD, denselben Weg zu gehen? Soweit ich informiert bin, will keiner aus unserm Kreise einen Führerposten in der Partei haben, und wer ihn haben will, ist auf dem Holzwege. Aber helfen wollen wir - wobei denn die Befolgung der notwendigen Parteidisziplin zu fordern und auch zu bekommen ist. So aber stehen wir tatenlos herum; selber eine Partei zu gründen, scheint mir ein Fehler, denn aus Brennholz kann man keinen Ofen bauen, unsere Kraft verrinnt in sehr vielen Fällen ungenutzt."3
Am Ende beschrieb Wrobel die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit. Hier stellte er abermals klar, daß er gegen eine dogmatische Kopie des Sowjetrussischen Kommunismus war.
"Ich halte einen Zusammenschluß der radikalen Intellektuellen mit der KPD für einen Segen und für ein Glück. Dazu gehört: auf unserer Seite der Sinn für Disziplin, für das stetige Arbeiten im Alltag und für politisch gesunde Vernunft; dazu gehören auf der Parteiseite guter Wille, Einsicht in die Struktur dieses Landes, das nun einmal nicht Rußland heißt, und die Entfernung von Funktionären, die den Bodensatz dessen darstellen, was wir sind."4
Hans Prescher schildert, daß gerade dieser Artikel von seiten der Kommuni- sten mit scharfer Kritik beantwortet wurde. So kritisierte Hans Conrad in "Die Front" die "Halbheit der linken Intellektuellen" und forderte diese auf, sich in die KPD unter dem Programm Lenins einzureihen.
Wrobel hatte allerdings eine andere Vorstellung vom Sozialismus. Er befür- wortete keinen moskauhörigen Leninismus, sondern sah die KPD als politi- sches Instrument, um die bestehenden Zustände in Deutschland zu ändern und einen Ausweg aus Krieg und Faschismus zu weisen. So schwand auch allmählich diese, seine letzte Hoffnung auf die deutsche Arbeiterschaft.
"Dreimal hatte er seinem Schaffen eine Zielsetzung gegeben, dreimal hatte er angesetzt, um einen Wandel in Deutschland herbeizuführen. Auf der jeweils nächsten Stufe hatte er dabei das verurteilt, worauf er sich vorher gestützt hatte. Zuerst sollte das Volk in einer geistigen Revolution die Demokratie verwirklichen, was nicht geschah; dann sollten Parlament und Regierung ihre Macht rücksichtslos gegen eben dieses Volk ausüben, um die Republik zu stabilisieren und zu schützen, was auch nicht geschah; darauf sollte die Arbei- terschaft eben diese Regierung und dieses Parlament verjagen und eine neue Ordnung schaffen, was ebenfalls nicht geschah."1
Im ersten Halbjahr 1929 schrieb Ignaz Wrobel nur zwölf Artikel in der
"Weltbühne", sechs davon unter der Rubrik Bemerkungen. Wie bereits im Jahre 1924 drückte diese geringe Anzahl an Artikeln eine Krise aus. Seine Frau hatte ihn verlassen und er klagte über allerlei Krankheiten. Im April reiste er nach Schweden. Im August erschien sein Buch "Deutschland, Deutschland über alles".
6.3 Dänische Felder - eine Interpretation
Im ersten Absatz wird die idyllische Natur beschrieben. Unter Zuhilfenahme lyrischer Element mit synästhetischem Charakter (sonnenüberglänzter Wind, pflaumenblaue Wälder) beschreibt Wrobel dieses Idyll. Die Natur ist etwas Beständiges. Sie drückt Ruhe und Frieden aus.
"Die Chaussee [...] führt also scheinbar in den Himmel. Zwei solcher Treppen gibt es in Versailles..."
Tatsächlich gibt es in den Parkanlagen hinter dem Schloß zu Versailles zwei solcher Treppen.
"Links und rechts folgen Treppenanlagen dem abschüssigen Gelände, das nach einigen hundert Metern wieder ansteigt, auch die Treppen folgen wiederum und geraten nach Überschreitung des höchsten Punktes außer Sicht, enden irgendwo im Himmel."1
Ludwig XIV ließ 1661-89 das Jagdschloß seines Vaters zum Palast er-wei- tern. Die Parkanlage wurde von André Le Nôtre gestaltet, einem französi- schen Gartenarchitekten. Dieser gestaltete die beiden Treppen so, daß man den Eindruck hat, sie würden in den Himmel führen. Da die gesamte Schloß- anlage der Verherrlichung des Monarchen als Sonnenkönig diente, liegt die Vermutung nahe, daß die beiden Treppen seine Verbindung zur Sonne darstellen sollten. Mit Ludwig dem XIV (1661-1715) erreichte der französi- sche Absolutismus eine Gipfelstellung. Die grenzenlose Selbstüberschätzung seiner Person ließ ihn immer größere Ansprüche stellen. Durch diese Expan- sionspolitik schlug die Sympathie der meisten europäischen Mächte für Frankreich in Ablehnung um. Im spanischen Erbfolgekrieg hatte Ludwig der XIV eine "Große Allianz" - den Kaiser, England und die Generalstaaten - gegen sich. Am Ende des Krieges war der französische Staat verschuldet und die Bevölkerung verarmt. Der Abstieg hatte begonnen.
Die Erwähnung der beiden Treppen von Versailles könnte eine Anspielung auf die zwiefache Rolle sein, die diese Stadt für die Geschichte des Zweiten Deutschen Reiches gespielt hat:
1.) Der Aufstieg des Reiches begann, als am 18. Januar 1871 König Wilhelm I von Preußen im Spiegelsaal des Schlosses zu Versailles zum Deutschen Kaiser ausgerufen wurde. Der gewonnene Krieg gegen Frankreich wurde am 26. Februar 1871 durch den "Vorfrieden von Versailles" beendet.
2.) Für den Abstieg waren die Verhandlungen der Friedenskonferenz - unter Ausschluß der Deutschen - im Januar 1919 von entscheidender Bedeutung. Die Konferenz wurde am 18. Januar, dem Jahrestag der Bismarckschen Reichsgründung, ebenfalls im Spiegelsaal des Schlosses eröffnet. Der verlorene Krieg wurde am 28. Juni 1919 offiziell mit der Unterzeichnung des Friedensvertrages in Versailles durch Hermann Müller und Johannes Bell beendet.
"Egal aber, ob Aufstieg oder Abstieg des Reiches, die Versailler Treppen 'führen (jeweils) scheinbar in den Himmel', d.h. im ersten Fall Reichsgründung als euphorischer Triumph des deutschen Patriotismus, im zweiten Fall Beendi- gung des schlimmsten Krieges der Menschheit, Menschheitszuversicht auf 'Nie wieder Krieg' [...]. Beide Treppen waren aber trügerisch, siehe 'scheinbar'."1
"So hat doch diese dänische Landschaft auch im Jahre 1917 hier gestanden? Natürlich - warum denn nicht? Die da führte keinen Krieg."
Mit diesen beiden geschickt kombinierten rhetorischen Fragen wird der Leser zum Nachdenken angeregt. Außerdem wird die Darstellung durch ein solches rhetorisches Stilmittel lebendiger.
Das Modaladverb "natürlich" verstärkt nochmals den Bezug zur Natur. Für den Verfasser ist der Krieg widernatürlich. Dies zeigt sich auch im folgenden Satz: "Die Bäume durften Bäume sein - niemand schoß sie zusammen." Der Baum ist Sinnbild des Lebens. Er steht symbolisch für Natur, Kraft und Beständigkeit, seine Zweige spenden Schatten und schützen vor Regen. Im Schutz seiner Äste wird neues Leben geboren. Er dient als Brutstätte für Vögel, ist Nahrungsquelle für Insekten und spendet allen Lebewesen den zum Überleben notwendigen Sauerstoff.
Durch den zweiten Teil des Satzes, "- niemand schoß sie zusammen", erfolgt eine Assoziation zum Menschen. Jetzt steht der Baum für den Menschen. Dadurch, daß der Mensch das Sinnbild des Lebens zerstört, zerstört er letzt- endlich sich selbst. Mit der zerstörten Natur weist Wrobel auf die "gestörte" Gesellschaft hin.
Diese Aussage wird durch die nächsten beiden Sätze nochmals verdeutlicht. Durch die Wahl der Adjektive "stampfen", "rattern", "schimpfen" und "poltern" wird vom Verfasser eine laute bedrohliche Stimmung erzeugt. Die Verben "aufgeweicht" und "verdorben" stehen für das Resultat der Zerstörung. Aber nicht nur die Wege werden durch den Krieg "aufgeweicht" und "verdorben", sondern auch die Menschen. So schrieb Wrobel beispielsweise in der Artikelserie "Militaria" von Frauen, die der Krieg "verdorben" hatte.
"Die lange Schlange der Marschierenden." "Die Schlange" ist Symbol des Bösen. In der christlichen Religion tritt der Teufel in Gestalt einer Schlange auf. "Im Sündenfall" wurden Adam und Eva von der Schlange verführt, von den Früchten des verbotenen Baumes zu essen. Adam und Eva bezahlten ihr Vergehen mit der Vertreibung aus dem Garten Eden - dem Paradies. Wrobels Textbeginn klingt so, als ob er das Paradies auf Erden beschreiben wollte. "Diese Landschaft war reklamiert." Sie war von der göttlichen Natur zurückgefordert worden.
Der nächste Satz kann ebenfalls mit der christlichen Religion in Verbindung gebracht werden. Wie im Artikel "Macchiavelli" von 1918 stellt Wrobel abermals den Widerspruch zwischen der christlichen Lehre und den Aussa- gen der "Feldprediger" dar: "Hergott in Dänemark [...] Hier war Mord: Mord," - ganz im Sinne des fünften Gebotes durfte man hier nicht töten. Auf der anderen Seite in Deutschland war Mord im Krieg ein "von den Schmöcken (gesinnungslose Journalisten - Anm. der Verfasserin), den Generälen und den Feldpredigern besungenes Pflichtereignis." Hier mußte man töten. Durch die Gegenüberstellung der Dänischen Felder und der Schlachtfelder zeigt Wrobel den Widerspruch auf. Mord kann nicht im Einklang mit christli- chen und ethischen Grundsätzen stehen und muß als das Werk "des Bösen" betrachtet werden.
Ignaz Wrobel deckt hier den Mißstand auf, dazu nutzt er abermals den Widerspruch als konstitutives Element der Satire.
Nach dem vierten Absatz beginnt der zweite Teil des Textes.
Im Mittelpunkt steht die Republik und ihr Bürgertum, für das Wrobel inzwischen nur noch Verachtung empfand. Er hatte die Hoffnung auf eine Änderung dieser Menschen aufgegeben.
"Und so selbstverständlich, wie die Mücken tanzen, so selbstverständlich ist den Mördern und ihren Kindern Untat, Fortsetzung der Untat und Propagierung der Untat."
Mit dem Vergleich der Mörder - gemeint ist wahrscheinlich das Bürgertum und die Soldaten - mit tanzenden Mücken, drückt er deren Einstellung aus. Mücken tanzen aus reiner Lebenslust, sie denken nicht nach. Die Weimarer Republik hatte auf dem Gebiet der Sexualmoral einiges verän- dert, auch auf geistigem Gebiet geschah sehr viel. Jedoch stand der "Geist" links und konnte sich gegen die reaktionären und kriegstreibenden Kräfte nicht durchsetzen.
Mit der Gegenüberstellung von Erotik und Krieg könnte sich Wrobel auf Freud beziehen, mit dem er (Tucholsky) sich intensiv beschäftigt hatte. Der späte Freud unterschied zwei Triebe im Menschen, den Sexualtrieb (Eros) und den Aggressionstrieb bzw. Todestrieb (Thanatos). Während der Sexualtrieb in der Weimarer Gesellschaft ausgiebig diskutiert wurde und dadurch u.a. neue sexuelle Freiheiten entstanden, hatte das Wissen über den Aggressionstrieb wenig verändert. So wurde eine Auswirkung dieses Triebes, der Krieg, weiterhin verherrlicht. Es blieb der Nationalstolz, der nach Rache "lechzte", um die Schmach von Versailles zu vergelten. Wrobel schreibt: "Es geschieht so wenig gegen den nächsten Krieg..." und nicht "Es geschieht so wenig zur Verhinderung des Kriegs..."; Dadurch verleiht er seiner Überzeugung Ausdruck, daß dieser Krieg kommen würde. Wie bereits im Artikel "Der Fall Nathusius", der schon am 18.11.1924 erschienen war, "wünschte" er, daß dieser Krieg in Deutschland ausgetragen würde.
Bereits damals schrieb er:
"Dieser neue wird die 'Zivilbevölkerung' eines Besseren und Tödlicheren belehren. Man wird die Städte vergasen, und Schützengräben und Schlachtfeld wird Haus, Keller und Bodenluke sein. Ich wünschte, es würde so."1
Jetzt klingt die Äußerung noch provokanter:
"..bei dem euch die Gedärme, so zu hoffen steht, auch in den Städten über die Stuhllehne hängen werden."
Diese sarkastische Darstellung klingt wie ein Aufschrei, Wrobel versucht nun auf diese Art, die Menschen aufzurütteln.
Anstatt der kriegsverherrlichenden Heldenfilme "müßte jeden Abend in den Films laufen, wie es gewesen ist, das mit dem Sterben." Es ist allerdings fraglich, ob solche Filme tatsächlich den von Wrobel erwünschten Effekt haben. Die Verfilmung des 1929 erschienen Buches, "Im Westen nichts Neues" von Erich Maria Remarque konnte trotz seines sensationellen Erfol- ges den Krieg und Nationalwahn nicht verhindern. Heutzutage weiß man, daß gerade die ständige "Berieselung" mit "schrecklichen" Filmen und Nach- richtensendungen eher Aggressivität hervorruft als diese verhindert.
Wrobels sarkastischen Äußerungen steigern sich nochmals, voller Haß spricht er Verwünschungen aus.
Genauso wie die Bürger die idyllische Natur zerstörten, soll nun deren privates Idyll zerstört werden; die Spielstuben der Kinder. Die herausgeputzten Kinder - die Püppchen - sollen umsinken. Wrobels Verwünschungen richten sich an die Frauen, die diese Kinder geboren hatten. Diese Aussage erinnert an seinen Artikel "Vor Verdun" vom 28.07.24. Dort schrieb er:
"Denn das Entartetste auf der Welt ist eine Mutter, die darauf noch stolz ist, das, was ihr Schoß einmal geboren, im Schlamm und Kot umsinken zu sehen."1
Auch jetzt geht sein Vorwurf an die Frauen, die ihren Ehemann, ihren Sohn und ihren Bruder in der Verherrlichung des Krieges unterstützen, anstatt - wie es natürlich wäre - Leben zu schützen und zu verteidigen. Durch die Personifizierung mit bestimmten Berufsgruppen zeigt der Autor nochmals auf die Menschen, denen er besondere Schuld am bevorstehenden Krieg vorwirft. Es sind die Vertreter der Kirche, die die Waffen segnen, die Chefre- dakteure, die in ihren Blättern den Krieg verherrlichen, die Bildhauer, die Heldendenkmäler schaffen und die Bankiers, die den Krieg finanzieren. Den Frauen wünscht er "einen bittern qualvollen Tod", weil sie die Verherrlichung des Krieges befürworten, ohne die Konsequenzen zu überlegen. Sie sind faul, weil sie einerseits nicht nachdenken wollen, andererseits könnte das Adjektiv "faul" auch für "verdorben" stehen. Beim Lesen des nächsten Satzes, erscheint vor dem inneren Auge das Bild vom "dummen Affen", der nicht hört, nicht sieht und nicht spricht. Wrobel ersetzt das Verb sprechen durch fühlen und verleiht ihm so eine besondere Bedeutung. Dadurch, daß die Frau als Gefühlsmensch die Gefahr nicht fühlt, unterdrückt sie ihre (angeblich besonders ausgeprägte) Fähigkeit und verhält sich widernatürlich. Am Schluß schlägt Wrobel den Bogen zum ersten Teil des Textes. "Wer aber sein Vaterland im Stich läßt in dieser Stunde, der sei gesegnet." Durch diesen Satz verleiht Wrobel seiner Meinung Ausdruck, daß Flucht bzw. "Fahnenflucht" bei Kriegsausbruch eine nach ethischen Grundsätzen richtige Handlung sei. Dadurch, daß sich dieser Mensch im Sinne des fünften Gebotes verhält, darf er die dänische Landschaft, welche als Metapher für das Paradies steht, genießen.
Im Artikel "Dänische Felder" sind wesentliche Elemente Tucholskys politi- scher Satire enthalten:
"..weil der Kampf gegen die Lebenden von Leidenschaften durchschüttelt ist, und weil die nahe Distanz das Auge trübt, und weil es überhaupt für den Kämpfer nicht darauf ankommt, Distanz zu halten, sondern zu kämpfen - deshalb ist der Satiriker ungerecht. Er kann nicht wägen - er muß schlagen. Und verallgemeinert und malt Fratzen an die Wand und sagt einem ganzen Stand die Sünden einzelner nach, weil sie typisch sind, und übertreibt und verkleinert -- Und trifft, wenn er ein Kerl ist, zutiefst und zuletzt doch das Wahre und ist der Gerechtesten einer. Jedes Ding hat zwei Seiten - der Satiriker sieht nur eine und will nur eine sehen. Er beschützt die Edlen mit Keulenschlägen und mit dem Pfeil, dem Bogen. Er ist der Landsknecht des Geistes. Seine Stellung ist Vorgeschrieben: er kann nicht anders, Gott helfe ihm. Amen."1
6.4 Trugen die linken Intellektuellen eine Mitschuld am Untergang der Republik?
Die spätere negative Kritik an Tucholsky, die ihn sogar der Mitschuld am Untergang er Weimarer Republik bezichtigte, behandelt überwiegend sein Werk aus diesem Zeitabschnitt. Daher sollen an dieser Stelle einige kritische Beiträge über Kurt Tucholsky und die linke Intellektuellenszene behandelt werden.
Kurt Sontheimer bemerkte dazu:
"Von ihren Ideen der Humanität, der sozialen Gerechtigkeit, der Brüderlichkeit, des Pazifismus her, vermochten die Linksintellektuellen jedoch die politische Wirklichkeit der Weimarer Republik in zunehmendem Maße nur noch als Degeneration und Abfall zu begreifen. Die Desillusionierung über die herrschenden politischen Verhältnisse trieb sie oft in einen inhumanen Sarkas- mus und Zynismus, der zu Ungerechtigkeiten verleitete und sie selbst in den Reihen der SPD in den Geruch von 'Asphaltliteraten' brachte."1
Wenn man aber weiß, daß die Warnungen Tucholskys und anderer linker Intellektueller über Jahre hinweg von den Regierenden insbesondere von der Sozialdemokratie ignoriert wurden, braucht man sich über den Sarkasmus und Zynismus der linken Intellektuellen nicht zu wundern. Nachdem sie bemerkt hatten, daß ihre Mitarbeit nicht erwünscht und ihre Vorschläge nicht gehört wurden, kämpften sie mit der spitzen Waffe der Satire und Polemik. Durch ihre punktuellen Angriffe und Übertreibungen wollten sie alle Mißstände aufdecken, die eine Gefahr für die demokratische Republik darstellten. Davon durften selbstverständlich auch die Fehler der sozialdemo- kratischen Partei und ihrer Regierungsmitglieder nicht ausgeschlossen bleiben. Das Ziel der linken Intellektuellen im Umfeld der "Weltbühne" war es nach wie vor, eine Republik nach den Idealen der Menschlichkeit zu schaffen. Dafür suchten sie Verbündete. Nachdem sie diese bei den "großen" Politikern nicht fanden, setzten sie ihre Hoffnung auf das Volk. Sontheimer tut diesen Intellektuellen zutiefst unrecht, wenn er dazu neigt, den Linksintellektuellen eine Mitschuld am Untergang der Weimarer Republik zuzuweisen:
"Gehörten die Intellektuellen diesen Schlages nicht auch zu jenen, die durch ihre scharfe Polemik und Satire - sie richtete sich ja keineswegs nur gegen Nationalisten und Faschisten - die Republik unterhöhlt hatten? Schmähten sie nicht unablässig die Parteien, die im Rahmen der republikanischen Ordnung die kapitalistischen Interessen vertraten; gossen sie nicht unaufhörlich die ätzende Säure ihrer Kritik über eine im System gefangene Sozialdemokratie, von der sie behaupteten, daß sie die Seele verloren und nur ihr Körpergewicht bewahrt habe?"1
Hans Weigel geht sogar noch einen Schritt weiter. Seine Kritik geht direkt an die Adresse Kurt Tucholskys. Zunächst wirft er ihm die Flucht nach Paris als Flucht vor der Verantwortung vor und gibt ihm dadurch indirekt die Schuld am "Untergang" der Republik:
"Nach dem Ersten Weltkrieg war da doch immerhin eine Republik, waren brave Politiker der SP, anständige Politiker der katholischen Zentrumspartei, da waren die antinationalistischen Kräfte im 'Reichsbanner' zusammengeschlos- sen. Natürlich, ja, natürlich waren die Reaktionäre und Abenteurer und Putschi- sten aktiv - der Friedensvertrag von Versailles hat viel zu ihrer Ermunterung beigetragen. 'Der Kaiser ging, die Generale blieben.' Und wer blieb nicht? Walter Mehring und Kurt Tucholsky, die prädestinierten Protestsänger der Weimarer Republik, gingen nach Paris. Die Generale blieben."2
Wenn man die politischen Texte von Tucholsky kennt und sich mit seiner Biographie beschäftigt hat, dann erkennt man, daß Hans Weigels Vorwurf absolut haltlos ist.
Es kann zwar noch akzeptiert werden, wenn Weigel alle demokratischen Politiker als "brav", "anständig" und "antinationalistisch" bezeichnet, viele Historiker verfahren genauso - es kommt eben auf die politische Richtung an. Jedoch erkennt man durch Weigels Wortwahl seinen manipulativen Charak- ter. Diese Wortwahl vermittelt den Eindruck, die Reaktionäre wären in Wirklichkeit halb so schlimm gewesen. Dies gelingt ihm durch die Verdopp- lung des Modaladverbs "natürlich". Durch seine rhetorische Frage, "Und wer blieb nicht?"; sichert er sich die Aufmerksamkeit des Lesers und gibt ihm die Antwort: "Walter Mehring und Kurt Tucholsky [...]". Durch diese Art und Weise werden Walter Mehring und Kurt Tucholsky indirekt für das Scheitern der Weimarer Republik verantwortlich gemacht: "Sie gingen und die Generale blieben".
Tucholsky benötigte aber diesen Aufenthalt in Frankreich, um überhaupt wieder schreiben zu können. Es war keine Flucht vor der Verantwortung, sondern im Gegenteil, nur so konnte er wieder kämpfen und tat dies auch, schärfer als jemals zuvor. Und komischerweise gerade das wirft Weigel Tucholsky im nächsten Abschnitt vor, als er ihn beschuldigt, "durch falsche Perspektive" am Untergang mitgewirkt zu haben.
Anhand des Buches "Deutschland über alles" versucht Weigel die Mitschuld Tucholskys am Untergang der Republik nachzuweisen.
"Da wird in der republikanischen Ära ein Deutschlandbild entworfen, als ob damals schon Papen an der Macht und Hitler ante portas gewesen wäre, da wird nicht um Deutschland, sondern gegen Deutschland gekämpft und dadurch einer Entwicklung Vorschub geleistet, die Deutschland so werden ließ, wie es vorwegnehmend abgebildet wurde."1
Vor dem Hintergrund der Beschäftigung mit Tucholskys Leben und Werk wird dieser Vorwurf zur Farce. Hans Weigel manipuliert mit sprachlichen Mitteln, um seine Meinung darzustellen. Historische Ereignisse und biographische Zusammenhänge werden bewußt vernachlässigt oder verdreht, gerade so wie es ihm "in den Kram paßt". Ich möchte an dieser Stelle nicht die von Weigel geäußerten Aussagen im einzelnen widerlegen, sondern denke, daß diese Arbeit durch die Darstellung der biographischen und historischen Hintergründe die "Unsachlichkeit" seiner Aussagen aufzeigen kann.
7 1930-1932: Die letzte Phase
7.1 Geschichtlicher Rückblick
Angesichts der Wirtschaftskrise kam es über die Frage der Beitragserhöhung der Arbeitslosenversicherung zu einem Streit zwischen SPD und DVP. Unter dem Druck der Gewerkschaftsverbände einerseits und der Unternehmerverbände andererseits, war kein Kompromiß zu erzielen. Aus diesem Grund brach die Koalition des letzten sozialdemokratischen Regierungschefs, Hermann Müller, am 27. März 1930 auseinander.
"Nur Stunden später ließ Hindenburg Brüning zu sich rufen, der anderntags nach Rücksprache mit der Zentrumsfraktion den Reichspräsidenten ersuchte, 'ein nicht an die Parteien gebundenes Kabinett' zu bilden, und dafür die Vollmachten des Artikels 48 in Anspruch nahm. Hindenburg stimmte erleichtert zu. Endlich hatte er die Persönlichkeit gefunden, der er zutraute, unter Ausschluß der SPD zu regieren, die Parteien der nationalen Opposition wieder zu 'staatspolitischer' Verantwortung zurückzuführen und ihn nicht länger als Anwalt der Interessen der Linken erscheinen zu lassen."1
Hinter dieser Persönlichkeit
"verbarg sich ein hochsensibler und empfindlicher Charakter, für den eine betont romantisierende Sicht des Kriegserlebnisses der jungen Generation, der er sich zurechnete, und eine sein Verhältnis zu Hindenburg bestimmende kritik- lose Hochschätzung der preußischen Militärtradition prägend waren."2
Am 1. April wurde der Zentrumspolitiker und ehemalige Hauptmann Dr. Heinrich Brüning Reichskanzler. Mit seinem "Kabinett der Frontsoldaten" trat er, so wie Hindenburg es wünschte, für eine Stärkung der "nationalen Rechten" unter Ausschluß der SPD und der Gewerkschaften ein. Schon am 16. Juli trat die erste Notverordnung des Reichspräsidenten: "Zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen" in Kraft. Am 18. Juli wurde der Reichstag aufgelöst und Neuwahlen auf den 14. September 1930 festgesetzt.
Die Wirtschaftskrise verschärfte sich, inzwischen gab es über drei Millionen Erwerbslose, die Löhne und Sozialleistungen sanken. Die Theorien und Lösungsvorschläge radikaler Parteien fanden im Wahlkampf starken Zuspruch. Das Wahlergebnis übertraf dann auch alle Erwartungen. Die SPD verlor 5,3% der Stimmen, sie kam auf 24,5%. Die Kommunisten erhöhten ihren Stimmenanteil um 2,5%, sie kamen auf 13,1%. Die bürgerlichen Parteien verzeichneten geringfügige Einbußen. Die beiden großen bürgerli- chen Rechtsparteien verloren rund die Hälfte ihrer Wähler. Der Anteil der DVP lag nun bei 4,5% und der der Deutschnationalen bei 7%. Eine bis dahin verhältnismäßig unbedeutende Partei, Hitlers NSDAP, konnte ihr Wahlergeb- nis auf Kosten der bürgerlichen Rechtsparteien und zahlreicher Interessen- und Regionalparteien auf 18,3% der Stimmen ausbauen, 1927 hatte sie nur 2,6% der Stimmen erhalten. Sie war nun zweitstärkste Partei.
Dieses Ergebnis kündigte "das Ende bürgerlicher Honoratiorenpolitik an, und war von einem Protest der Provinz gegen die großstädtischen Zentren begleitet."1
So zogen dann am Tage der Reichstagseröffnung, dem 13. Oktober 1930, 107 Abgeordnete der NSDAP in den Plenarsaal ein und lieferten eine kleine Kostprobe dessen, was sich Deutschland von ihrer "Machtergreifung" erwar- ten durfte:
"Mit dem Ruf 'Deutschland erwache, Juda verrecke!' zogen die 107 Abgeordne- ten der Hitler-Partei in den Plenarsaal ein und entledigten sich ihrer Jacketts, so daß die darunter getragenen - von der preußischen Regierung verbotenen - braunen Uniformhemden, Koppel und Schulterriemen sichtbar wurden."2
Brünings Innenpolitik war gescheitert. Da das Ergebnis dieser Wahl keine Koalitionsmöglichkeit nach seinen Wünschen bot, blieb ihm, um regieren zu können, nur die Möglichkeit, weiterhin mit der stillen Duldung der SPD und mit der Unterstützung des Reichspräsidenten seine Minderheitsregierung fortzusetzen. Brüning war allerdings von vornherein entschlossen, das parla- mentarische System im autoritären Sinn umzubilden. Dies gelang ihm durch die Ausnutzung der Möglichkeiten, welche ihm Hindenburg und der Artikel 48 boten. So stellte sich die parlamentarische Verfassung "nur mehr als kraft- lose Hülle dar, die dazu diente, den schrittweisen Übergang zur autoritären Regierung zu verschleiern."3
Brüning bediente sich nun einer Reihe von "Notverordnungen zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen". Diese Maßnahmen, darunter eine drastische Steuererhöhung, Senkung der Ausgaben für Arbeitslose und Kürzungen der Löhne und Gehälter, konnten den Gang der Entwicklung nicht mehr aufhal- ten. Im Dezember 1930 gab es schon über vier Millionen Arbeitslose. Während die SPD aus Angst vor dem Sturz des Kabinetts Brüning und seinen Ersatz durch eine rechte Militärdiktatur zuließ, daß die Notverordnun- gen nicht vom Reichstag aufgehoben wurden und somit alle sozialen Errun- genschaften Stück für Stück demontiert wurden, begann sich die gesamte Rechte zu formieren, um gemeinsam den Kampf gegen die Republik aufzu- nehmen. So trafen sich am 11. Oktober 1931 u.a. NSDAP, DNVP und der Stahlhelmbund in Bad Harzburg. Von dort gab Hugenberg den Zusammen- schluß aller vertretenen Gruppen zu einer "Nationalen Front" bekannt.
Die katastrophale wirtschaftliche Lage führte zur Verelendung weiter Bevölkerungskreise und zu einer allgemeinen politischen Radikalisierung. In Deutschland brachen verstärkt bürgerkriegsähnliche Verhältnisse aus. Vor allem die Jugendarbeitslosigkeit trug mit zum Ansteigen gesellschaftlicher Militanz insbesondere bei KPD und NSDAP bei.
"Die SA wurde zu einem Sammelbecken für überwiegend jugendliche Erwerbs- lose, die in den SA-Heimen und durch öffentliche Sammlungen, die die 'Winter- hilfe' vorwegnahmen, ein notdürftiges Auskommen erhielten. Die erwerbslosen Jugendlichen, die keinen Anschluß an das Berufsleben und somit an Gewerk- schaften, Berufsverbände und Arbeitervereine fanden, rekrutierten die sich zusehends herausbildenden Bürgerkriegsarmeen von links und vor allem von rechts."1
1932 stieg die Arbeitslosenziffer auf über sechs Millionen.
Der zweite Wahlgang der Reichspräsidentenwahlen am 10. April brachte Hindenburg einen triumphalen Wahlerfolg. Hindenburg, dessen Kandidatur von allen gemäßigten Parteien einschließlich der SPD unterstützt wurde, erlangte 53% der Stimmen. Hitler erhielt 36,8% der Stimmen und der Kandidat der KPD, Ernst Thälmann, 10,2%.
Brüning, der sich nach diesem Wahlergebnis ebenfalls bestätigt sah, legte nun dem Reichspräsidenten eine Notverordnung zur Unterschrift vor, die die Auflösung der Privatarmee Hitlers und ein Uniformverbot für alle politischen Organisationen vorsah. Am 14. April trat das SA- und SS-Verbot im ganzen Reich in Kraft.
Doch nun begann sich hinter den Kulissen, ein Netz der Intrige zu spinnen.
Federführend war General von Schleicher. Dieser verhandelte heimlich mit Goebbels, Helldorff, Röhm und Hitler. Sein Ziel war es, zunächst General Groener und dann Brüning zu stürzen. Nachdem Gröner, u.a. bedingt durch eine üble Pressekampagne, von seiten der Generalität das Vertrauen entzo- gen wurde, trat er zurück. Von Schleicher besuchte den sich im Pfingst-ur- laub befindenden Hindenburg auf seinem Schloß Neudeck. Dort machte er gegen Brünings Reichskommissar Schlange-Schöningen Front, der aus
sozialen und politischen Gründen einige hunderttausend Großstädter in Ost- und Westpreußen sowie in Hinterpommern ansiedeln wollte und die "Osthilfe"-Subventionen künftig vorrangig den Kleinbauern zukommen lassen wollte. General v. Schleichers Argumentation, die Enteignung des angestammten Grundbesitzes zugunsten arbeitsloser Proletarier sei nichts anderes als "Agrarbolschewismus", überzeugte Hindenburg. Am 30. Mai forderte der aus dem Urlaub zurückgekehrte Hindenburg Brüning auf, seinen Reichs- kommissar sofort zu entlassen und die Ostsiedlungs-Vorlage zurück- zuziehen. Brüning bot daraufhin den Rücktritt seines Kabinetts an. Hinden- burg stimmte zu und ernannte noch am selben Tag Franz von Papen zum neuen Kanzler. Der neue Reichskanzler, ein ehemaliger Berufsoffizier aus münsterländischem Uradel, bildete ein Kabinett vornehmlich aus Deutschna- tionalen. Dieses "Kabinett der Barone" hob das Verbot der SA und SS wieder auf.
"Nachdem die so umworbene NSDAP einen Monat später den Belagerungszu- stand für Preußen forderte, beschloß das Kabinett am 16. Juli die Absetzung der preußischen Regierung. Die Krawalle des sogenannten 'Altonaer Blutsonn- tags' am 17. Juli, der 18 Todesopfer forderte, bildeten nachträglich eine höchst willkommene Begründung für den 'Preußenschlag' genannten Staatsstreich. Am 20. Juli setzte Papen per Notverordnung die Regierung ab, verhängte über Preußen den Ausnahmezustand und ließ sich von Hindenburg zum Reichskom- missar für das Land Preußen ernennen."1
Im größten Land der Republik hatte sich seither der Parlamentarismus behaupten können. Durch die Absetzung der Regierung der großen Koalition Braun/Severing wurde Preußen an das Reich angeglichen und stand von nun an ebenfalls unter der autoritären Präsidialregierung.
Das Kabinett Papen nahm außerdem eine drastische Kürzung der Sozial-lei- stungen vor, führte neue Steuern ein und löste, da es keine Mehrheit hatte, den Reichstag auf. Die Neuwahlen wurden auf den 31. Juli festgesetzt. Die NSDAP führte einen Wahlkampf der Superlative. Hitler reiste mit einem eigenen Flugzeug von einer Stadt zur anderen und hielt täglich bis zu drei Großveranstaltungen ab. Seine uniformierten Trupps überfielen immer häufi- ger politische Gegner, stürmten linke Zeitungsredaktionen und Gewerk- schaftshäuser, sprengten Versammlungen oder veranstalteten "Propaganda- märsche". Immer häufiger kam es zu Zusammenstößen und blutigen Krawal- len.
Die Wahlen brachten ein sensationelles Ergebnis. Während sich die Kommu- nisten, die Sozialdemokraten, das Zentrum, die Deutschnationalen und die Bayerische Volkspartei behaupten konnten, verloren alle übrigen Parteien an Einfluß zugunsten der Nationalsozialisten. Diese konnten ihr gutes Ergebnis vom Herbst 1930 mehr als verdoppeln. Der eigentliche Verlierer der Wahl war die Regierung v. Papen, sie hatte im neuen Reichstag 90% der Stimmen gegen sich. Somit wurde am 12. September der Reichstag abermals aufge- löst.
Die Neuwahlen am 6. November 1932 brachten der NSDAP einen Rückgang von 37,8% der Stimmen auf 33,5%. Die Deutschnationalen und die Kommunisten erzielten Gewinne.
Am 17. November erhielt das Kabinett v. Papen seine Entlassung. Am 2.
Dezember wurde General v. Schleicher von Hindenburg zum neuen Reichskanzler ernannt. Dieser übernahm bis auf zwei Umbesetzungen das gesamte "Kabinett der Barone".
Sein Plan, die Nationalsozialisten zu spalten und nach Neuwahlen eine Regierung auf breiter Basis zu errichten, mißlang.
Ostelbische Junker und gewisse Großindustriellenverbände drängten Hindenburg, endlich Hitler die Macht zu übergeben - und damit die Gefahr von links ein für allemal zu bannen. Hindenburg lehnte es jedoch vehement ab, "diesen österreichischen Gefreiten" zum Reichskanzler zu machen. Erst als ihm von Papen entweder ein Kabinett der "nationalen Front" mit Hitler als Kanzler oder ein Kampfkabinett Papen-Hugenberg präsentierte, sprach sich Hindenburg dafür aus, verfassungsmäßige Wege zu beschreiten.
"Er gab seinen Widerstand gegen ein nationales Mehrheitskabinett auf und zeigte sich für diesen Fall geneigt, auf eine Reichskanzlerschaft Hitlers einzugehen, sofern dessen Einfluß durch starke konservative Gegengewichte im Kabinett austariert sei."1
Am 30. Januar 1933 berief Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Die Nationalsozialistische Schreckensherrschaft begann.
7.1.1Kulturelle und Ideologische Strömungen
Die bürgerlichen Parteien reagierten auf die Stimmeneinbußen der SPD zugunsten der KPD mit einer Öffnung nach rechts.
Die rechtsbürgerlichen Kreise propagierten nun sozialistisch klingende Bindungs-Ideen, um so den Kommunisten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Diese völkischen Gemeinschaftsparolen fanden vor allem bei politisch verunsicherten Menschen Anklang. Parolen wie "Bindung", "Gemeinschaft" oder "Volk" sollten von der sich zuspitzenden Klassenkampfsituation ablenken.
"Von dem Slogan, daß man schließlich im gleichen Boot sitze, war es dann nicht mehr weit bis zur Forderung nach wahrer Volksgemeinschaft und schließlich - angesichts der wachsenden Stärke der Kommunisten - zum offenen Übertritt ins nationalsozialistische Lager."1
Die KPD:
Die KPD beabsichtigte nun, die versäumte sozialistische Revolution von 1918/19 nachzuholen, um den Arbeitern einen Volksstaat nach sowjetischem Vorbild präsentieren zu können.
Sie "setzte sich weiterhin für einen radikal geführten Klassenkampf ein, an dessen Ende die siegreiche Diktatur des Proletariats stehen werde. Wer diese Ideen nicht teilte, konnte in ihr schwer Fuß fassen. Die KPD blieb deshalb während der sogenannten Prosperitäts-Periode zwischen 1924 und 1929 relativ isoliert: isoliert von den Massen der Fabrikarbeiter, die der SPD anhingen, und isoliert von der Mehrheit der linksliberalen Intellektuellen, die sich vom aggressi- ven Kollektivismus und Sowjetismus der KPD abgestoßen fühlten und weiterhin ihre Individualität verteidigten."2
Durch die Einschätzung der Sozialdemokratie als "Sozialfaschismus" versperrte die KPD den Weg einer einheitlichen Aktion der Arbeiterklasse.
"Eine Einheitsfront mit der SPD und mit den von ihr geführten Gewerkschaftsor- ganisationen erschien der KPD im Rahmen ihrer Politik und Theorie als Unter- stützung des Faschismus. Daher lehnte sie jeden Vorschlag zur Bildung eines
"Blocks" von KPD, SPD, und ADGB zur Bekämpfung der Nazis und zur Verhinderung einer Diktatur Hitlers bis zum Sommer 1932 entschieden ab."3
Durch die "Sozialfaschismustheorie" verkannte die KPD die wirkliche faschi- stische Gefahr in Deutschland. Der Kampf gegen die Nazis wurde als Bestandteil des allgemeinen Kampfes gegen den "Faschismus" geführt. Er verblieb im Rahmen der Politik gegen die Sozialdemokratie und gegen die Notstandskabinette.
Völkische, bündnische und faschistische Ideologiekomplexe:
Bereits seit Mitte der zwanziger Jahre gab es etwa 500 rechte Organisatio- nen, die den Begriff der 'Konservativen Revolution' auf ihre Fahnen geschrie- ben hatten. Viele dieser Gruppen kamen aus altkonservativ-monarchisti- schen Kreisen und sahen die Weimarer Republik nur als ein Zwischenreich an. Ihr ideologisches Ziel war es, das Nationale und das Sozialistische miteinander zu verbinden. Großen Einfluß hatten diejenigen Gruppen, die ein rein biologisches Jugend-Konzept proklamierten, das die Jugend als Garant einer neuen Gemeinschaftlichkeit sah. In seinem Manifest "Die Sendung der jungen Generation" von 1932 spricht E. Günther Gründel von einem "Aufbruch der Jugend".
"Statt sich weiterhin abgewirtschafteten Leitbildern wie der 'Neuen Sachlichkeit', der amerikanischen 'Prosperity', der falschen Maxime 'to have a good time', dem Kapitalismus, dem Liberalismus, dem Parlamentarismus und Demokratis- mus, denen die ältere Generation noch anhänge, zu verschreiben, stützt sich auch Gründel [neben anderen Autoren der damaligen Zeit - Anmerkung der Verfasserin] fast ausschließlich auf den Idealismus und Radikalismus der jüngeren Generation. Gegen die kommunistische Idee einer Diktatur des Prole- tariats wie auch die vergreiste Unzeitgemäßheit des demokratischen Parlamen- tarismus wird daher die Idee eines von der Jugend erhofften 'Volkssozialismus' ausgespielt. Dem entspricht, daß Erfolge der Nationalsozialisten seit den Septemberwahlen des Jahres 1930 von Gründel bereits als Triumphe der Jugend gedeutet werden."1
Die Ideologie des "Dritten Weges" fand während dieser Zeit ebenfalls großen Anklang. Vertreter dieser Richtung waren Hans Zehrer, Ernst Wilhelm Eschmann und Ferdinand Fried. Diese forderten zwischen Nazis und Kommunisten eine "Dritte Front" aufzurichten, eine Volksgemeinschaft mit rein bündnischer Struktur. Ihr Ideal war ein sozialer Volksstaat mit stark ländlicher Komponente, mit freiwilligem Arbeitsdienst, mit Neusiedlungen für die Jugend und mit nationaler Planwirtschaft.
Aus den vielen Gruppen und Organisationen, die diese Ideologiekomplexe vertraten, entwickelte sich allmählich eine zur Massenpartei.
"Erst der Nationalsozialismus hat der antidemokratischen Opposition eine Massenbewegung großen Stils gebracht, und wenn man auch im einzelnen anderer Meinung sein mochte als Hitler und seine Ideologen, so war doch allein das Faktum einer mächtig aufstrebenden Oppositionspartei bedeutsam genug, um dieser Bewegung zumindest die Sympathien und evtl. auch die Stimmen derer zu verschaffen, die mit einer Ablösung der Weimarer Demokratie durch ein neues Herrschaftssystem liebäugelten und dahingehende Auffassungen vertraten, mochten sie sich mit denen der Nationalsozialisten decken oder nicht."2
Diese Partei operierte allerdings nur vordergründig mit der Ideologie des "Dritten Weges", schließlich nannte sie sich Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. In Wirklichkeit traten Hitler und seine Gefolgsleute für ein kapitalistisches System unter einer anderen Staatsform ein.
Wie viele rechte Organisationen befürwortete Hitler ebenfalls die "konserva- tive Revolution". Diese hatte nicht den Umsturz, sondern die Bewahrung im Auge.
"Und eine Revolution, die sich für eine Erhaltung der bestehenden Verhältnisse einsetzte [...], erschien den deutschen Durchschnittsbürgern damals wesentlich sinnvoller als eine radikale Änderung des gesamten Systems. Daher siegte die NSDAP und nicht die KPD im großen Endkampf um die Wählermassen, der sich zwischen 1930 und 1932 abspielte. Und die Nationalsozialisten siegten nicht nur, weil sie Teile des Großkapitals auf ihrer Seite hatten, sondern weil sie auf geschickte Weise den Kommunisten den Wind aus den Segeln nahmen, indem sie sich ebenfalls als Sozialisten hinstellten. Ja, nicht nur das. Sie siegten, weil sie alles, aber auch alles in ihre Ideologie integrierten, von dem sie sich einen Stimmengewinn versprachen. Während die Kommunisten vor allem auf die politische Stringenz ihrer Lehre bedacht waren, verschmähten es die Nationalsozialisten nicht, gerade an die niedrigsten Instinkte jener kleinbürgerli- chen Schichten, die in diesem Kampf das Zünglein an der Waage bildeten, zu appellieren: an ihre Affekte gegen die 'Entartung' der deutschen Kultur, ihren latenten Antisemitismus, ihre unklare Wut gegen die 'Zinsknechtschaft' und ihre völkischen Ressentiments, welche die Nationalsozialisten immer wieder mit dem Hinweis auf die 'Schmach von Versailles' aufzuputschen versuchten. Und gegen ein so massives Trommelfeuer von Halbwahrheiten, Lügen und irrational aufgewühlten Emotionen, wie Ernst Bloch und Wilhelm Reich schon 1933 feststellten, war nun einmal mit rein rationalen Mitteln nicht anzukämpfen."1
7.2 Ignaz Wrobel - Kampf gegen den Nationalsozialismus
"Man kann für eine Majorität kämpfen, die von
einer tyrannischen Minorität unterdrückt wird. Man kann aber nicht einem Volk das Gegenteil von dem predigen, was es in seiner Mehrheit will (auch die Juden). Viele sind nur gegen die Methoden Hitlers, nicht gegen den Kern seiner 'Lehre'." 1
Kurt Tucholsky bezog im Februar 1930 die Villa Nedsjölund im schwedischen Hindas. Von dort verfolgte er die Vorgänge in Deutschland mit wachsender Verbitterung und Resignation. Es war fast alles eingetroffen, was er und seine Kollegen seit vielen Jahren vorhergesagt hatten. Einige dieser Vorher- sagen wiederholte er in seinem Artikel "Der Hellseher", der am 1. April 1930 erschien. Auf diesen Artikel werden im Anschluß an diesen Zeitabschnitt näher eingehen.
Einen Monat später, am 13. Mai 1930, erschien der Artikel "Die deutsche Pest". Prescher behauptet, daß Tucholsky es ablehnte, sich mit den Nationalsozialisten ernsthaft auseinanderzusetzen, trotzdem durchschaute Wrobel sehr früh die Taktik dieser Partei:
Die Nationalsozialisten
"behaupten 'revolutionär' zu sein, wie sie denn überhaupt der Linken ein ganzes Vokabular abgelauscht haben: 'Volkspartei' und 'Arbeiterpartei' und 'revolutionär'; es ist wie ein Konkurrenzmanöver. Daß bei der herrschenden Arbeitslosigkeit des Landes und der Direktionslosigkeit der bureaukratisierten Sozialdemokratie die Arbeiter scharenweise zu den Nazis laufen, darf uns nicht wundern.
Revolutionär sind die nie gewesen. Die Geldgeber dieser Bewegung sind erzkapitalistisch, der Groll, der sich in den Provinzzeitungen der Partei, in diesen unsäglichen 'Beobachtern' ausspricht, ist durchaus der von kleinen Leuten: Erfolg und Grundton dieser Papiere beruhen auf Lokalklatsch und übler Nachrede [...]. Das freut die einfachen Leute; es zeigt ihnen, daß sich die Partei ihrer Interessen annimmt, es befriedigt ihre tiefsten Instinkte - denn der Klein- bürger hat drei echte Leidenschaften: Bier, Klatsch und Antisemitismus. Das wird ihm hier alles reichlich geboten."2
So erkannte Wrobel durchaus die Wirkung, die von einer solchen Partei ausgeht:
"Die Deutschen sind stets ein Gruppenvolk gewesen; wer an diesen ihren tiefsten Instinkt appelliert, siegt immer. Uniformen; Kommandos; Antreten; Bewegung in Kolonnen... da sind sie ganz."1
Abermals beschuldigte Wrobel Polizei, Justiz und Regierung, die Umtriebe der Nazis zu dulden, ja sogar als legal anzusehen, auf der anderen Seite aber Ausschreitungen von links drakonisch zu bestrafen:
"Und hier beginnt die Schuld der Republik: eine Blutschuld.
Polizei und Richter dulden die Burschen, und sie dulden sie in der durchaus richtigen Anschauung: 'Mitunter ist es ja etwas reichlich, was hier getrieben wird. Keinen Totschlag! Nicht immer gleich schießen... Aber, trotz allem: Diese da sind Blut von unserm Blut, sie sind nicht gegen sondern für Autorität - sie sind, im allertiefsten Grunde, für uns, und sie sind nur deshalb nicht ganz und gar für uns, weil wir ihnen nicht stramm genug sind und zu sehr republikanisch. [...] ...wir möchten ja ganz gerne. Und tun unser Möglichstes. Zurücktreten! Nicht stehen bleiben! Na ja... aber es sind unsre, unsre, unsre Leute.' Es sind ihre Leute.
Es sind so sehr ihre Leute, daß die verschiedenartige Behandlung, die Kommunisten und Nationalsozialisten durch Polizei und Rechtsprechung erfahren, gradezu grotesk ist."2
Sein Schluß klingt sarkastisch. Er schrieb:
"Und wenn wir uns diese einseitig geschützte Republik ansehen, diese Polizeibeamten und diese Richter, dann entringt sich unsern Herzen ein Wunsch: Gebt uns unsern Kaiser wieder!"3
Wrobel war sich wahrscheinlich bewußt, daß die Nationalsozialisten mit einem starken Stimmenanwuchs rechnen konnten, da sie für sämtliche Probleme, mit denen Beamte, Angestellte und Arbeiter, Bürgerliche und Proletarier zu kämpfen hatten, einfache Lösungsmöglichkeiten anboten. Eventuell um dies zu verhindern, fand er nochmals zur kämpferischen Hochform zurück. Er begann überaus bissig und satirisch, den wahren
Charakter der Hitlerleute aufzuzeigen. Sein Vokabular ließ kein gutes Wort an Hitler und seinen Parteimitgliedern. Er bezeichnete, um ein paar Beispiele zu nennen, die SA als "Säufer- und Schlägertruppe", warf den Anhängern "Hirnlosigkeit" vor und bezeichnete die Nazis als "Schreihälse". Erich Kästner verbrachte im August vierzehn Tage Urlaub mit Tucholsky. Sie hatten sich zufällig im gleichen Hotel in Brissago am Lago Maggiore niedergelassen. In seinen Erinnerungen schrieb er:
"Während ich tagsüber am Strand lag oder von einem Balkon zum anderen zog, damit in meinem Reich die Sinne nicht untergehen mögen, klapperte Tucholskys Schreibmaschine unermüdlich, der schönen Stunden und Tage nicht achtend. Der Mann, der da im Dachstübchen schwitzte, tippte und Pfeife rauchte, schuftete ja für fünf - für Peter Panter, Theobald Tiger, Ignaz Wrobel und Kaspar Hauser und Kurt Tucholsky in einer Person! Er teilte an der kleinen Schreibmaschine Florettstiche aus, Säbelhiebe, Faustschläge. Die Männer des Dritten Reiches, Arm in Arm mit den Herren der Reichswehr und der Schwerin- dustrie, klopften ja damals schon recht vernehmlich an Deutschlands Tür. Er zupfte sie an der Nase, er trat sie gegen das Schienbein, einzelne schlug er k.o. - ein kleiner dicker Berliner wollte mit der Schreibmaschine eine Katastro- phe aufhalten."1
Doch seine Anstrengungen konnten die NSDAP nicht stoppen.
Im Februar 1931 erschien der Artikel "Von den Kränzen, der Abtreibung und dem Sakrament der Ehe". Wrobel sah hier bereits das Sich-aufeinanderzube- wegen von Kirche und Nationalsozialismus voraus:
"Kampf? Soweit sich die Kirche in die Politik einmischt: schärfster Kampf. Im übrigen: schweigen und vorübergehen. Es ist auch ganz falsch, hier Milde walten zu lassen, weil man sich davon vielleicht taktische Erfolge verspricht. Die Kirche und damit ihre politischen Parteien, sie werden nie etwas andres tun als das, was diesem Verein nützt. Nie. Zwei Einwände sind abzutun: man dürfe doch die Gefühle der andern nicht verletzten, und man treibe so das Zentrum dem Faschismus in die Arme. Da liegt es schon, trotz allem. Und wenn einige Maulhelden der Hitler-Garden nicht so unsäglich ungebildet und töricht wären: sie hätten schon längst davon abgelassen, das Zentrum durch die Ablehnung Roms, durch einen etwas schüchternen Wotankult und durch Jesuitenriecherei zu ärgern. Das wird sich legen, Hitler gibt das auch billiger. Und das Ding möchte ich mal sehen, das die Kirche nicht segnete, wenn sich das für sie lohnt."2
Tatsächlich hatte bereits nach den Wahlen - wenn auch ohne Erfolg - Prälat Kaas, der Führer des Zentrums, mit den Nationalsozialisten Kontakt aufgenommen. Er wollte über eine eventuelle Koalition verhandeln. Am Ende dieses Artikels findet sich eine offene Kritik am Kommunismus, von dem Wrobel sich inzwischen distanziert hatte:
"...frei von Kirche und wirtschaftlicher Sklaverei. Frei auch von kommunistischer Theologie, die drauf und dran ist, den Sinn ihrer Anhänger erst so zu erweitern und dann so zu verengen, wie es die katholische mit ihren Leuten schon getan hat."3
Zwei Monate später war für Wrobel die Republik bereits untergegangen. In einer Buchbesprechung "Bauern, Bonzen und Bomben" schilderte er Falla- das Roman als einen "hochinteressanten Roman" welcher "uns politisch angeht". Falladas Beschreibungen über das deutsche Kleinbürgertum, über die Rolle der Beamten, der Justiz und der Polizei sprachen Wrobel aus dem Herzen.
"Es ist eine Atmosphäre der ungewaschenen Füße. Es ist der Mief der Klein- stadt, jener Boden aus Klatsch, Geldgier, Ehrgeiz und politischen Interessen; es ist jene Luft, wo die kleine Glocke an der Tür des Posamentierwarenladens scheppert und eine alte Jungfer nach vorn gestolpert kommt... Augen tauchen hinter Fensterladen auf und sehen in den 'Spion'..."1
Die Atmosphäre die Fallada beschrieb, war für Wrobel Ausdruck des Zustandes in der Republik. Die Republik hatte es versäumt, eine Änderung in der Einstellung der Kleinbürger zu bewirken, nun war es zu spät. Resigniert schrieb er:
"Und wenn man das alles gelesen hat, voller Spannung, Bewegung und ununterbrochen einander widerstreitender Gefühle: dann sieht man die immense Schuld jener Republik, die wir einmal gehabt haben und die heute zerbrochen ist an der Schlappheit, an der maßlosen Feigheit, an der Instinktlo- sigkeit ihres mittlern Bürgertums, zu dem in erster Linie die Panzerkreuzer bewilligenden Führer der Sozialdemokratie zu rechnen sind. Der Lebenswille der andern war stärker; und wer stärker ist, hat das Anrecht auf Sieg. Beklagt euch nicht."2
Wrobel wiederholte seine Vorwürfe gegen die Sozialdemokraten:
"Hier, in diese kleinen Städte, ist der demokratische, der republikanische Gedanke niemals eingezogen. Man hat - großer Sieg! - auf manchen Regie- rungsgebäuden schwarz-rot-gold geflaggt; die Denkungsart der breiten Masse hat die Republik nie erfaßt. Nicht nur, weil sie maßlos ungeschickt, ewig zögernd und energielos zu Werke gegangen ist; nicht nur, weil sie 1918 und nach dem Kapp-Putsch, nach den feigen Mordtaten gegen Erzberger und Rathenau, alles, aber auch alles versäumt hat - nein, weil der wirkliche Gehalt dieses Volkes, seine anonyme Energie, seine Liebe und sein Herz nicht auf solcher Seite sein können. Die Sozialdemokratie ist geistig nie auf ihre Aufgabe vorbereitet gewesen; diese hochmütigen Marxisten-Spießer hatten es alles schriftlich, ihre Theorien hatten sich selbständig gemacht, und in der Praxis war es gar nichts. Das Volk versteht das meiste falsch; aber es fühlt das meiste richtig. Daß nun dieses richtige Grundgefühl heute von den Schreihälsen der Nazis mißbraucht wird, ist eine andre Sache."3
Ab dem zweiten Halbjahr 1931 bemerkt man, daß Wrobel keine Lust mehr am Tagesjournalismus hatte. Am 4. August erschien unter der Rubrik "Bemerkungen" der Artikel "Der bewachte Kriegsschauplatz", mit dem bis heute umstrittenen Zitat "Soldaten sind Mörder". Wie in diesem Artikel sind auch in den folgenden bissige, ironische und satirische Elemente enthalten. Jedoch spürt man förmlich die Resignation, die nun jedem Artikel von Ignaz Wrobel innewohnt.
Im Mai 1932 verabschiedete er sich mit einer zweiteiligen Artikelserie mit dem Titel "Redakteure". Hier rechnete er mit dem Berufsstand ab, zu dem er selbst gehörte.
Er bemängelte die Machtlosigkeit des Redakteurs gegenüber dem Verleger, die der Redakteur wiederum durch "Machtprotzerei" vor seinem Mitarbeiter und sich selbst gegenüber ausgleichen würde.
Obwohl er in den letzten Jahren in zahlreichen Artikeln den starken Einfluß der rechten Presse kritisierte, sprach er nun von der Machtlosigkeit der Presse. So würde auf dem Gebiet der großen Politik die Machtlosigkeit des Redakteurs genauso wie die des Verlegers zum Himmel schreien.
"Außenpolitisch ist das nur komisch. Mir sagte einmal ein ehemaliger Redak- teur der Frankfurter Zeitung: 'Als wir jung waren, haben wir immer geglaubt, die Weltpolitik werde in der Großen Eschenheimer Straße gemacht.' Das glauben viele Leute von ihren Redaktionen heute noch, und wer einmal im Ausland gelebt hat, der weiß, daß deutsche Zeitungen zwar oft zitiert, aber selten gehört werden.
Innenpolitisch richten die Zeitungen um so weniger aus, je größer sie sind; tatsächlich ist ja die Entwicklung der letzten Jahre gegen die Leitartikel der größten Zeitungen, und nicht nur der sogenannten demokratischen, vor sich gegangen.
Sie können schreiben, was sie wollen, und die Politiker tun, was sie wollen."1
Diese Aussage ist nicht allgemeingültig. Hier meinte er seine persönliche journalistische Machtlosigkeit. Er hatte endgültig erkannt, daß sein jahre-lan- ger Kampf für die Menschlichkeit erfolglos geblieben war. Nun trat der "kratzbürstige" Mahner und "scharfzüngige Kritiker" Ignaz Wrobel von der journalistischen Bühne ab. Seine Warnungen waren weder von den Politikern noch vom Volk gehört worden.
7.3"Der Hellseher" - eine Interpretation
Hier handelt es sich um einen Dialog zwischen einem Hellseher und seinem Klienten. Wie bei der Aufzeichnung eines Interviews gibt dieser satirische Artikel die Sitzung in wörtlicher Rede wider. Frage und Antwort wechseln sich ab, wobei dieser Wechsel durch Gedankenstriche kenntlich gemacht wird. Die Fragen des Klienten sind kurz. Es sind selten vollständigen Sätze. Genauso die Antworten. Diese bestehen häufig nur aus aneinandergereihten Satzfragmenten. Dadurch, daß die Sätze nicht ausformuliert werden, muß der Leser selbst die Zusammenhänge herstellen. Er muß sich mit dem Text beschäftigen, sich mit ihm auseinandersetzen und sein Wissen über den Zustand der Republik einfließen lassen. Der Textstil erinnert an die "Wendri- nermonologe".
Mit diesem Artikel möchte Wrobel nochmals mit dem Deutschland abrechnen, das er inzwischen haßte. Er gibt zu Beginn einige Hinweise auf seine früheren Warnungen, die alle ungehört blieben. Anschließend erzählt er seinem Klienten, was die Zukunft bringen wird. Genauso wie der Kaffee in Wirklichkeit kein Kaffee ist, sind die relativ harmlos beschriebenen Zukunfts- aussichten in Wirklichkeit nicht harmlos. Die Deutschen wollen, daß etwas geschieht. Die Gefahr, die von einer Veränderung der politischen Zustände ausgeht, wollen sie allerdings nicht sehen. So glauben sie eher jemand, der die Situation schönredet und verharmlost. Wrobel übernimmt hier als Hellse- her so eine Rolle und erzählt seinem Klienten (der den bürgerlich geprägten Durchschnittsdeutschen verkörpert) das, was dieser eigentlich hören will.
Jedoch weist die satirische Polemik dieser Darstellung, die von bitterer Ironie geprägt ist, immer wieder auf die Widersprüchlichkeit der Darstellung hin. Man spürt in dieser politische Satire Wrobels Pessimismus. Schon der Anfang deutet auf seine Resignation hin:
"- 'Sie... sind Hellseher?'
- 'Ich bin von Haus aus eigentlich Schwarzseher - nun verbinde ich diese beiden Berufe...' "1
Während ein "Hellseher" vorhersagen kann, was die Zukunft bringen wird, ist ein "Schwarzseher" jemand, der alles negativ sieht. Dadurch, daß Wrobel diese beiden Bezeichnungen in einer Person vereint, kann man davon ausgehen, daß er ein düsteres Zukunftsbild vor sich hat. Der Hellseher berichtet seinem Klienten von zwei Begebenheiten, die er vorhergesagt hatte: den Krieg und Rathenaus Tod. Anschließend fragt ihn dieser, ob es einen Putsch geben werde. Der Hellseher antwortet:
"Putsch trocken. Ich sehe kein Blut. Ich sehe die aufgeregte Insel Deutschland. Fascismus Lagerbräu."2
An dieser Stelle könnte man meinen, Wrobel sah die "Machtergreifung" Hitlers voraus. Bei der weiteren Lektüre dieses Artikels wird aber klar, daß mit diesem "Putsch trocken" letztendlich ein "Putsch" der Reaktion gemeint ist:
"-'Wozu ein Putsch? Die Herren haben ja beinahe alles, was sie brauchen: Verwaltung, Richter, Militär, Schule, Universität - wozu ein Putsch? Immerhin... es ist Frühling..."3
Täuschte sich Wrobel ausgerechnet in einem Artikel mit dem Titel "Der Hellseher"?
Tatsächlich schätzt er die Rolle der Nazis falsch ein:
"-'Die Hitlerleute?'
- 'Halb so schlimm. Furchtbar viel Geschrei; Brutalitäten; Freude an organisier- tem Radau; Freude an der Uniform, den Lastwagen und dem Straßenauf- marsch ... halb so schlimm. Vorspann - wenn sie den ersten Ruck gegeben haben, wird man sie bremsen, die armen Kerle. Es wird da große Enttäuschun- gen geben.'" Und einige Zeilen weiter: "Deren radikale Flügel werden rasch unterdrückt; auch Herr Hitler hat seine Schuldigkeit getan und kann gehen."4
Wenn man allerdings die Geschichtsbücher zu Rate zieht, kann man vermu- ten, daß Wrobels Vorhersagen in diesem Artikel wieder einmal eingetreten wären, hätten nicht Intrigen, Cliquenwirtschaft und Machtanspruch einzelner Reaktionäre dazu geführt, Hitlers Stellung innerhalb der konkurrierenden Gruppen zu stärken.
Ursprünglich war von reaktionärer Seite geplant, mit dem Stimmenanteil der NSDAP an die Macht zu kommen, anschließend aber sollten Hitler und seine Radikalen ausgeschaltet, gespalten oder "gezähmt" werden. Jedenfalls sollte die NSDAP bedeutungslos gemacht werden. Die Pläne der Reaktion waren klar: Abschaffung der verhaßten Demokratie, des Parlamentarismus und die Zerschlagung der Gewerkschaften. Eine Militärdiktatur war im Gespräch. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie gut der "schwarzsehende Hellse- her" Wrobel die Reaktionäre einschätzten konnte. Heutzutage kann speku- liert werden, ob auch ohne Hitler und seine NSDAP die Weimarer Republik in eine Diktatur gemündet wäre und somit die Prognosen des Hellsehers wahr geworden wären.
Interessant ist mit welchen Mitteln der Autor arbeitet, um die unterschiedli- chen Machtpositionen der Faschisten einerseits und der Arbeiterschaft andererseits zu beschreiben. Allein durch die unterschiedliche Schreibweise (groß bzw. klein) werden Unterschiede im Kräfteverhältnis deutlich. So beschreibt Wrobel die "Hitlerleute" unter Zuhilfenahme von Substantiven:
'Halb so schlimm. Furchtbar viel Geschrei; Brutalitäten; Freude an organisiertem Radau; Freude an der Uniform, den Lastwagen und dem Straßenaufmarsch..."1
Andererseits werden die Arbeiter durch Adjektiven beschrieben:
"Kleine lokale Widerstände der Arbeiter; die sind aber gespalten, desorganisiert, waffenlos, niedergebügelt"2
Am Schluß des Artikels schreibt Wrobel:
"'Das ist alles?'
- 'Das dürfte alles sein. Ob es geschieht, weiß ich nicht. Wenn aber -: dann so. Übrigens... ich bin Hellseher...ich hatte eine Vision...Sie werden mir diese Sitzung honorieren...Ich dachte an hundert Mark?'
- 'Hier haben sie ein Bildnis Hindenburgs. Und lassen Sie sich draußen in der Küche ein paar Butterbrote geben... Gott befohlen, junger Mann!'
- 'Heißen Dank, gnädiger Herr. Wenn Sie wieder etwas brauchen: Nepomuk Schachtel, Hellseher und Original-Astrologe mit ff. indischen Erkenntnissen. Täglich von 9 bis 8, Sonntags [sic.] geschlossen. Und empfehlen Sie mich in Ihrem werten Bekanntenkreise!'"3
Dieser Schluß kann folgendermaßen interpretiert werden:
Wie oben erwähnt, unterschätzt Wrobel Hitler und seine Gefolgsleute. Er verkennt die Wirkung, die Hitler nicht nur auf das Volk, sondern auch auf einige Reaktionäre hat. Dadurch, daß Wrobel von einem Sieg der Reaktion ausgeht, stellt er seinem Klienten - offenbar ein bürgerlicher "Hindenburg- anhänger" - eine positive Prognose. In absehbarer Zeit würden die Reaktio- näre ihr Ziel erreicht haben. Zwar würde es noch "einige kleinere Krawalle und Unannehmlichkeiten" geben, aber letztendlich wäre alles halb so schlimm. Und dadurch, daß er seinem Klienten genau das sagt, was dieser eigentlich zu hören wünscht, wird er in dieser schlechten Zeit zwar nicht mit hundert Mark, aber zumindest mit ein paar Butterbroten und einem Bildnis Hindenburgs belohnt.
8 Didaktischer Teil: "Das leere Schloß" fächerverbindend behandelt
Im Bildungsplan der Hauptschule soll fächerverbindend das Thema "Frieden schaffen und bewahren" behandelt werden. Die Zielsetzung wird folgendermaßen beschrieben:
"Das friedliche Zusammenleben zwischen Menschen und Völkern ist ständig gefährdet. Bei der Frage, wie der Frieden als Grundbedingung menschlicher Existenz gesichert werden kann, verknüpfen sich in besonderer Weise politisch-historische und ethisch-religiöse Überlegungen. Die fächerverbindende Arbeit an dieser Thematik fördert bei den Schülerinnen und Schülern die Bildung eines eigenen Standpunktes. Auf diese Weise wird es ihnen möglich, sich für die Sicherung des Friedens einzusetzen."1
Unter Berücksichtigung dieses Themas soll nun in den Fächern Deutsch und Geschichte der Artikel "Das leere Schloß" von Ignaz Wrobel behandelt werden. Dieser Artikel bietet sich an, da er einen Gesamtverlauf über die Zeit der Weimarer Republik aus der Sicht Ignaz Wrobels wiedergibt.
8.1 Voraussetzungen
Um Wrobels Darstellung mit dem tatsächlichen Verlauf der Weimarer Republik vergleichen zu können, wurde im Fach Geschichte die Lehrplanein- heit 2, "die Weimarer Republik", bereits behandelt. Ebenso ist den SchülerIn- nen im Fach Deutsch die Arbeit an Texten geläufig. Im Deutschunterricht wurde bereits der Autor Kurt Tucholsky vorgestellt und zwei Texte von ihm behandelt: Mit Kaspar Hausers "Herr Wendriner erzieht seine Kinder." (GW 4/90), wurde der Begriff der Satire geklärt. Eine Gedichtinterpretation erfolgte anhand des Gedichtes "Park Monceau" von Theobald Tiger (GW 3/378).
In der Klasse werden die Fächer Deutsch und Geschichte von einer Lehrerin unterrichtet.
8.2 Überlegungen und Entscheidungen zur Thematik
8.2.1 Sachanalyse
Die Interpretation des Textes soll überwiegend während des Unterrichts erarbeitet werden und den Zeitraum zwei Doppelstunden nicht übersteigen. Diese Unterrichtseinheit soll dazu dienen, den 14-16jährigen SchülerInnen eine fächerverbindende Zusammenfassung bereits behandelter Inhalte zu ermöglichen. Um eine sachangemessene und lernmotivierende Betrach- tungsweise des Themas zu ermöglichen, liegt der Schwerpunkt nicht auf der detaillierten Interpretation, sondern den Text in seiner Gesamtheit zu überblicken und zu verstehen, ihn historisch einzuordnen, seine Aussagen mit den Verhältnissen der Gegenwart zu vergleichen und über diese zu diskutieren.
"Das leere Schloß" - eine Interpretation
Den Vorspann dieses Artikels bildet eine Erzählung. Man könnte sich den Erzähler umringt von einer Schar Kinder, am Feuer sitzend, vorstellen. Die Stimme des Erzählers klingt geheimnisvoll, die Kinder lauschen gebannt Dieser Vorspann dient dem Autor dazu, Spannung zu erzeugen. Am 10. November 1918 verläßt der Kaiser sein Schloß (Metapher für das Zentrum der Macht) und flieht nach Holland. "Ende 1918 und Anfang 1919" besetzte die meuternde Volksmarinedivision Schloß und Marstall. Dieser Aufstand der von Berliner Arbeitern unterstützt wird, wird von konter-revolu- tionären Truppen blutig niedergeschlagen. Seit dieser Zeit steht das Schloß leer.
"Die Regierung wohnt in der Wilhelm-Straße." Die republikanische Regierung hat ihren Sitz an einer Straße, die zu Ehren des Kaisers dessen Namen trägt. Das leere Schloß und der Sitz der Regierung in der Wilhelmstraße deuten bereits in der Einleitung auf die Schwäche der Regierung hin. Doch dieses Zentrum der Macht ist nicht leer. "Eine im Nachtwind lohende weiße Frau", Allegorie für den "monarchistischen Geist" wohnt in diesem Schloß.
Durch die rhetorische Frage und deren Antwort am Ende, "Und tagsüber?
Tagsüber regiert er.", erreicht Wrobel, daß die Spannung nochmal gesteigert wird. "Zwangsläufig" muß weitergelesen werden.
Ignaz Wrobel blickt zunächst in die Vergangenheit.
Die folgenden fünf Abschnitte zeigen stufenförmig den Verlauf der Gescheh- nisse ab der Revolution bis zur Gegenwart auf. Jede Stufe behandelt eine Gruppe, die durch ihr "Tun oder Nichttun", den gegenwärtigen Zustand zu verantworten hat. Das Vorhandensein der einen Stufe ermöglicht den Schritt zur nächsten.
Zunächst "die Revolution, die Macht schuf".
1. "Weil sie sich nicht so recht trauten", wurde diese Macht von "den Leuten" nicht genutzt. Hier sind die "Durchschnittsdeutschen" gemeint.
2. Dadurch konnte die Revolution sabotiert werden. Das alte Recht blieb erhalten. Hier sind die Reaktionäre gemeint.
3. "Die neuen Männer" arbeiteten lieber mit den Reaktionären zusammen, anstatt "ihre Macht aus sich selbst zu stabilisieren". Hier ist das Parlament gemeint. Wrobel liefert dazu folgendes Bild:
"Die neuen Männer schwammen wie eine dünne Fettschicht auf dem Meer, und dann kam die riesige Wasserflut der Reaktionäre, mit denen sie arbeiteten."1
Dieser Ausspruch erscheint in Wrobels Artikeln häufig. Mit dem Bild der "schwimmenden Fettschicht auf dem Wasser" verdeutlicht Wrobel die Schwäche der Regierung. Träge und faul schwimmt sie oben und läßt sich - wie die Frau Major, die fast in Fett und Selbstzufriedenheit erstickt - von den alten reaktionären Kräften, dem alten Verwaltungsapparat tragen. Die Fettschicht schwimmt nur deshalb oben, weil sie leichter als Wasser ist. Sie wird also vom Wasser getragen. Dadurch, daß sie oben schwimmt, bemerkt sie die gewaltige Wassermenge nicht, die unter ihr "brodelt".
Fett gemischt mit Wasser gibt eine Emulsion. Wenn sich aber nun eine riesige Wasserflut mit der dünnen Fettschicht vermischt, bleibt von der Fettschicht nicht mehr viel übrig. Das Fett wird im Endeffekt von dieser Wasserflut "geschluckt".
4. Dadurch wurde es versäumt den Verwaltungsapparat zu "reorganisieren". Hier sind die Beamten gemeint.
5. Die republikanische Regierung wird nun "vom eigenen Apparat ausgehöhnt". Hier ist die Regierung gemeint.
Ignaz Wrobel kommt nun zur Darstellung der Gegenwart. Die nächsten zehn Abschnitte beschreiben zehn Beispiele. In diesen werden konkrete Situationen aufgezeigt, die die Republik gefährden.
Zwei weitere Beispiele folgen durch den Leserbrief "einer alten Dame" und den "vertraulichen Bericht eines Offiziers". Diese, scheinbar nicht von Wrobel stammenden Berichte, verleihen dem Artikel mehr Authentizität. Der Leser- brief der alten Dame spricht besonders das Gefühl der Leser an. Durch den Vergleich der "Oberstwitwe" mit den armen kinderreichen Frauen erscheint die Ungerechtigkeit besonders krass. Der Bericht des Offiziers beschreibt die politische Situation in der Provinz. Dieser Bericht kann als der Höhepunkt des gesamten Artikels gesehen werden. Er gibt einen Ausblick in die Zukunft. Bei der Lektüre erkennt man Ähnlichkeiten zu vorausgehenden und nachfol- genden warnenden Artikeln von Wrobel. Der Schreibstil, vor allem die scharfe und klare Sprache, die Ausrufesätze und die kurzen Fragen, zeigt Parallelen zum Schreibstil von Ignaz Wrobel, so daß Zweifel an der Echtheit dieses Offiziersberichtes angemeldet werden darf. Die Vermutung liegt nahe, daß Wrobel einen oder mehrere Berichte aus der Provinz mit persönlichen Erfahrungen1 verbunden hat, um diesen "vertraulichen Bericht eines Offiziers" zu fertigen.
Dem Bericht zufolge sind die Reaktionäre, auf der Suche nach geeigneten Mitteln die Republik auszuhöhlen, inzwischen fündig geworden. Mittels einer beispiellosen Hetzkampagne gegen die Juden fällt ihr Vorhaben zusehends auf fruchtbaren Boden.
" - nun, da hat man ja immer noch in der großen Kiste ein paar Mittelchen, die geschickt angewandt, als Mittel zum Zwecke dienen. Mit USP und KPD ist es nichts, also nun so ein bißchen feuchtfröhliche Judenhetze. Sie glauben nicht, welche Formen das hier angenommen hat. In der gemeinsten Weise wird hier ein Haß ausgesät, der, wenn er aufgeht, die bedenklichsten Folgen haben kann. Hier hat man ein scheinbar ganz neutrales Mittelchen, um den Brand zu entzünden. [...] Es ist bezeichnend, daß die Judenhetze grade von denen kulti- viert wird, die früher Vaterlandswohl in Erbpacht zu haben vorgaben."2
Es ist überaus erstaunlich, wie Ignaz Wrobel bereits 1920 das Unheil an den Juden vorausahnte:
"Wohin soll das führen? Hier sammelt sich im stillen ein Haß an, der, zum Brand entfacht, fürchterlich in die Erscheinung treten muß. Unsre Provinz ist bislang die ruhigste gewesen, nie ist es gelungen, uns Niedersachsen aufzuputschen, aber jetzt mit der infamen Judenhetze, da heißt es: auf dem Posten sein. Es wird gar nicht mehr diskutiert, daß die Juden umgebracht werden sollen, sondern nur, wie man sie umbringen will."3
Wenn diese Art zu hetzen, bereits 1920 auf so fruchtbaren Boden fiel, drängt sich der Verdacht auf, daß Daniel Jonah Goldhagen mit seinem umstrittenen historischen Buch "Hitlers willige Vollstrecker" so unrecht doch nicht haben kann, wenn er behauptet,
"daß der eliminatorische Antisemitismus, der diese gewöhnlichen Deutschen bewegte, während der NS-Zeit und auch davor schon in der deutschen Gesell- schaft extrem stark verbreitet war. [...] Als Hitler an die Macht kam, fiel es ihm deshalb nicht schwer, zuerst für die ungewöhnlich radikalen Verfolgungen während der dreißiger Jahre - von denen alle Deutschen wußten und gegen die sich kaum grundsätzlicher Widerspruch erhob - viele gewöhnliche Deutsche zu mobilisieren. [...] Obwohl die meisten Deutschen von selbst niemals auf die Idee gekommen wären, die radikalen Konsequenzen ihrer Meinung von den Juden zu ziehen und auszuführen, was das für Hitler möglich, weil die gesamte eliminatorische antisemitische Politik der Nationalsozialisten diese weitverbrei- tete, längst bestehende Vorstellung vom Wesen der Juden zur Grundlage hatte."4
Die Warnungen dieses vertraulichen Berichtes sind an die Regierung gerichtet. Dadurch, daß Wrobel einen Angehörigen eines von den Regierenden angesehenen Berufszweiges zu Wort kommen läßt, der zudem selbst "ein vierzig Jahre alter Politiker" ist, erhöht Wrobel die Chance, daß seine Warnungen von der Regierung endlich wahrgenommen werden. Der Offizier bezieht durch die Personalpronomen "wir" und "unser" andere Politiker mit ein und fordert diese zum unverzüglichen Handeln auf.
Die Beispiele, mit denen der Offizier seine Aufforderung zum Handeln begründet, sollten eine demokratischen Regierung aufhorchen lassen. Insbesondere die Parlamentsmitglieder mit jüdischem Glauben möchte er durch seine Darstellung besonders ansprechen. Sein Aufruf, zum sofortigen Handeln wird am Ende mehrmals wiederholt.
"Das [die judenhetzerischen Aufputschungen] ist Spekulation auf die niedersten Leidenschaften, um politischen Dunkelmännern zur Erreichung ihrer Ziele zu dienen. Ich bin kein Schwarzseher, aber hier muß etwas geschehen, etwas mehr als bisher. [...] Hat Berlin die Monarchie geschmissen, nun, so schmeißt die Provinz die Republik. Jedes Mittel ist recht dazu. Sollte dies nicht der Gedankengang sein? Für mich steht es fest, daß der Beginn der Offensive gegen die Republik mit einem Judengemetzel beginnen wird. Jetzt ist es noch Zeit, Gegenmaßregeln zu treffen. Worte nützen nichts, Taten! [...] Zugefaßt, frisch ans Werk, jede Minute ist kostbar. [...] Es ist dringendste Gefahr im Verzuge.'"1
Nun schlüpft der Autor wieder in die Rolle des Ignaz Wrobel. Mit einem weiteren Beispiel, das die Gefahr, die von der bürgerlichen Presse ausgeht, darstellt und das fehlende "geistige Gegengewicht" bemängelt, leitet er über zum nächsten Teil des Artikels.
Der Tonfall wechselt Wrobels Sprache wird anprangernd. Man spürt seine Wut, wenn er auf die Schwäche und die Hilflosigkeit der Regierung hinweist. Dadurch, daß er einzelne Wörter oder kurze Sätze wiederholt, klingen seine Schilderungen noch eindringlicher.
Hier drei Beispiele:
-"Sie können ja nicht - ! Sie wirken wie Familienväter, die der Frau was befehlen, aber die Frau steckt sich die Haare auf und geht ihre Wege. Und Vater schüttelt traurig den Kopf ... Sie können ja nicht."
-"Sie paktieren ängstlich mit einer Welt, die sie nie für voll nehmen wird, und die sie haßt, haßt, haßt."
-"Statt hier zu sagen: Nein! [...] Statt hier ins Mark zu treffen.."2
Und weil die Regierung kein Interesse daran hatte, dem reaktionären Treiben ein Ende zu bereiten, war für Ignaz Wrobel der Weg den die Republik nehmen würde bereits 1920 vorgezeichnet:
"Und Geschehnis gliedert sich an Geschehnis, und Keiner will sehen, wie wir offenen Auges ins Verderben laufen. Weit, weit hinter das Jahr 1914 zurück."3
Nach der Kritik an der Regierung folgt die Kritik am
"Durchschnittsdeutschen". Wrobel beschreibt diesen ebenso, wie Heinrich Mann seinen "Untertan" beschrieben hat. Indem sich "der Untertan" mit der Macht identifizierte, konnte er scheinbar an ihr teilhaben. Indem er nach oben "kuschte", konnte er aber auch nach unten treten, also selbst Macht ausüben.
Seine Vorwürfe sind als Frage formuliert: "Wißt ihr nicht, daß...". Dadurch regt er die Leser zum Nachdenken und Überprüfen dieser Aussagen an. Weil dieser "Durchschnittsdeutsche" Angst vor dem "Fortschritt" (steht für Demokratie) hat, befürwortet er "das Zürückzerrende"1 (steht für die Reaktion bzw. den Militarismus).
Mit kurzen und ausrufenden Sätzen prangert er wiederum das Versagen der Regierung an, nicht in der Lage zu sein, "Mut und Macht" zu demonstrieren, und damit den sich damals nicht trauenden "Untertanen" den Weg nach vorne gewiesen zu haben.
Die explosive Sprache kennzeichnet seine Wut. Trotzdem bemerkt man, daß diese emotionale Kritik letztendlich einen Appell darstellt. Er möchte die Regierung aufrütteln:
"Um zu regieren: dazu gehören vor allem einmal Mut und Macht. dazu gehört die - nicht nur figürliche - große Geste, die da sagt: Jetzt sind wir die Herren! Wir wohnen im Schloß! Wir herrschen! Wir repräsentieren! Wir decken das Alte auf und zeugen Neues! Wir. Wir. Wir."2
Diese Zeilen sind im Präsens geschrieben, sie lassen dadurch immer noch die Möglichkeit offen, den beschriebenen Zustand herbeizuführen. Das "wir" deutet auf Wrobels Verbundenheit hin.
Der nächste Absatz klingt provozierend:
"Aber freilich: dazu müßte man irgendeine Mehrheit seines Landes hinter sich haben. Man hatte sie einmal. Es ist das genau fünfzehn Monate her. Vorbei, vorbei."3
Vor allem die letzten beiden Worte klingen hämisch. Man hat den Eindruck, daß Wrobel mit dem "vorbei, vorbei" eine Reaktion bei den Regierenden auslösen will, die ihn vom Gegenteil überzeugt. Wenn diese Reaktion aller- dings nicht eintritt, wird der Zustand des nächsten Abschnittes eintreten. Die Aussage dieses Abschnittes soll offenbar nochmals zum intensiven Nachdenken anregen:
Wohin gleiten wir? Dahin, wohin uns ein spießiger und kurzstirniger Kommodore gesteuert hat - und wohin wir doch wohl schließlich, wenn denn die Weltgeschichte einen Sinn haben sollte, zu gehören scheinen."1
Am Schluß kommt Wrobel wieder auf das "berliner Schloß" mit seinem Geist zurück. Diese Erzählung bildet demnach den Rahmen für seinen Artikel. Die weiße Frau steht für das kaiserliche Deutschland. Dieser Geist tritt in Gestalt einer Frau auf. Überhaupt finden sich im gesamten Artikel immer wieder Vergleiche zwischen einer Frau und dem kaiserlichen Deutschland. So wird z.B. im folgenden Satz die Mutter mit dem geflohenen Kaiser vergli- chen:
"Alle Leute gingen herum wie die Kinder, wenn Mutter fortgegangen ist - man war frei, aber man traute sich nicht so recht."2
Im folgenden Satz wird die Frau mit der "Reaktion" verglichen, die den Befehl des schwachen Familienvaters (der Regierung) ignoriert:
"Sie wirken wie Familienväter, die der Frau was befehlen, aber die Frau steckt sich die Haare auf und geht ihre Wege. Und Vater schüttelt traurig den Kopf..."3
Auch die Frau "Major", die inzwischen "Oberstwitwenpension" erhält, steht mir dem kaiserlichen Deutschland in Verbindung.
Mit dem Begriff "Geist" verweist Wrobel ironischerweise auf die "ungeistigen Hohenzollern". Dieser Begriff wird hier zunächst positiv verwendet. Mit diesem Hinweis möchte Wrobel darstellen, wie wenig dieses Adelsgeschlecht zum "deutschen Geist" beigetragen hat.
Andererseits steht der Begriff für "Spuk" oder "Gespenst". So kann der gesamte Artikel als Aufforderung betrachtet werden, mit diesem "Spuk" endlich aufzuräumen. Die Regierung ist in ihrem derzeitigen Zustand aller- dings zu schwach dazu. Wenn sich dieser Zustand nicht ändert, bleibt der geflohene Kaiser (der atlantische Admiral), Vorsteher dieses Schlosses. Sein Gespenst steht bereits wieder vor den Türen und weht durch die öden Korri- dore (der Ämter).
Wieder kann man sich den Erzähler umringt von einer Schar Kinder, am Feuer sitzend, vorstellen. Die Stimme des Erzählers klingt geheimnisvoll, die Kinder lauschen gebannt. "...Wenn ihr hübsch leise seid, könnt ihr sie [die weiße Frau] kichern hören."4
Die Kinder trauen sich aber nicht so recht.
8.2.2Begründung der Unterrichtsarbeit
Dadurch, daß die Interpretation des Textes gleichzeitig auf zwei Ebenen erfolgt - der historischen und der sprachlichen - erfahren die SchülerInnen welche sprachlichen Mittel eingesetzt werden, um eine bestimmte Sichtweise zu vermitteln. SchülerInnen lernen dadurch Texte kritisch zu hinterfragen. Durch die historische Interpretation des Textes befassen sich die SchülerIn- nen intensiv mit der "Weimarer Republik". Die von Wrobel dargestellten Gründe für ihr eventuelles Scheitern, werden in der Klasse diskutiert. Welche weiteren Gründe für das Scheitern der Weimarer Republik liefert das Geschichtsbuch?
Als nächster Schritt erfolgt ein Vergleich mit der Gegenwart. Folgende Fragen werden nun diskutiert: Was unterscheidet die heutige Republik von der Weimarer Republik? Gibt es heutzutage Gefahren, die den Frieden bedrohen? Auf welche Ursachen lassen sich diese zurückführen? Wo und wie kann ich mich für den Frieden einsetzen? Wie gehe ich mit "Macht" um?
Dadurch, daß die SchülerInnen die Ursachen des Scheiterns der Weimarer Republik intensiv untersucht haben, reagieren sie sensibler auf Bedrohungen, die heutzutage die Demokratie gefährden könnten. Sie werden dadurch befähigt, sich auch außerhalb der Schule und zukünftig für den Frieden einzusetzen.
Mit der Sozialform "Gruppenarbeit" wird partnerschaftliches Arbeiten geübt. In der Diskussion lernen die SchülerInnen den anderen zuzuhören, auf andere einzugehen und durch das Abwägen verschiedener Beiträge sich eine eigene Meinung zu bilden.
8.3 Überlegungen und Entscheidungen über die fachlichen Lehrziele
Für das Fach Deutsch:
der Schüler / die Schülerin soll :
- zentrale Aussagen anhand von wichtigen Begriffen aus dem Text herausarbeiten können.
- wichtige Begriffe und Schlüsselwörter finden und geg. definieren können.
- einige sprachliche Mittel herausfinden und ihre Wirkung erkennen können
Für das Fach Geschichte:
- durch die Arbeit mit dem Text ein umfassendes Bild über Bedrohung und Scheitern der Weimarer Republik bekommen.
- aus der Geschichte lernen - d. h. Bezüge zur Gegenwart herstellen und Gefahren erkennen können
- anhand des Vergleichs des Textes mit den Aussagen des Geschichtsbuches erfahren, daß es sinnvoll ist, mehrere Quellen heranzuziehen, um ein umfassendes Geschichtswissen zu bekommen.
8.4 Überlegungen zur Vermittlungsproblematik
Nachdem die SchülerInnen Zuhause den gesamten Artikel "Das leere Schloß" gelesen haben, erklärt die Lehrerin zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde den weiteren Verlauf der fächerübergreifenden Unterrichtseinheit. Die SchülerInnen werden nun in vier Gruppen je 4-5 SchülerInnen aufgeteilt. Gruppe 1 beschäftigt sich mit dem "Rahmen" des Textes - der Einleitung und dem Schlußteil und bekommt folgende Aufgaben:
1. Gib den Inhalt des Textes kurz wieder.
2. Unterstreiche die Deiner Meinung nach wichtigen Begriffe (Schlüsselwör- ter) und überlege Dir, welche Bedeutung sich dahinter verbergen könnte.
3. Was will der Autor mit diesem Text aussagen?
Gruppe 2 behandelt den Artikel ab dem Abschnitt "Staatsrechtlich ist Folgen- des vor sich gegangen..." - bis kurz vor Beginn des Leserbriefs der Dame, "... man ist doch immerhin, ein wenig, entfernt verwandt."
Diese Gruppe soll folgende Aufgaben lösen:
1. Gib den Inhalt des Textes kurz wieder.
2. Überlege unter Zuhilfenahme deines Geschichtsbuches, welche Vorgänge der Autor in seiner Schilderung anspricht.
3. Der Autor gibt nun einige Beispiele, die den Zustand der Republik betreffen. Welche Wirkung will er damit erzielen?
Gruppe 3 beschäftigt sich mit dem Leserbrief der alten Dame und dem vertraulichen Bericht eines Offiziers und erhält folgende Aufgaben:
1. Gib den Inhalt der beiden Texte kurz wieder.
2. Unterstreiche die Deiner Meinung nach wichtigsten Aussagen.
3. Was will der Autor durch das Zitieren dieser beiden Berichte erreichen?
Gruppe 4 behandelt den Text ab "Die alldeutschen Blätter..." bis "wenn denn die Weltgeschichte einen Sinn haben sollte, zu gehören scheinen." Sie bekommt folgende Aufgaben:
1. Gib den Inhalt des Textes kurz wieder.
2. Wie beschreibt Wrobel die Regierung? Unterstreiche die Adjektive.
3. In welchen Zusammenhängen erscheint das Substantiv "Macht". Beschreibe, was Wrobel damit ausdrücken will.
4. Welche sprachlichen Mittel benutzt er?
Zu ihrer Unterstützung bekommen die Gruppen neben dem Geschichtsbuch eine chronologische Auflistung der Ereignisse der Weimarer Republik ausge- händigt. Jedes Gruppenmitglied erhält den jeweiligen Teil des zu behandeln- den Textes. Die 4-5 Gruppenmitglieder werden aufgefordert, die Fragen untereinander nochmals aufzuteilen und eine/n GruppensprecherIn zu bestimmen. Der/die GruppensprecherIn bekommt eine Folie ausgehändigt, auf die er/sie die Ergebnisse in Stichworten notieren kann. Die Gruppenarbeit wird über den Rest der Stunde fortgesetzt. Die Lehrerin muß die Gruppen durch Hinweise und Anregungen unterstützen, da die Aufgabenstellung relativ schwierig ist.
Die zweite und dritte Unterrichtsstunde wird zur Ergebnissicherung verwen- det. Nachdem die Gruppenarbeit zu Beginn der Stunde maximal zehn Minuten fortgesetzt wurde, sollen nun die SprecherInnen der Gruppen unter Zuhilfenahme ihrer Folien ihr Ergebnis vorstellen. Da alle SchülerInnen den gesamten Text kennen, werden Ergänzungen aber auch Diskussionsbeiträge zugelassen.
Während die GruppensprecherInnen ihr Ergebnis der Klasse vorstellen, übernimmt die Lehrerin bestimmte Begriffe für einen Tafelanschrieb.
Die SchülerInnen sollen anschließend das Tafelbild in ihr Heft übernehmen.
Die letzte Stunde dieser Unterrichtseinheit wird dazu benutzt, die Weimarer Republik und deren Scheitern nochmals zu reflektieren. Außerdem soll ein Vergleich mit der Bundesrepublik hergestellt werden.
Dazu werden nochmals vier Arbeitsgruppen gebildet. Alle vier Gruppen sollen folgende Fragen beantworten:
1) Welche weiteren Gründe für das Scheitern der Weimarer Republik liefert Dein Geschichtsbuch? Vergleiche diese Gründe mit dem Artikel von Ignaz Wrobel.
2) Welche Gefahren bestehen Deiner Meinung nach heutzutage für die Republik?
3) Wie könnte man sich heutzutage Deiner Meinung nach sinnvoll für den Erhalt des Friedens einsetzen?
4) Beschreibe das Wort "Macht". Welche Beziehung hast Du zu diesem Wort?
Zweck dieser Gruppenarbeit ist es, diese vier Fragen in einem kleineren Kreis "vorzudiskutieren", um dann im Gespräch in großer Runde (der Klasse), genügend Diskussionsbeiträge zu erhalten. SchülerInnen die sich nicht so recht trauen, vor der Klasse etwas zu sagen, finden im kleineren Kreis eher den Mut dazu.
Nach 15 Minuten beendet die Lehrerin die Gruppenarbeit und fordert die SchülerInnen auf, einen großen Kreis zu bilden.
Im Sitzkreis stellt die Lehrerin nochmals die gleichen Fragen. Diese werden nun in großer Runde diskutiert, wobei die Ergebnisse der Gruppenarbeit einfließen sollen. Die Beiträge werden unter Zuhilfenahme einer Rednerliste "abgearbeitet", wobei die Lehrerin als Kommentatorin lenkend eingreifen soll. Fünf Minuten vor dem Klingelzeichen faßt die "Kommentatorin" das Ergebnis nochmals zusammen und fordert die SchülerInnen auf, die Sitzordnung im Klassenzimmer wiederherzustellen.
9 Literaturverzeichnis
Primärliteratur:
- Athenäum Verlag (Hrsg.): Die Weltbühne. Vollständiger Nächdruck der Jahrgänge 1918 - 1933. Königstein/Taunus 1978. (abgekürzt: WB)
- Gerold-Tucholsky, Mary und Raddatz Fritz J.(Hrsg.): Kurt Tucholsky. Gesammelte Werke in 10 Bänden. Reinbek bei Hamburg 1995 (abgekürzt: GW)
Sekundärliteratur:
- Bemmann, Helga: Kurt Tucholsky. Ein Lebensbild. Berlin 1990
- Berkholz, Stefan (1990): "Du bist die Ausnahme." Die Briefe Siegfried Jacobsohn an Kurt Tucholsky erschrecken, weil sie hellsichtig sind. In: Die Zeit, Nr. 8, S.44.
- Bracher/Funke/Jacobsen (Hrsg.): Die Weimarer Republik 1918-1933. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Bonn 1987.
- Brummack, Jürgen (1971): Zu Begriff und Theorie der Satire. In: Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Sonderheft Forschungsreferate. 45 Jhg.
- ders: Wieszt, Jozsef: KPD-Politik in der Krise 1928-1932. Zur Geschichte und Problematik des Versuchs, den Kampf gegen den Faschismus mittels Sozialfaschismusthese und RGO-Politik zu führen. Frankfurt am Main 1976.
- Deutscher Bundestag, Referat Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.): Fragen an die deutsche Geschichte. Bonn 1988.
- Engelmann, Bernt: Wir Untertanen; Deutsches Anti-Geschichtsbuch; Teil 1. Frankfurt am Main 1981.
- Engelmann, Bernt: Einig gegen Recht und Freiheit. Deutsches Anti-Geschichtsbuch 2. Teil. Frankfurt am Main 1981.
- Fingerhut, Karlheinz (1986): Wir Negativen - Wir wollen kämpfen mit Haß aus Liebe. Funktionsübergänge von Journalismus und Poesie bei Kurt Tucholsky. In: Praxis Deutsch. Heft 79, S. 62-69.
- Gerold-Tucholsky, Mary, Raddatz, Fritz J. (Hrsg.); Kurt Tucholsky. Schnipsel. Reinbek bei Hamburg 1994.
- Gerold-Tucholsky, Mary u. Raddatz, Fritz J. (Hrsg.): Kurt Tucholsky. Ausgewählte Briefe 1913-1935. Reinbek bei Hamburg 1962.
- Gietinger, Klaus (1992): Nachträge, betreffend Aufklärung der Umstände, unter denen Frau Dr. Rosa Luxemburg den Tod gefunden hat. In: IWK Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Heft 3, S. 319-373.
- Goldhagen, Daniel Jonah (1996): Das Versagen der Kritiker. In: Die Zeit, Nr. 32, S. 9.
- Haug, Wolfgang (1992): Die Beziehungen von Anarchismus und Expressionismus am Beispiel Erich Mühsams. In: IWK Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Heft 4, S. 511ff.
- Haug, Wolfgang (Hrsg.): Ludwig Rubiner Künstler bauen Barrikaden. Texte und Manifeste 1908-1919. Darmstadt 1988.
- Hepp, Michael: Kurt Tucholsky. Biographische Annäherungen. Reinbek bei Hamburg 1993.
- Hermand, Jost / Trommler, Frank: Die Kultur der Weimarer Republik. München 1978. { Krockow, Christian Graf von: Die Deutschen in ihrem Jahrhundert 1890-1990; Reinbek
b. Hamburg 1992.
- Leonhardt, Rudolf Walter: Kästner für Erwachsene. Zürich 1966.
- Madrasch-Groschopp, Ursula: Die Weltbühne. Porträt einer Zeitschrift. Königstein/Taunus 1983.
- Ministerium für Kultus und Sport Baden Württemberg (Hrsg.): Bildungsplan für die Hauptschule. Lehrplanheft 2/1994.
- Mommsen, Hans: Die verspielte Freiheit. Der Weg der Republik von Weimar in den Untergang. Frankfurt am Main, Berlin 1990.
- Ploetz Verlag (Hrsg.): Der Volks-Ploetz. Auszug aus der Geschichte. Schul- und Volksausgabe. Freiburg, Würzburg 1991 5
- Prescher, Hans: Kurt Tucholsky. Berlin 1982.
- Schwindt, Klaus: Satire in funktionalen Kontexten. Theoretische Überlegungen zu einer semiotisch orientierten Textanalyse. Tübingen 1988.
- Seligmann, Michael: Aufstand der Räte. Die erste bayerische Räterepublik vom 7. April 1919. Grafenau 1989.
- Sontheimer, Kurt: Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. München 1992.
- Stark, Michael: Für und wider den Expressionismus. Die Entstehung der Intellektuellendebatte in der deutschen Literaturgeschichte. Stuttgart 1982.
- Tenbrock, Dr. R. H., Kluxen, Prof. Dr. K. , Stier, Prof. Dr. H. E. (Hrsg.): Zeiten und Menschen; Geschichtliches Unterrichtswerk Oberstufe, Paderborn 1970. { Vogel, Harald: Tucholsky lesen. Ein Lesebuch mit kommentierenden Lesezeichen. Hohengehren 1994.
- Weigel, Hans: Das Land der Deutschen mit der Seele suchend. Bericht über eine ambivalente Beziehung. Zürich 1983.
- Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart 1989 7.
Ich versichere, daß ich die Arbeit selbstständig und nur mit den angegebenen Quellen und Hilfsmitteln angefertigt und daß ich alle Stellen der Arbeit, die aus anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinne nach entnommen sind, kenntlich gemacht habe.
Grafenau, den 10.08.1996
10 Gesamtverzeichnis der Beiträge Ignaz Wrobels in der Weltbühne
2. Hj. 1918: WB
11 Macchiavelli* S. 357
1. Hj. 1919:
12 Offizier und Mann S. 38
13 Militaria II* S. 87
14 Militaria III* S. 110
15 Militaria IV* S. 134
16 Militaria V* S. 159
17 Militaria VI* S. 201
18 Der Untertan S. 317
19 Stufen S. 386
20 Preußische Studenten S. 532
21 Die lebendigen Toten* S. 564
22 Der Offizier der Zukunft S. 661
23 Aufklärungsfilms S. 722
2. Hj. 1919:
24 Na, mein Sohn? S. 25
25 Noch immer... S. 85
26 Militaria* S. 190
27 Das politische Plakat S. 239
28 Schuldbuch S. 251
29 Henny Noske S. 303
30 Panizza S. 321
31 Alte Plakate S. 366
32 Neuer Militarismus S. 405
33 Politische Satire S. 441
34 Eindrücke von einer Reise* S. 473
35 Die Baltischen Helden S. 500
36 Kaiserbilder S. 583
37 Tollers Publikum S. 635
38 Zwei Mann in Zivil S. 659
39 Ein weißer Rabe S. 709
40 Sozialisierung der Presse S. 738
41 Prozeß Marloh* S. 755
42 Gesichter S. 805
1. Hj. 1920:
43 Militaria S. 106
44 Schlußwort S. 219
45 Das leere Schloß* S. 240
46 Im Tollhause S. 282
*) In der Arbeit behandelte Artikel
47 Kapp-Lüttwitz* S. 357
48 Militärbilanz* S. 464
49 Persius S. 503
50 Schlafbursche Noske S. 529
51 Weltgericht S. 596
52 Titel S. 637
53 Wahlunrecht S. 663
54 Macht und Mensch S. 721
2. Hj. 1920:
55 Wie lese ich die Zeitung? S. 56
56 Kehrseite S. 72
57 Klio mit dem Griffel S. 108
58 Wir S. 148
59 Der Bürgergeneral S. 171
60 Die Sittlichen S. 189
61 Organisierte Beamte S. 213
62 Kadettenliteratur S. 236
63 Revolutionswerkstatt S. 269
64 Kino-Zensur S. 308
65 Schwarz-gelbe Henker S. 341
66 Leerlauf S. 373
67 Deutscher Kunstschutz S. 402
68 Die grünen Säulen S. 469
69 Der neue Krieg, Schlußwort S. 513
70 Der Zensor geht um! S. 616
71 Ein Schrei aus der Not S. 686
72 Wohlanständige Wohltätigkeit S. 757
1. Hj. 1921:
73 Stammtisch S. 27
74 Friedrich von unten S. 83
75 Reisende, meidet Bayern S. 114
76 Offiziersbücher S. 134
77 Verhinderung der Reisen S. 317
78 Dada-Prozeß S. 454
79 Noch immer... S. 664
80 Am Strande S. 706
2. Hj. 1921:
81 Herausgeber oder Verleger S. 32
82 Der Herr Intendant S. 164
83 Fratzen von Grosz S. 184
84 Das Buch von der deutschen Schande* S. 237
85 Die Verteidigung des Vaterlandes S. 338
86 Presse und Realität S. 373
87 Otto Flake S. 422
88 Der Venuswagen S. 461
89 Breslau S. 485
90 Bekritzeltes Blatt S. 636
91 Der Sieg war zum Greifen nahe! S. 658
*) In der Arbeit behandelte Artikel
1. Hj. 1922:
92 Die Gesichtsschilder S. 53
93 Der rechte Bruder S. 104
94 Städte S. 116
95 Presseball S. 153
96 Der Meter S. 177
97 Die Reichswehr * S. 203
98 Das kleine Logbuch S. 226
99 Die eine Zeitung S. 279
100 Herr Adolf Bartels S. 291
101 Die Erdolchten S. 309
102 Die Aemter S. 362
103 Selber -! S. 384
104 Wo sind sie? S. 430
105 Quaquaro S. 489
106 Scala S. 515
107 Kriegsdienstverweigerer S. 537
108 Der Hund als Untergebener S. 652
109 Monarchie und Republik S. 609
110 Der Herr in der Loge S. 636
111 Die Schupo S. 642
2. Hj. 1922:
112 Das Zentrum S. 20
113 Die zufällige Republik * S. 25
114 Die Leberwurst S. 65
115 Geßler und wir S. 96
116 Aus großer Zeit S. 111
117 Schlangenmoos S. 149
118 Das Felderlebnis S. 155
119 Wohltätigkeit S. 205
120 Wat Grotmudder vertellt S. 219
121 Brunner im Amt S. 266
122 Die Unzüchtigen S. 288
1. Hj. 1923:
123 Requiem* S. 728
124 Morgens um Acht S. 763
2. Hj. 1923:
125 Potsdam S. 50
126 Die Kegelschnitte Gottes* S. 79
127 Der Gerichtsdiener S. 358
128 Erklärung S. 442
1. Hj. 1924:
129 Reisende, meidet Bayern! * S. 164
130 Erzberger und Helfferich S. 713
131 Sechzig Photographien* S. 768
132 Der Türke S. 828
133 Du! S. 867
134 Museum Carnavalet S. 881
*) In der Arbeit behandelte Artikel
2. Hj. 1924:
135 Rudolf Steiner in Paris S. 26
136 Nebendiplomatie S. 74
137 Die Wehrpflicht S. 116
138 "Deutsch" S. 155
139 Der Achtstundentag* S. 165
140 Vor Verdun* S. 218
141 Die Einstellung S. 270
142 Haarmann S. 299
143 Auslandskorrespondenten S. 320
144 Polizei S. 351
145 Der General im Salon S. 401
146 Sie werden wieder... S. 438
147 Rudolf Herzog - ein deutscher Mann S. 462
148 Künstler und Gesellschaft S. 519
149 Der erste Händedruck S. 541
150 Gewehre auf Reisen S. 573
151 Zeppelin S. 605
152 Der Erbfeind S. 675
153 Unamuno spricht S. 682
154 Eine deutsche Kindheit S. 734
155 Der Fall Nathusius* S. 759
156 Wahlvergleichung S. 814
157 Jaures im Panthéon S. 823
158 Schädlichkeit des Zivils S. 883
159 Der neue Zeitungsstil S. 918
160 Die Übersetzung S. 959
1. Hj. 1925:
161 Das nervöse Paris S. 6
162 Horizontaler und vertikaler Journalismus* S. 49
163 Richters Namenszug S. 108
164 Vierzehn Käfige und Einer S. 127
165 Ein Satz S. 178
166 Zwischen zwei Kriegen * S. 185
167 Wie Frankreich triumphiert S. 244
168 Weiße Russen S. 293
169 Die Herren Beisitzer S. 332
170 Außenseiter der Gesellschaft S. 359
171 Frau Eber S. 409
172 Brief an einen bessern Herrn * S. 426
173 Der Primus S. 486
174 Deutsche Kinder in Paris S. 496
175 Persönlich S. 562
176 Die Tafeln S. 601
177 Die Tendenzphotographie S. 637
178 Was nun -?* S. 645
179 Auslandsberichte S. 694
180 Mappe gegen den Krieg S. 756
181 Lachen und Lächeln S. 829
182 Buch und Bildern S. 864
183 Erinnerung S. 889
*) In der Arbeit behandelte Artikel
184 Wo S. 940
185 Das geistige Niveau S. 977
2. Hj. 1925:
186 Suomi-Finnland S. 19
187 Die Denkschrift S. 68
188 Sport S. 107
189 Drei junge Oldenburger S. 147
190 Der Telegrammblock S. 175
191 Paris, den 14. Juli S. 199
192 Emigranten S. 270
193 Fort mit dem Visumszwang! S. 307
194 Märtyrer S. 325
195 Les Abattoirs S. 367
196 Was wäre, wenn... S. 415
197 Herr Mauras vor Gericht S. 436
198 Eulenburgiana S. 476
199 Sa Majesté la Presse S. 527
200 George Grosz als Schriftsteller S. 583
201 Auf dem Grasplatz S. 620
202 Die Oberschlauen S. 658
203 Im Ruhestand S. 699
204 Französisches Militärgericht in Paris S. 709
205 Staatsmorphium S. 775
206 Hellpach und Hau S. 809
207 Die Dekadenten S. 845
208 Wieso? S. 880
209 Abreißkalender* S. 891
210 Noch ein Abreißkalender S. 962
211 Das Buch vom Kaiser S. 980
1. Hj. 1926:
212 Fascismus in Frankreich -? S. 7
213 Die Ebert-Legende S. 52
214 Der Namensfimmel S. 114
215 Der Dicke in Rußland S. 132
216 Deutsche Woche in Paris S. 206
217 Das Reichsarchiv S. 273
218 Waffe gegen den Krieg S. 312
219 Wir im Museum S. 325
220 Standesdünkel und Zeitung S. 417
221 Das Recht des Fremden S. 444
222 Wo waren Sie im Kriege, Herr -? S. 489
223 Fürstenabfindung S. 552
224 Gegen den Strom S. 567
225 Abrechnung S. 632
226 Camelots S. 672
227 Der General in der Comédie S. 703
228 Eine Akademie S. 734
229 Der politische Rundfunk S. 788
230 Theorie und Praxis S. 827
231 Der Hund und der Blinde S. 866
232 Herr Schwejk S. 892
233 Die fehlende Generation S. 929
*) In der Arbeit behandelte Artikel
234 Alte Wandervögel S. 966
235 Die Herren Gastgeber S. 1025
2. Hj. 1926:
236 Die Taktischen S. 19
237 Ein Lump S. 72
238 Repräsentanten S. 112
239 Nebenan, im Schweinestall S. 154
240 Nieder mit dem Roten Kreuz! S. 193
241 Wege der Liebe S. 230
242 Eine Idee S. 271
243 Begnadigung S. 312
244 Fußball mit Menschenköpfen S. 335
245 Beiseite S. 392
246 Der Sieg des republikanischen Gedankens* S. 412
247 Eveline, die Blume der Prärie S. 458
248 Ein kleiner Druckfehler S. 486
249 Typographisches S. 551
250 Altbewährte Esel S. 593
251 Ein Diktator und sein Publikum S. 608
252 Verfassungsschwindel S. 646
253 Fort mit dem Schundgesetz! S. 704
254 Berliner Verkehr S. 739
255 Der liebe Gott in Cassel S. 771
256 Ist man schon wieder keusch -? S. 828
257 Die tote Last S. 855
258 Old Bäumerhand, der Schrecken der Demokratie S.916
259 Schwejk der Zweite S. 974
260 Kampfmittel S. 1015
1. Hj. 1927:
261 Die Parole S. 23
262 Velhagen & Klasing S. 79
263 Die Naiven S. 111
264 Ein einfacher Lehrer S. 153
265 Kriegsfilme S. 195
266 Die genialen Syphilitiker S. 210
267 Larissa Reißner S. 298
268 Hehler S. 353
269 In Uniform S. 371
270 Gedenkmäler S. 432
271 Muff S. 472
272 Berlin! Berlin! S. 499
273 Wiedersehn mit der Justiz S. 543
274 Deutsche Richter I * S. 581
275 Deutsche Richter II * S. 699
276 Deutsche Richter III * S. 663
277 Stahlhelm oder Filzhut S. 773
278 Für wen sind eigentlich die Zeitungen da? S. 838
279 Warum stehn...? S. 877
280 Kopenhagener krabbeln auf ein Kriegsschiff S. 976
281 Dienstunterricht für den Infanteristen S. 1011
*) In der Arbeit behandelte Artikel
2. Hj. 1927:
282 Huh, wie schauerlich! S. 34
283 Der Rechtsstaat S. 51
284 Dänische Felder * S. 152
285 Die Veränderlichen S. 189
286 Die Schweiz und Hindenburg S. 211
287 Mit Rute und Peitsche durch Preußen-Deutschland S. 293
288 Der deutsche Mensch S. 332
289 Was wäre, wenn... S. 445
290 Auch ein Buchhändler S. 499
291 Acht Jahre politische Justiz S. 538
292 Über wirkungsvollen Pazifismus S. 555
293 Wiedersehen mit Paris S. 597
294 Unart der Richter S. 801
295 Der Fall Röttcher S. 815
296 Wo bleiben deine Steuern -? S. 875
297 Die Heinrich und der Zivilist S. 908
1. Hj. 1928:
298 Journalistischer Nachwuchs S. 12
299 Briefe an einen Fuchsmajor * S. 163
300 Wie benehme ich mich als Mörder? S. 380
301 Berlin und die Provinz S. 405
302 Der Takt der Soldaten S. 456
303 Die großen Familien S. 471
304 Zörgiebel in Paris S. 534
305 Die Überlegenen S. 573
306 Rundfunkzensur S. 590
307 Die leider nicht absetzbaren Richter S. 653
308 Das illoyale Reichsgericht S. 694
309 Dank vom Hause Stalin S. 731
310 Was aus der großen Zeit S. 806
311 Das "Menschliche" S. 826
312 Der symphatische Mörder S. 920
313 Der letzte Ruf S. 977
2. Hj. 1928:
314 Was soll er denn einmal werden? S. 60
315 Deutschenspiegel S. 93
316 Eitelkeit der Kaufleute S. 131
317 Ein Schädling der Kriminalistik I S. 167
318 Ein Schädling der Kriminalistik II S. 197
319 Jahrgang 1905 S. 242
320 Heimarbeiter S. 297
321 Mit einem Zuchthäusler? S. 315
322 Grimms Märchen S. 353
323 Die Republikanische Beschwerdestelle S. 459
324 Das zweite Heer S. 465
325 Sieg im Atlas S. 536
326 Verhetzte Kinder - ohnmächtige Republik S. 553
327 Die Beamtenpest I* S. 624
328 Die Beamtenpest II* S. 660
329 Die Beamtenpest III* S. 768
*) In der Arbeit behandelte Artikel
330 Ich bin ein Mörder S. 703
331 Die Franzmänner S. 753
332 Gebrauchslyrik* S. 808
333 "Natürlich: Der Einjährige -!" S. 865
334 Sprechstunde am Kreuz S. 881
335 Wahnsinn Europa S. 903
336 "Erst muß was passieren!" S. 944
1 Hj. 1929:
337 Fabel S. 36
338 Das A-B-C des Angeklagten S. 45
339 Das Kind, das nicht geboren ist S. 114
340 Köpfe S. 152
341 Verhetzte Kinder - ohnmächtige Republik S. 251
342 Die Geldstrafe S. 387
343 Die Begründung S. 435
344 "Polizei und..." S. 473
345 Ist es denn nur wirklich wahr, was man hat
vernommen S. 612
346 Die Frau mit dem Fähnchen S. 666
347 Der § 45 S. 798
348 Ein besserer Herr S. 953
2. Hj. 1929:
349 Juli 14 S. 119
350 Die Karikatur Preußens S. 183
351 Merkblatt für Geschworene S. 202
352 Für Joseph Matthes S. 233
353 Das Nachschlagewerk als politische Waffe S. 271
354 Blutrache in Leipzig S. 333
355 Woran liegt das -? S. 373
356 Nr. 1 S. 381
357 Indizien S. 455
358 Schulkampf S. 514
359 Ia. S. 567
360 Handelsteil S. 603
361 Fiat S. 640
362 Reinigung - aber womit? S. 711
363 Henri Barbusse und die Platte "Lord help me -! S. 763
364 Die Anstalt S. 798
365 8 Uhr abends - Licht aus S. 866
1. Hj. 1930:
366 Hat Mynona wirklich gelebt S. 15
367 Denkmal am deutschen Eck S. 94
368 Warum S. 150
369 Brief an eine Katholikin S. 198
370 Deutscher Whisky S. 330
371 Die Herren und Damen von IIIb S. 356
372 Bettschnüffler S. 388
373 Die Keuschheitsgürteltiere S. 477
374 Der Hellseher * S. 499
375 Braut- und Sport-Unterricht S. 540
*) In der Arbeit behandelte Artikel
376 Die hochtrabenden Fremdwörter S. 573
377 Schmutz bzw. Schund bzw. Geldverknappung S. 647
378 Staatspathos S. 702
379 Die deutsche Pest* S. 718
380 Bahnpolizei S. 775
381 Die Informierten S. 810
382 Lesefrucht S. 851
2. Hj. 1930:
383 Der Richter S. 178
384 Der klopfende Mann S. 419
385 Die Deutschtümelei der Post S. 454
386 Ein Deutschland-Buch S. 481
387 Das böse Gewissen S. 511
388 ...zu dürfen S. 597
389 Blick in ferne Zukunft S. 665
390 Der Leerlauf eines Heroismus S. 684
391 Der Mittler S. 718
392 Die Ufa sucht Dichter S. 766
393 Die Herren Verjünger S. 804
394 Der Exodus S. 839
395 Glücksspiel S. 878
396 Der standhafte Zinnsoldat S. 960
397 So etwas wäre im Ausland nicht möglich! S. 1001
1. Hj. 1931:
398 Kleiner Vorschlag S. 33
399 Von den Kränzen, der Abtreibung und dem
Sakrament der Ehe* S. 237
400 Die Stiftung S. 392
401 Die Herren Belohner S. 472
402 Bauern, Bonzen und Bomben* S. 496
403 Das schwarze Kreuz auf grünem Grunde S. 577
404 Die Essayisten S. 620
405 Auch eine Urteilsbegründung S. 680
406 Der neue Ramarque S. 732
407 Die Rotstift-Schere S. 778
408 Wir Zuchthäusler S. 838
409 Wann arbeiten die -? S. 932
2. Hj. 1931:
410 Der Verdachtsfreispuch S. 33
411 Der Predigttext S. 72
412 Zuzutrauen S. 111
413 Der bewachte Kriegsschauplatz* S. 191
414 Die Augen der Welt S. 216
415 Die Herren Wirtschaftsführer S. 254
416 Herr Wichtig S. 312
417 Reparationsfibel S. 328
418 Am Telephon S. 418
419 Eines aber S. 454
420 Sigilla Veri S. 483
421 Parteiwirtschaft S. 533
*) In der Arbeit behandelte Artikel
422 Die Kriegsschuldfrage S. 609
423 Die Verräter S. 720
424 Ein kleiner Volksschullehrer S. 831
425 Hégésippe Simon S. 895
426 Basel S. 940
427 Rote Signale S. 959
1. Hj. 1932:
428 Fräulein Nietzsche S. 54
429 Strafvollzug S. 107
430 Historisches S. 144
431 Pfiff im Orgelklang S. 164
432 Brief meines Vaters S. 204
433 Friedrich mitn Mythos S. 262
434 Die deutschen Kleinstädter S. 289
435 Privat S. 342
436 111 S. 382
437 Achtung! S. 457
438 Der Hellseher S. 541
439 Krieg gleich Mord S. 588
440 Röhm S. 641
441 Freier Funk! Freier Film! S. 660
442 Liebe Schweiz! S. 712
443 Redakteure I * S. 813
444 Redakteure II * S. 856
*) In der Arbeit behandelte Artikel
11. Anlagen
11.1 "Fünfundzwanzig Jahre" Tucholskys Weltbühnen-rück- blick - gekürzt -
"'Mein geronnenes Herzblut' sagte Siegfried Jacobsohn, wenn er die rote Reihe der Halbjahrsbände der Weltbühne betrachtete, die immer vor ihm standen. Seine Arbeit war darin, seine Liebe und sein ganzes Leben.
[...]
Die Schaubühne erschien. In den ersten drei, vier Jahrgängen stand S. J., ohne es zu wollen, im Mittelpunkt der Zeitschrift.
[...]
Das Theater war für S. J. die Welt - doch nahm er den Begriff so weit, daß niemals [...] ein enges Spezialistentum daraus wurde." Er kämpfte für die Wahrheit in der Kunst.
Bei alledem war es Jacobsohn aber auch wichtig, die Zeit zu erfassen in der er schrieb, denn es ist "nämlich für den Wert einer Zeitschrift nicht entscheidend, ob sie, gedruckt im Jahre 1932, auch noch im Jahre 1989 lesbar ist (sie ist es aber allemal - Anmerkung der Verfasserin), sondern daß es darauf ankommt, seine Zeitgenossen zu packen, aufzuwühlen, zu bilden und zu fassen. Die Schaubühne hat eine Zeitaufgabe erfüllt, und sie hat sie gut erfüllt. [...]
Er (S.J.) hatte Lust zu kämpfen, er hatte das flinke Florett und eine tödlich treffende Hand. Er war ein ritterlicher Gegner - doch wohin er schlug, da wuchs kein Gras mehr. [...] In dem 'kleinen Mann' war so viel Kampfeswille, so viel Begeisterung, im literarischen Kampf anzutreten; man hatte manchmal das Gefühl, als komme ihm der Gegner grade recht, als habe er nur darauf gewartet, ihn abzutun. Das vollzog sich sehr oft in Form eines geistigen Zweikampfes; er gab schon damals dem Gegner das Wort im Blatt, antwortete sofort, und man hatte niemals den Eindruck, daß er nun das "letzte Wort" behielte, weil ers typographisch hatte. Er traf - aber er blieb dabei stets in den Regeln des Spiels. [...] Und hatte S. J. einmal jemand beim Wickel, dann ließ er ihn sobald nicht los. Er verfolgte ihn, er schlug, er wich nie zurück, er war ein Polemiker von Geblüt. Davon wissen viele zu klagen.
Und in diesen Jahren - etwa um 1911 - bildete sich in der Schaubühne das heraus, was später den Geist der Weltbühne ausmachen sollte: die blitzblanke Redaktionsarbeit; die treffliche Auswahl der Mitstreiter; das unsichtbare, aber stets spürbare Patronat des Regisseurs, der für alle seine Leute die gleiche gute deutsche Sprache forderte, von einer Unerbittlichkeit im Stil, die von keinem seiner Gegner jemals erreicht worden ist.
Das ging bis ins Winzigste. Das Blatt erweiterte sich; zum Ernst gesellten sich Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, denen eine Stelle zu gönnen in diesem durchweg zweideutigen Leben kaum irgendein Blatt zu ernsthaft seyn kann. [...]
Wir Jungen verschlangen das Blatt; [...] ich hätte damals noch nicht gewagt, auch nur einen Beitrag einzureichen und fühlte mich doch schon völlig als zur Familie gehörig - das da ging uns alle an. Welche Grazie! welche Leichtigkeit noch im wuchtigen Schlag! welche Melodie! - alles Eigenschaften, die den Schreibenden bei dem schlechtern Typus des Deutschen höchst verdächtig machen. Was im Blatt stand, das drang weit ins Land - totschweigen half nicht, kreischen half nicht, nach 'Motiven' suchen half nicht, denn es waren keine anderen da, als nur eines: der niemals zu unterdrückende Drang, die Wahrheit zu sagen. 'Ich habe,' sagte S. J. einmal stolz, 'mein ganzes Leben immer nur getan, was mir Freude gemacht hat.' Und dieses war seine Freude: zu arbeiten, die Schreibenden zu ermuntern, die Wahrheit zu sagen - auch gegen alle andern, wenns Not tat. [...]
Nun möchte ich mir gewiß nicht nachträglich das Verdienst zuschreiben, aus der Theaterzeitschrift 'Die Schaubühne' die politische Zeitschrift 'Die Weltbühne' gemacht zu haben. (Den Namen hat, wenn ich recht bin, eine züricher Zeitung in einer freundlichen Besprechung der Schaubühne vorgeschlagen.) [...]
Das Blatt lavierte durch den Krieg, an Verboten vorbei, durch die Papierrationie- rung, und, mit einer Ausnahme, schwieg es da, wo es nicht sprechen konnte. Keine Nummer wäre erschienen, wenn gesagt worden wäre, was zu sagen war. [...]
Im Sommer des Jahres 1918 wurde die ästhetische Stille, die bis dahin gewal- tet hatte, prickelnd unterbrochen. Als ich meine ersten Arbeiten aus Rumänien schickte, hätte ich nie geglaubt, daß sie gedruckt werden könnten. Aber irgend ein Instinkt sagte mir: Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Ach, es war gar nichts vom 'Dolchstoß' zu spüren... hätten wir nur -! Doch schien sich zu Hause manches gelockert zu haben, die Gewalthaber waren unsicher geworden, und das nutzten wir aus. Ich begann zuzuschlagen, erst sanft, dann stärker, immer stärker, andere folgten... S. J. riskierte das. Dann strudelte der November über uns zusammen. [...]
Vom 1. April 1918 hießen wir nicht mehr 'Die Schaubühne', sondern 'Die Weltbühne', und ich glaube, daß wir diesen Namen gerechtfertigt haben. Zunächst galt es, die vier Jahre erzwungenen Schweigens nachzuholen. Ich begann mit einer Artikelserie "Offizier und Mann", und nun ging es los. Die Wirkung war beispiellos. Broschüren und Bücher erschienen gegen uns; das Blatt war so verhaßt, wie es beliebt war, und das wollte etwas heißen. [...]
Das Theater ließ Jacobsohn nie außer Acht, nun grade nicht, nun grade nicht. 'Verbiete du, dem Seidenwurm zu spinnen', sagte er, wenn ich zweifelte. Erst in den allerletzten Jahren hat das nachgelassen: 'Wozu soll ich etwas mit Liebe betrachten, was ohne Liebe gemacht ist', pflegte er zu sagen. In diesen Nachkriegsjahren hat die Weltbühne in Deutschland gute Reinigungsarbeit getan.
Wir haben uns einige Male den tragischen Spaß gemacht - nach dem Kapp- Putsch, nach der Ermordung Rathenaus -, unsre Voraussagen zusammenzu- stellen: es war erschreckend. Was die Berufspolitiker, diese berufsmäßig Blinden, mit wegwerfendem Pusten durch die Nase abzutun geglaubt hatten, das war fast immer blutige Realität geworden; wir hatten traurig Recht behalten. Jene wußten viel mehr Einzelheiten als wir, aber sie fühlten nichts. Am Zeiger- blatt der Weltbühne kann man die Geschichte der Nachkriegszeit ablesen.
[...]
Siegfried Jacobsohn hat für seine Leute immer den Kopf hingehalten, für sie und für die Sache, die sein Leben gewesen ist. (Anm: Hauptsatz wurde von der Verfasserin leicht abgeändert.)
Am 3. Dezember 1926 ist er gestorben. Carl von Ossietzky, der schon am 20. April 1926 zum Blatt gekommen ist, und ich halten sein Erbe in Händen. [...]
Die Weltbühne hat immer zwei gewichtige Gegenpole gehabt: die Parteien und die große Presse.
Was die Parteien angeht, so ist der Deutsche gern da individualistisch, wo es das zu sein sich gar nicht verlohnt, und da kollektivistisch, wo andre ihr Privat- herz zu sitzen haben. Er verlangt gern von 'seinem' Blatt, daß es 'Farbe bekennt'.
Nun, die Weltbühne ist zunächst nicht ein Blatt, das vom Leser redigiert wird. 'Sie haben nur ein Recht: mein Blatt nicht zu lesen', sagte S. J. Und schrieb einst an einen verdienten Mann, der in einer Gefühlsaufwallung die Weltbühne abbestellte: 'Da verlieren Sie mehr als ich.'
So sehr wir mit der Leserschaft in Verbindung stehen: wir haben ihr niemals das Recht eingeräumt, durch Druck oder Drohung, durch Empfehlung oder Anwendung jener legendären 'Beziehungen' unsre Haltung zu beeinflussen. Ich für meinen Teil kann aufhören, zu schreiben - aber ich könnte, solange ich schreibe, es nicht nach dem Diktat eines Verlegers tun. 'Dies', sagte der Verle- ger, der seine Zeitung verkaufen wollte, 'ist der Maschinensaal...hier sind die Verlagsräume... sehen Sie, das ist die Expedition... hier ist die Anzeigenan- nahme - und das da, ach Gott: das ist bloß die Redaktion.'
Das Blatt ist unabhängig geblieben, und wenn wir Fehler machten: dann machen wir wenigstens unsre Fehler.
[...]
Welchen Einfluß hat zunächst die Weltbühne? Soweit ich das im Laufe von siebzehn Jahren zu beurteilen gelernt habe: einen mittelbaren. Durch tausend Netzkanälchen laufen aus dieser Quelle Anregungen, Formulierungen, Weltbil- der, Tendenzen und Willensströmungen ins Reich - wir folgen hier ganz und gar S. J., der niemals übel genommen hat, wenn man ihn benutzte, nachdruck- te, ja sogar ausplünderte: 'Wenn nur das Gute unter die Leute dringt.' Und es gibt heute schon eine Reihe vernünftiger und mutiger Provinzredakteure, [...] sie fangen nicht ohne eignes Risiko die Bälle auf, die von hier aus geschleudert werden, und geben sie weiter. [...]
Sicherlich hat die Weltbühne Anständigkeit und Unabhängigkeit nicht gepachtet. Die kindliche Zeitungsgewohnheit, so zu tun, als sei man mit seinem Blatt ganz allein auf der Welt, und den Leser um Gottes willen nicht wissen zu lassen, daß es auch noch andre vernünftige und tapfre Leute gibt, haben wir nie mitgemacht. Man kann in vielen Fällen widereinander streiten, wenn es die Sache erfordert - die Zeit der Literaturpolemik alten Stils ist vorüber.
Immerhin haben wir auf unserm Gebiet vor den großen Blättern eines voraus: die Freiheit.
Auch eine Wochenschrift hat ihre Traditionen und ihre moralischen Gebundenheiten, ihre Freundschaften und ihre Feindschaften. Aber erstens sind die hier der Zahl nach, absolut und relativ, kleiner als anderswo, und zweitens kann ich mich auf keinen Fall besinnen, wo wir aus jenem flauen Gefühl: 'Das kann man doch nicht...' geschwiegen hätten. Wenn uns S. J. nichts vererbt hätte: seine Zivilcourage haben wir übernommen.
Sie wirkt sich aus. [...]
Unser moralischer Wirkungskreis ist erfreulich groß; der merkantile ständig im Wachsen. (Er ist heute weit größer, als er jemals unter S. J. gewesen ist; die Zeit braucht solche Blätter.)
Ich mag das Spiel nicht mitspielen, das darin besteht, die eigne Leserschaft für die Aristokratie des Geistes zu erklären, eine billige Art der Abonnentenwer- bung. Aber es sind gute Leute unter denen, die in jeder mittlern und kleinen Stadt die 'Weltbühne' lesen - sie haben sich zum Glück noch kein Knopfloch- Abzeichen ausgedacht, das sie tragen, doch könnten sie sich in jedem Gespräch erkennen. Durch Unabhängigkeit des Urteils, durch Sinn für Humor, durch Freude an der Sauberkeit.
Und durch einen Glauben an die Sache, der auch bei uns unbeirrbar steht.
Jedes Blatt hat seine Lücken, seine Versager, seine schwachen und seine starken Zeiten. Eins aber ist sicher.
Solange die Weltbühne die Weltbühne bleibt, solange wird hier gegeben, was wir haben. Und was gegeben wird, soll der guten Sache dienen: dem von keiner Macht zu beeinflussenden Drang, aus Teutschland Deutschland zu machen und zu zeigen, daß es außer Hitler, Hugenberg und dem fischkalten Universitätstypus des Jahres 1930 noch andre Deutsche gibt. Jeder Leser kann daran mitarbeiten.
Tut er es in seinem Kreise durch die Tat: es ist unser schönster Lohn. In diesem Blatt sind wir frei und sind wir ganz; auch uns ist die Weltbühne im Andenken an Siegfried Jacobsohn: 'unser geronnenes Herzblut'."1
11.2 Bernt Engelmann: Zur Rolle der Medien
"Die überregionale Presse hatte damals eine weit geringere Bedeutung als heute; ihre Leserschaft beschränkte sich auf das gebildete Bürgertum. Die allermeisten Deutschen lasen eine örtliche Tageszeitung, meist des scheinbar parteipolitisch neutralen 'Generalanzeiger'-Typs. Boulevard-Blätter gab es fast nur in Berlin, und die Parteipresse, vor allem der SPD, erreichte nur die organi- sierten Anhänger.
Den weitaus größten Einfluß auf die öffentliche Meinung in Deutschland hatte während der ganzen Dauer der 'Weimarer Republik' ein gewaltiger Pressekon- zern, von dessen Vorhandensein, erst recht von dessen Größe, Arbeitsweise und Macht, die allermeisten Deutschen überhaupt nichts wußten. Im Gegensatz zu den bekannten Berliner Verlagshäusern Ullstein und Mosse, deren Morgen- zeitungen, Boulevardblätter und Abendausgaben fast nur in der Reichshaupt- stadt und ihrer näheren Umgebung verbreitet waren, hatte jener große Presse- konzern, dessen Holding den seltsamen Namen 'Opriba' führte, seinen Einfluß vor allem außerhalb Berlins. Er beherrschte die Presse der Mittel- und Klein- städte und des flachen Landes, besonders in Nord-, Ost- und Mitteldeutschland, in etwas geringerem Maße aber auch überall sonst, wo kleinere, bürgerliche Blätter und 'neutrale' Heimatzeitungen erschienen.
Doch auch in Berlin hatte dieser Konzern einen ihm gehörenden großen Zeitungsverlag, die August Scherl GmbH. Dort erschienen der 'Berliner Lokalanzeiger', 'Der Tag' und die 'Berliner Nachtausgabe', ferner Zeitschriften wie 'Die Gartenlaube' und 'Die Woche'.
Sodann war dem Opriba-Konzern die 'Telegraphen-Union' (TU) angeschlossen, damals die zweitgrößte Nachrichtenagentur des Reiches, ferner die 'Ala'-Anzei- gen-AG, die einen sehr bedeutenden Anteil am gesamten Anzeigengeschäft der Wirtschaft hatte. Dazu kam die 'Vera'-Verlagsanstalt, die Beteiligung an einigen hundert Provinzzeitungen hielt und ihnen mit der täglichen Lieferung fertig gematerter Seiten die Mühe abnahm, über anderes als Lokales in der eigenen Redaktion nachzudenken und zu berichten.
Schließlich gehörten zum Opriba-Konzern auch noch zwei Institute, 'Mutuum' und 'Altertum', die konzernfremden, noch unabhängigen Zeitungsverlegern (und gelegentlich auch Redakteuren oder wichtigen Mitarbeitern noch nicht vom Konzern kontrollierter Blätter) finanzielle Hilfe gewährten und sie so nach und nach in immer größere Abhängigkeit von der Opriba brachten. Zusammen bildeten TU, 'Ala', 'Vera', 'Mutuum' und 'Altertum' ein Netz, in dessen aus Nachrichten, Anzeigenaufträgen, fertigen Seiten, Krediten, Darle- hen und Beteiligungen gestrickten Maschen mehr als die Hälfte der deutschen Presse gefangen war. Und welcher Kurs diesen Zeitungen und Zeitschriften vorgeschrieben war, läßt sich leicht erraten, wenn man weiß, wer die Opriba - das Kunstwort für Ostdeutsche Privatbank - vollständig beherrschte: Es war der Geheimrat Alfred Hugenberg, der schon 1891 den Alldeutschen Verband mitbe- gründet hatte. Von 1909 bis 1918 war er Generaldirektor des Krupp-Konzerns, anschließend deutschnationaler, dem ultrarechten Flügel zugehöriger, Reichs- tagsabgeordneter. Um die Mitte der zwanziger Jahre kontrollierte Hugenberg mindestens zwei Drittel der gesamten deutschen Presse. Angegliedert an diesen Pressekonzern war die 'Ufa', damals Deutschlands größte Filmherstel- lungs- und Vertriebsgesellschaft. So wurde jemand, der keine Zeitung las, sondern lieber ins Kino ging, zunächst mit einer 'Ufa'-Wochenschau, sodann mit einem 'Ufa'-Kulturfilm auf einen Hugenberg genehmen Kurs getrimmt, ehe er den abendfüllenden 'Ufa'-Hauptfilm, nicht selten auch dieser mit strammdeut- schnationaler Tendenz, zu sehen bekam.
Hinter Hugenberg standen noch andere Repräsentanten der Schwerindustrie und des Ruhrkohlebergbaus. Einige davon hatten ebenfalls eigene Presseorga- ne, meist bedeutende Blätter. So war z.B. Hugo Stinnes Besitzer der 'Deut- schen Allgemeinen Zeitung', der 'Industrie- und Handelszeitung', des Witzblat- tes 'Kladderadatsch' und der 'Frankfurter Nachrichten'; der IG-Farben Konzern hatte sich einen starken Einfluß auf die 'Frankfurter Zeitung' gesichert; der Gutehoffnungshütte-Konzern war erheblich an den 'Münchner Neuesten Nachrichten' beteiligt und der Großindustrielle Otto Wolff finanzierte das führende Zentrumsblatt 'Kölnische Volkszeitung' und die nationalliberale 'Zeit'. Rechnet man noch die ultrarechten bis nationalliberalen Parteiorgane sowie die ebenfalls rechtsstehende Kirchenpresse hinzu, dann waren in den Jahren der Weimarer Republik weit über drei Viertel der deutschen Zeitungen und Zeitschriften extrem antisozialistisch, entschieden SPD- und gewerkschafts- feindlich sowie in Opposition zur parlamentarischen Demokratie und zur Weimarer Republik.
Gewiß, es gab auch einige bürgerlich-liberale, republikfreundliche, für Verständigung und Entspannung eintretende Zeitungen sowie eine sozialdemokratische Parteipresse und eine Anzahl KPD-Organe, ferner ein paar bedeutende linke Zeitschriften wie beispielsweise die 'Weltbühne'."1
11.3 Dänische Felder
Da liegen sie: sonnenüberglänzter Wind geht drüber hin, die Grasbüschel werden hin- und hergerissen, pflaumenblau ziehen sich da hinten Wälder. Die Chaussee läuft ein Stückchen bergan, dann ist sie grade von der Kuppe abgeschnitten und führt also scheinbar in den Himmel. Zwei solcher Treppen gibt es in Versailles...
So hat doch diese dänische Landschaft auch im Jahre 1917 hier gestanden? Natürlich - warum denn nicht? Die da führte keinen Krieg.
Die Bäume durften Bäume sein - niemand schoß sie zusam- men. Über die Grasflächen stampfte keine lange Schlange von Marschierenden. Die Wege wurden nicht von ratternder, schimp- fender, polternder Artillerie aufgeweicht und verdorben. Diese Landschaft war reklamiert.
Hergott in Dänemark, welch ein Wahnsinn! Hier war Mord:
Mord, dort war Mord ein von den Schmöcken, den Generälen und den Feldpredigern besungenes Pflichtereignis. Hier durfte man nicht - da mußte man.
Und so selbstverständlich, wie die Mücken tanzen, so selbst- verständlich ist den Mördern und ihren Kindern Untat, Fortsetzung der Untat und Propagierung der Untat. Es geschieht so viel für die Erotik. Es gibt Anreiz, Mode und Tanz, bunte Farben und Porno- graphie. Es geschieht so wenig gegen den nächsten Krieg, bei dem euch die Gedärme, so zu hoffen steht, auch in den Städten über die Stuhllehne hängen werden. Es müßte jeden Abend in den Films laufen, wie es gewesen ist, das mit dem Sterben. Möge das Gas in die Spielstuben eurer Kinder schleichen. Mögen sie langsam umsinken, die Püppchen. Ich wünsche der Frau des Kirchenrats und des Chefredakteurs und der Mutter des Bildhauers und der Schwester des Bankiers, daß sie einen bittern qualvollen Tod finden, alle zusammen. Weil sie es so wollen, ohne es zu wollen. Weil sie faul sind. Weil sie nicht hören und nicht sehen und nicht fühlen.
Wer aber sein Vaterland im Stich läßt in dieser Stunde, der sei gesegnet. Er habe seine schönsten Stunden in einer dänischen Landschaft.1
[...]
1 Ignaz Wrobel., WB, 1.10.1929, Nr. 40, S. 514.
1 Kurt Tucholsky, WB, 9.09.1930, Nr. 37, S.373.
2 Hepp, Michael: Kurt Tucholsky. Biographische Annäherungen. Reinbek bei Hamburg 1993, S.72.
1 Hepp, S. 78.
2 K.T., WB, 27.12.1927, Nr. 52, S. 964.
3 Hepp, S. 93.
4 I.W., WB, 30.03.1926, Nr.13, S. 489.
1 Hepp, S. 185.
2 Hepp, S. 260.
3 K.T., WB, 29.11.1927, Nr. 48, S. 811.
1 Hepp, S. 302.
2 Hepp, S. 304.
1 K.T., WB, 9.10.1930, Nr. 37, S. 374.
2 K.T., WB, 9.10.1930, Nr. 37, S. 374f.
1 Berkholz, Stefan: "Du bist die Ausnahme." Die Briefe Siegfried Jacobsohn an Kurt Tucholsky erschrecken, weil sie hellsichtig sind. In. Die Zeit, Nr. 8, 16. 02.1990.
2 K.T., WB, 9.10.1930, Nr. 37, S. 375f.
3 K.T., WB, 9.10.1930, Nr. 37, S. 377.
1 K.T., WB, 9.10.1930, Nr. 37, S. 378.
2 K.T., WB, 9.10.1930, Nr. 37, S. 379.
3 K.T., WB, 9.10.1930, Nr. 37, S. 380f.
4 K.T., WB, 9.10.1930, Nr. 37, S. 382.
1 K.T., WB, 9.10.1930, Nr. 37, S. 382.
1 Madrasch-Groschopp, Ursula: Die Weltbühne. Porträt einer Zeitschrift. Königstein/Taunus 1983, S.293.
2 Kurt Tucholsky, zitiert nach Madrasch-Groschopp, Ursula: Die Weltbühne, S.34.
1 Mommsen, Hans: Die verspielte Freiheit. Der Weg der Republik von Weimar in den Untergang. Frankfurt am Main, Berlin 1990, S. 22f.
2 Mommsen, S. 22f.
1 Engelmann, Bernt: Wir Untertanen; Deutsches Anti-Geschichtsbuch; Teil 1, S. 350.
2 Engelmann, Bernt: Einig gegen Recht und Freiheit. Deutsches Anti-Geschichtsbuch 2. Teil. Frankfurt am Main 1974, S. 14.
3 Krockow, Christian Graf von: Die Deutschen in ihrem Jahrhundert 1890-1990; Reinbek b. Hamburg 1992, S. 117.
4 Hepp, S.158.
1 Hepp, S. 159.
2 Groener, Wilhelm zitiert nach: Tenbrock, Dr. R. H., Kluxen, Prof. Dr. K. , Stier, Prof. Dr. H. E. (Hrsg.): Zeiten und Menschen; Geschichtliches Unterrichtswerk Oberstufe, Paderborn 1970, S. 322.
1 Mommsen, S. 64.
2 Engelmann, Bernt: Einig gegen Recht und Freiheit, S.22.
1 zitiert nach: Seligmann, Michael: Aufstand der Räte. Die erste bayerische Räterepublik vom 7. April 1919. Grafenau 1989, S. 58.
1 Seligmann, Michael: Aufstand der Räte. S. 73.
1 Hermand/Trommler: Die Kultur der Weimarer Republik. München 1978. S. 37.
2 Stark, Michael: Für und wider den Expressionismus. Die Entstehung der Intellektuellendebatte in der deutschen Literaturgeschichte. Stuttgart 1982. S. 26.
3 Stark, Michael: Für und wider den Expressionismus. S. 29.
4 Haug, Wolfgang (1992): Die Beziehungen von Anarchismus und Expressionismus am Beispiel Erich Mühsams. In: IWK Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Heft 4, S. 511.
5 Haug, Wolfgang (Hrsg.): Ludwig Rubiner Künstler bauen Barrikaden. Texte und Manifeste 1908-1919. Darmstadt 1988. S. 16.
1 Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart 19897.
2 Hermand/Trommler: Die Kultur der Weimarer Republik; S. 37.
1 I. W., WB, 20.02.1919, Nr. 9, S. 203.
1 I. W., WB, 17.10.1918, Nr. 42, S. 357ff.
2 Vogel, Harald: Tucholsky lesen. Ein Lesebuch mit kommentierenden Lesezeichen. Hohengehren 1994, S.170.
3 Hepp, S. 172.
4 Hepp, S. 174.
1 I. W., WB, 09.01.1919, Nr. 2, S. 41.
2 ebenda.
3 I. W., WB, 30.01.1919, Nr. 5, S. 112.
4 I. W., WB, 06.02.1919, Nr. 6, S. 136.
2 ebenda.
1 I. W., WB, 13.02.1919, Nr. 7/8, S. 159.
2 I. W., WB, 20.02.1919, Nr. 9, S. 201.
3 I. W., WB 20.02.1919, Nr. 9, S. 202.
4 Heinrich Mann, zitiert nach: I.W., WB, 28.03.1919, Nr. 13, S. 317.
5 I. W., WB, 20.02.1919, Nr. 9, S. 205.
1 I. W., WB, 14.08.1919, Nr. 30, S. 194.
2 K.T., zitiert nach:Vogel, Harald: Tucholsky lesen; S. 167.
3 I. W., WB, 14.08.1919, Nr. 30, S. 199.
1 I. W., WB, 16.10.1919, Nr. 43, S. 475.
2 I. W., WB, 16.10.1919, Nr. 43, S. 475.
3 I. W., WB, 18.12.1919, Nr. 52, S. 755.
4 I. W., WB, 18.12.1919, Nr. 52, S. 757.
1 I. W., WB, 18.12.1919, Nr. 52, S. 758.
2 ebenda.
3 I. W., WB, 18.12.1919, Nr. 52, S. 759.
2 ebenda.
1 Gietinger, Klaus (1992): Nachträge, betreffend Aufklärung der Umstände, unter denen Frau Dr. Rosa Luxemburg den Tod gefunden hat. In: IWK Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Heft 3, S. 361.
1 Gietinger, Klaus: Nachträge, S. 361.
2 Gietinger, Klaus: Nachträge, S. 339.
3 Gietinger, Klaus: Nachträge, S. 341.
1 I. W., WB, 15.05.1919, Nr. 21, S. 565.
2 I. W., WB, 15.05.1919, Nr. 21, S. 565f.
3 I. W., WB, 15.05.1919, Nr. 21, S. 566.
1 I .W., WB, 15.05.1919, Nr. 21, S. 566.
2 I. W., WB, 15.05.1919, Nr. 21, S. 568.
1 I. W., WB, 15.05.1919, Nr. 21, S. 568.
1 Engelmann, Bernt: Einig gegen Recht und Freiheit, S. 67.
2 Mommsen, S. 95.
1 Mommsen, S. 139.
1 Hepp, S. 198.
2 Schwabe, Klaus: Der Weg der Republik vom Kapp-Putsch 1920 bis zum Scheitern des Kabinetts Müller 1930, S. 115; In: Bracher/Funke/Jacobsen (Hrsg.): Die Weimarer Republik 1918-1933 Politik. Wirtschaft Gesellschaft; Bonn 1987.
1 Ernst Bloch zitiert nach: Stark, Michael: Für und wider den Expressionismus. S. 226.
2 Gerold-Tucholsky, Mary, Raddatz, Fritz J. (Hrsg.); Kurt Tucholsky. Schnipsel. Reinbek bei Hamburg 1994, S.134.
3 I. W., WB, 25.03.1920, Nr. 12-14, S. 357.
1 I. W., WB, 25.03.1920, Nr. 12-14, S. 361.
1 I. W., WB, 25.03.1920, Nr. 12-14, S. 361ff.
2 I. W., WB, 25.03.1920, Nr. 12-14, S. 363.
3 I. W., WB, 22.04.1920, Nr. 17, S. 470.
4 Hepp, S. 191.
1 I. W., WB, 08.09.1921, Nr. 36, S. 240.
2 I. W., WB, 08.09.1921, Nr. 36, S. 241.
3 I. W., WB, 08.09.1921, Nr. 36, S. 242.
1 I. W., WB, 23.02.1922, Nr. 8, S. 203.
2 I. W., WB, 23.02.1922, Nr. 8, S. 203.
3 ebenda.
4 ebenda.
5 ebenda.
2 I. W., WB, 23.02.1922, Nr. 8, S. 203.
3 ebenda.
4 ebenda.
3 ebenda.
4 ebenda.
4 ebenda.
1 I. W., WB, 23.02.1922, Nr. 8, S. 203.
3 ebenda.
3 I. W., WB, 23.02.1922, Nr. 8, S. 203.
1 K. T., WB, 22.06.1922, Nr. 25, S. 617.
2 K. T., WB, 22.06.1922, Nr. 25, S. 616.
3 Hepp, S. 233.
1 I. W., WB, 13.07.1922, Nr. 28, S. 29.
2 I. W., WB, 13.07.1922, Nr. 28, S. 30.
3 Hepp, S. 235. [...]: die Masse, von den Kapellen geführt, sang
1 Hepp, S. 235.
2 Hepp, S. 237.
1 I. W., WB, 21.06.1923, Nr. 25, S. 730.
2 I. W., WB, 21.06.1923, Nr. 25, S. 731.
3 I. W., WB, 21.06.1923, Nr. 25, S. 732.
4 I. W., WB, 26.07.1923, Nr. 30, S. 79.
1 I. W., WB, 26.07.1923, Nr. 30, S. 82.
2 I. W., WB, 26.07.1923, Nr. 30, S. 83.
3 Hepp, S. 257.
1 I.W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 241.
1 siehe dazu I.W. "Eindrücke von einer Reise" WB. 2. Hj. 1919, S. 473 und I.W. "In der Provinz" GW. 2. S. 327.
2 I. W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 243.
3 ebenda.
4 Goldhagen, Daniel Jonah: Das Versagen der Kritiker. In: Die Zeit, Nr. 32, 2. August 1996, S. 9.
2 I. W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 243.
1 I.W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 244.
2 I.W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 241.
2 I.W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 241.
1 siehe dazu S. 33 dieser Arbeit, das Gute ist das "Fortstrebende", das Schlechte das "Zurückziehende".
2 I.W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 245.
1 I.W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 245.
3 I.W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 244.
4 I.W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 245.
1 Engelmann, Bernt: Einig gegen Recht und Freiheit , S. 97.
2 Mommsen, S. 244f.
1 Engelmann, Bernt: Einig gegen Recht und Freiheit, S. 113.
1 Hermand/Trommler: Die Kultur der Weimarer Republik. S. 47.
1 Schnipsel, S. 139.
2 Hepp, S. 166 (Quelle anhand der Fußnote nicht eindeutig zu bestimmen).
1 I. W., WB, 05.06.1924, Nr. 23, S. 768.
2 ebenda.
3 I. W., WB, 05.06.1924, Nr. 23, S. 769.
2 ebenda.
1 ebenda.
2 I. W., WB, 05.06.1924, Nr. 23, S. 770.
3 I. W., WB, 28.07.1924, Nr. 32, S. 218.
1 I. W., WB, 28.07.1924, Nr. 32, S. 220.
2 I. W., WB, 28.07.1924, Nr. 32, S. 221.
3 I. W., WB, 28.07.1924, Nr. 32, S. 222.
5 Sontheimer, Kurt: Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. München 1992, S. 305.
1 I. W., WB, 16.10.1924, Nr. 42, S. 573.
2 I. W., WB, 18.11.1924, Nr. 47, S. 760.
1 ebenda.
2 Engelmann, Bernt: Wir Untertanen, S. 358.
3 I. W., WB, 18.11.1924, Nr. 47, S. 761.
1 I. W., WB, 18.11.1924, Nr. 47, S. 762.
2 I. W., WB, 18.11.1924, Nr. 47, S. 762f.
1 I. W., WB, 10.02.1925, Nr. 6, S. 187.
2 I. W., WB, 10.02.1925, Nr. 6, S. 189.
3 I. W., WB, 24.03.1925, Nr. 126, S. 427.
1 I. W., WB, 24.03.1925, Nr. 126, S. 428.
2 I. W., WB, 24.03.1925, Nr. 126, S. 428.
1 I. W., WB, 24.03.1925, Nr. 126, S. 428.
1 I. W., WB, 24.03.1925, Nr. 126, S. 428f.
2 I. W., WB, 24.03.1925, Nr. 126, S. 429.
3 I. W., WB, 24.03.1925, Nr. 126, S. 429.
1 I. W., WB, 05.05.1925, Nr. 18, S. 645.
1 I. W., WB, 05.05.1925, Nr. 18, S. 645.
2 I. W., WB, 05.05.1925, Nr. 18, S. 646f.
3 I. W., WB, 05.05.1925, Nr. 18, S. 647.
4 I. W., WB, 05.05.1925, Nr. 18, S. 647f.
1 I. W., WB, 05.05.1925, Nr. 18, S. 648.
2 I. W., WB, 15.12.1925, Nr. 50, S. 893.
1 I. W., WB, 15.12.1925, Nr. 50, S. 893.
1 I. W., WB, 15.12.1925, Nr. 50, S. 894.
2 I. W., WB, 15.12.1925, Nr. 50, S. 895.
1 Prescher, Hans: Kurt Tucholsky. Berlin 1982, S. 47.
2 I. W., WB, 14.09.1926, Nr. 37, S.414.
1 I. W., WB, 14.09.1926, Nr. 37, S. 415.
2 I. W., WB, 12.04.1927, Nr. 15, S. 583.
3 I. W., WB, 12.04.1927, Nr. 15, S. 582.
1 I. W., WB, 19.04.1927, Nr. 16, S. 623.
2 I. W., WB, 26.04.1927, Nr. 17, S. 666.
3 I. W., WB, 12.04.1927, Nr. 15, S. 584.
4 I. W., WB, 19.04.1927, Nr. 16, S. 623.
1 I. W., WB, 31.01.1928, Nr. 5, S.163.
2 I. W., WB, 31.01.1928, Nr. 5, S.168.
3 I. W., WB, 31.01.1928, Nr. 5, S.169.
1 I. W., WB, 31.01.1928, Nr. 5, S.170.
2 ebenda.
3 I. W., WB, 30.10.1928, Nr. 44, S. 664.
1 I. W., WB, 27.11.1928, Nr. 48, S. 810.
2 I. W., WB, 27.11.1928, Nr. 48, S. 810.
3 I. W., WB, 27.11.1928, Nr. 48, S. 811.
1 Prescher, S. 64.
1 Zitiert aus einem Fax a. d. Verfin. von Prof. Dr. H.-W. am Zehnhoff, Brüssel, Mitglied der Kurt-Tucholsky-Gesell- schaft.
1 ebenda.
1 I. W., WB, 18.11.1924, Nr.47, S. 759.
1 I. W., WB, 28.07.1924, Nr. 5, S. 218.
1 K. T. zitiert nach: Vogel, Harald: Tucholsky lesen; S. 168.
1 Sontheimer, S. 304.
1 ebenda.
2 Weigel, Hans: Das Land der Deutschen mit der Seele suchend. Bericht über eine ambivalente Beziehung. Zürich 1983, S. 237.
1 Weigel, S. 237f.
1 Mommsen, S. 295f.
2 Mommsen, S. 298.
1 Mommsen, S. 320.
2 Engelmann, Bernt: Einig gegen Recht und Freiheit, S. 130.
3 Mommsen, S. 320.
1 Mommsen, S. 372.
1 Hepp, S. 339.
1 Mommsen, S. 527.
1 Hermand/Trommler: Die Kultur der Weimarer Republik; S. 96.
3 ders: Wieszt, Jozsef: KPD-Politik in der Krise 1928-1932. Zur Geschichte und Problematik des Versuchs, den Kampf gegen den Faschismus mittels Sozialfaschismusthese und RGO-Politik zu führen. Frankfurt am Main 1976. S. 574.
1 Hermand/Trommler: Die Kultur der Weimarer Republik; S. 104.
2 Sontheimer, S. 304.
103
1 Hermand/Trommler: Die Kultur der Weimarer Republik; S. 106f.
1 Gerold-Tucholsky, Mary u. Raddatz, Fritz J.(Hrsg.): Kurt Tucholsky. Ausgewählte Briefe 1913-1935. Reinbek bei Hamburg 1962, S. 248.
2 I. W., WB, 13.05.1930, Nr. 20, S. 719.
1 ebenda.
2 I. W., WB, 13.05.1930, Nr. 20, S. 720.
3 I. W., WB, 13.05.1930, Nr. 20, S. 722.
1 Leonhardt, Rudolf Walter: Kästner für Erwachsene. Zürich 1966, S. 430.
2 I. W., WB, 17.02.1931, Nr. 7, S.241.
3 I. W., WB, 17.02.1931, Nr. 7, S.241.
1 I. W., WB, 07.04.1931, Nr.14, S. 497.
2 I. W., WB, 07.04.1931, Nr.14, S. 499.
3 I. W., WB, 07.04.1931, Nr.14, S. 500.
1 I. W., WB, 07.04.1931, Nr.14, S. 500.
1 I. W., WB, 01.04.1930, Nr. 14, S. 499.
3 I. W., WB, 01.04.1930, Nr. 14, S. 499.
4 I. W., WB, 01.04.1930, Nr. 14, S. 499f.
1 I. W., WB, 01.04.1930, Nr. 14, S. 499f.
2 I. W., WB, 01.04.1930, Nr. 14, S. 500.
3 I. W., WB, 01.04.1930, Nr. 14, S. 502.
1 Ministerium für Kultus und Sport Baden Württemberg (Hrsg.): Bildungsplan für die Hauptschule. Lehrplanheft 2/1994, S. 265.
1 I.W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 241.
1 siehe dazu I.W. "Eindrücke von einer Reise" WB. 2. Hj. 1919, S. 473 und I.W. "In der Provinz" GW. 2. S. 327.
3 ebenda
1 Goldhagen, Daniel Jonah: Das Versagen der Kritiker. In: Die Zeit, Nr. 32, 2. August 1996, S. 9.
2 I.W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 244.
1 I.W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 241.
3 siehe dazu S. 33 dieser Arbeit, das Gute ist das "Fortstrebende", das Schlechte das "Zurückziehende"
1 I.W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 245.
2 ebenda
3 I.W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 245.
4 I.W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 241.
5 I.W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 244.
1 I.W., WB, 19.02.1920, Nr. 8, S. 245.
1 K.T., WB, 9.10.1930, Nr. 37, S. 373ff.
1 Engelmann, Bernt: Einig gegen Recht und Freiheit, S. 84.
1 I. W., WB, 26.07.1927, Nr. 30, S.152f.
- Arbeit zitieren
- Antje Kopp (Autor:in), 1996, Kurt Tucholsky - Die Warnungen des Ignaz Wrobel in der Weltbühne, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108552
Kostenlos Autor werden







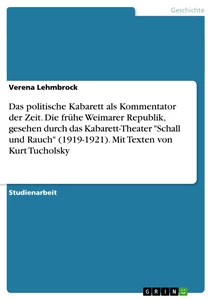
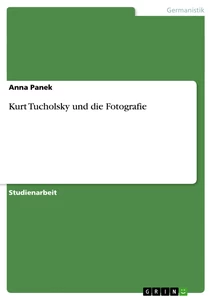



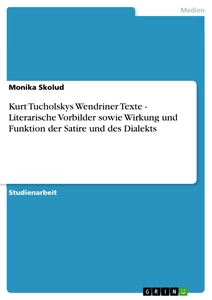







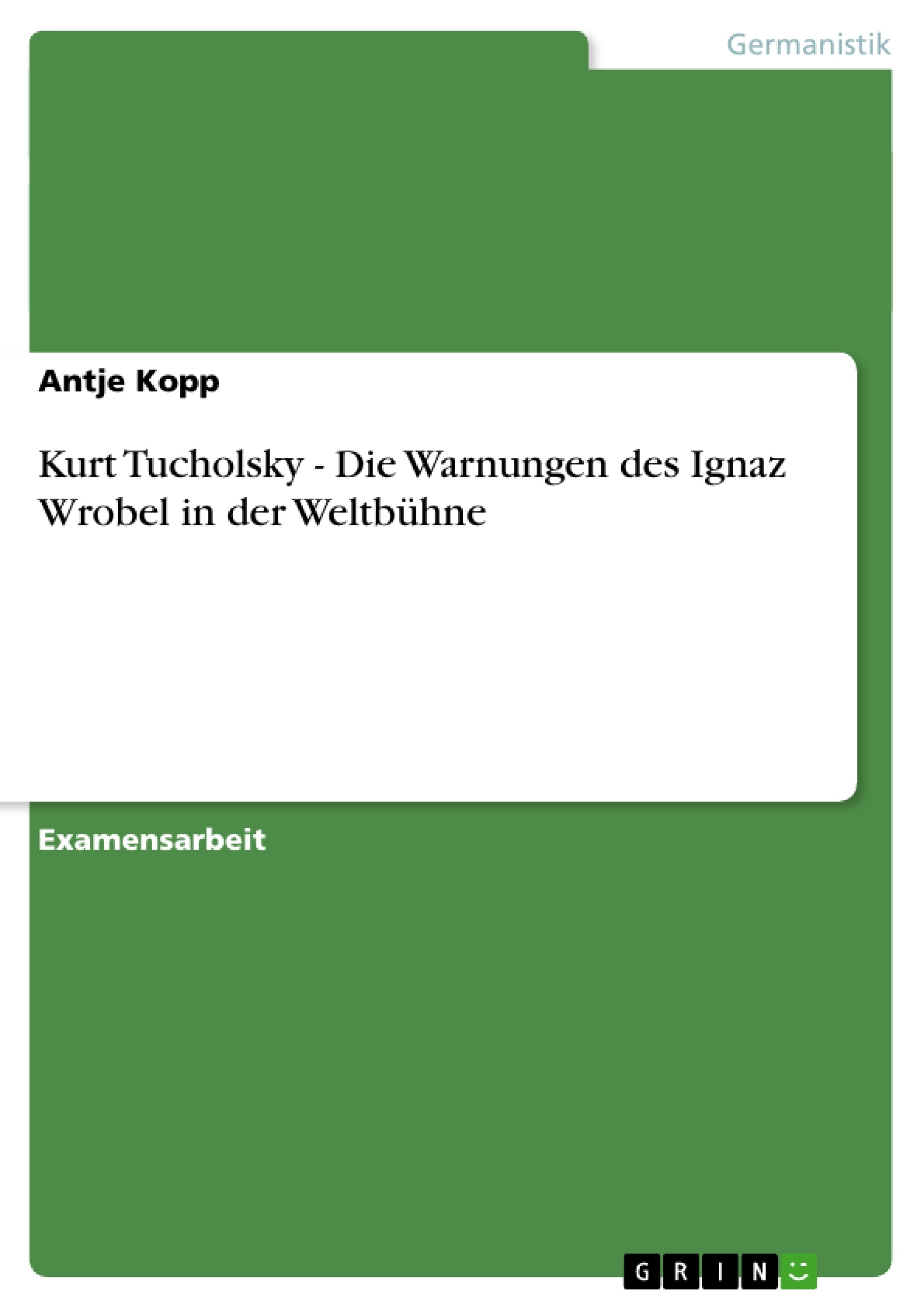

Kommentare