Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung
1. Wahrnehmung und Lernen
1.1. Zur Biologie des Lernens
1.1.1. Wie gelangt eine Information ins Langzeitgedächtniss?
1.1.2. Wahrnehmungstypologie
1.2. Zur Psychologie der Wahrnehmung
1.2.1. Figur-Grund-Gliederung
1.2.2. Übersummativität und Transponierbarkeit
1.2.3. Gleichheit
1.2.4. Nähe
1.2.5. Geschlossenheit
1.2.6. Symmetrie
1.2.7. Kontext und Erfahrung
1.2.8. Anmutungsqualität
1.3. Gestaltungsgrundlagen für Präsentationsmedien
1.3.1. Layout
1.3.2. Schrift und Typographie
1.3.3. Farben, Grafiken und Bilder
2. Medien der Präsentation und Moderation
2.1. Schriftliche Unterlage
2.2. Grundidee „Tafel“
2.2.1. Schultafel
2.2.2. Flipchart
2.2.3. Pinnwand
2.2.4. White Board/Copy Board
2.3. Grundidee „Projektor“
2.3.1. Diaprojektor
2.3.2. Overheadprojektor
2.3.3. Beamer
2.4. Smartboard
3. Präsentation und Moderation
3.1. Differenzierung von Präsentation und Moderation
3.1.1. Präsentation
3.1.2. Moderation
3.2. Methoden der Präsentation und Moderation
3.2.1. Referat und Vortrag
3.2.2. Klassische Moderationstechniken
3.2.3. Kreativitätsförderung
3.2.4. Konfliktlösung
4. Praxisfeld „Berufliche Weiterbildung“
4.1. Definition und Trendanalyse
4.2. Exemplarischer Seminarablauf
4.2.1. Informelle Zeiteinheiten
4.2.2. Arbeitseinheit
5. Resümee
Quellenverzeichnis
0. Einleitung
Präsentation und Moderation sind die existenziellen Elemente der beruflichen Weiterbildung. Die Qualität der Fähigkeiten eines Se- minarleiters in den Bereichen der Präsentation und Moderation definieren die Qualität der Weiterbildungsmaßnahme. Um effektiv die hohe Qualität einer Weiterbildungsmaßnahme zu erreichen, bedarf es vor der expliziten Vorbereitung einschlägiger Fachkenntnisse. Fachkenntnisse bezüglich der Aufnahme- und Lernprozesse des Menschen, sowie Fachkenntnisse bezüglich der Medienvielfalt und ihrer Einsatzmöglichkeiten.
Das erste Kapitel dieser Arbeit erläutert den biologischen Vorgang des Lernens, sowie die bevorzugten Wahrnehmungskanäle der Menschen, aus denen sich eine Wahrnehmungstypologie ableiten lässt. Der zweite Abschnitt beschreibt die psychologischen Pro- zesse der Wahrnehmung, Gesetzmäßigkeiten denen jeder gesun- de Mensch folgt. Sie liefern die Grundlagen zur Gestaltung des Layouts und der Typographie von Präsentations- und Moderati- onsmedien, welche im dritten Abschnitt des ersten Kapitels Formulierung finden.
Das zweite Kapitel widmet sich den Medien selbst, da diese die technische Plattform des bis dahin Erörterten liefern. Im Kontext der technischen Möglichkeiten und Grenzen der einzelnen Medien, wird auf methodische Vorüberlegungen und Regeln bezüglich ihres Einsatzes eingegangen. Diese Regularien wirken sich sowohl auf die Gestaltung, als auch auf die Präsentation bzw. die Moderation selbst und ihre Vorbereitung aus.
Präsentation und Moderation sind in der Theorie zwei scharf von- einander zu trennende Begriffe, doch in der Praxis sind sie direkte Nachbarn mit einer Schnittmenge. Der erste Abschnitt des dritten Kapitels widmet sich diesem disjunktiven Verhältnis von Präsenta- tion und Moderation. Im Kontext werden die Begriffe definiert und ihre wesenstypischen Züge beschrieben. Der Vorbereitung, der Rolle des Akteurs bzw. der Gruppe und dem grundsätzlichem Ablauf der unterschiedlichen Veranstaltungstypen kommt hierbei eine besondere Aufmerksamkeit zu. Der zweite Abschnitt verschafft einen Überblick über die Methoden der Präsentation und Moderation. Diese werden explizit beschrieben und ihre Vorraussetzungen, Grenzen und Möglichkeiten aufgezeigt.
Die Konklusion dieser Arbeit stellt das vierte Kapitel, indem das Wissenschaftstheoretische exemplarisch in ein Praxisbeispiel transferiert wird. Dieser Praxistransfer wird von der Definition der Weiterbildung und ihrer Trendanalyse basierend auf neuesten Er- hebungen eingeleitet.
Diese Diplomarbeit schließt im fünften Kapitel mit einem persönlichen Resümee.
1. Wahrnehmung und Lernen
Zu Beginn der Vorbereitung einer Präsentation, eines Workshops, eines Seminars o.ä. ist die Frage "Wie lernt der Mensch?" von grundsätzlicher Wichtigkeit. Schließlich ist das erklärte Ziel Infor- mationen, welcher Art auch immer, in die Köpfe der Zielpersonen zu transferieren und einen Lernprozess auszulösen. Ein Lernprozess setzt voraus, dass der präsentierte Lehrinhalt ü- berhaupt und im gemeinten Sinne wahrgenommen und interpre- tiert wird. Die Wahrnehmung unterliegt bei gesunden Menschen keiner Willkür, sondern folgt psychologischen Gesetzmäßigkeiten auf die im zweiten Teil dieses Kapitels eingegangen wird. Aus diesen grundsätzlichen Erkenntnissen von Lernen und Wahr- nehmung, lassen sich Gestaltungsgrundlagen für Präsentations- medien ableiten. Die Typographie und das Layout der verwende- ten Medien müssen den o.g. Gesetzmäßigkeiten folgen, um eine gelungene Präsentation zu erzeugen und damit verbunden den Lernzuwachs in der Zielgruppe in Gang zu bringen und voranzu- treiben. Der Ontologie widerstrebend wird zunächst auf das Lernen und dann erst auf die Wahrnehmung eingegangen, da diese einen großen Einfluss auf die Diktion von Gestaltungsregularien ausübt, und somit den direkten Zugang zu den in Kapitel 2 erörterten Prä- sentationsmedien offeriert.
1.1. Zur Biologie des Lernens
Der erste Teil dieses Kapitels wird sich mit den biologischen Prozessen des Lernens auseinandersetzen und aus dieser Perspektive der Fragestellung nachgehen, wie eine Information ins Langzeitgedächtnis gelangt.
Im zweiten Teil wird auf die Wahrnehmungskanäle und auf die daraus resultierenden Wahrnehmungs- und Lerntypen eingegan- gen, wobei dieses Kapitel das Bindeglied in die Psychologie der Wahrnehmung (Kapitel 1.2.) bildet.
1.1.1. Wie gelangt eine Information ins Langzeitgedächtnis?
Das menschliche Gehirn ist fast permanent einer Flut von visuel- len, akustisch, olfaktorischen und taktilen Eindrücken ausgeliefert. Um diese Flut zu bewältigen bedient sich das Gehirn eines Filters, welcher alle irrelevanten Sinneswahrnehmungen absorbiert. Diese Funktion obliegt dem Ultrakurzzeitgedächtnis. Alle Sinneseindrü- cke kreisen zunächst in Form von elektrischen Impulsen in unse- rem Gehirn, welche nach zehn bis zwanzig Sekunden abklingen, wenn ihnen keine weitere Aufmerksamkeit zu teil wird. Auf diese Art und Weise blendet das Gehirn zum Beispiel Straßengeräusche oder Laute einer fremden Sprache aus bzw. leitet sie nicht in unser Erinnerungsvermögen weiter. Somit wird dem Ultrakurzzeitge- dächtnis eine sehr wichtige Aufgabe zuteil, es schützt uns vor ei- ner zu starken Belastung mit Informationen und erleichtert die Ori- entierung. Nichtsdestotrotz sind diese elektrischen Impulse enorm wichtig für bestimmte Sofortreaktionen. (vgl.: KOMMER/REINEKE, 2001, S.173f.)
Bei einem Lernvorgang faltet sich, angeregt durch Wahrneh- mungsimpulse, eine der sich im Gehirn befindlichen DNS-Spiralen an bestimmten Stellen auseinander und dient im Grunde als Matri- ze an der sich Abdrücke (RNS) der Impulse bilden. Dies ist der Augenblick in dem eine Information zu Materie wird. Die Informati- on befindet sich nun im Kurzzeitgedächtnis, welches diese über einige Minuten festhalten kann. (vgl.: KOMMER/MERSIN, 2002, S.18)
Um ein längerfristiges Memorieren zu bewerkstelligen, müssen die RNS-Abdrücke ins Langzeitgedächtnis transportiert werden. Auf diesem Weg werden sie beim Durchgang durch die Ribosomen zu langen Proteinmolekülen verknüpft, welche dann, zu einem Knäuel
zusammengefaltet, als ruhende Information ins Langzeitgedächtnis eingelagert werden. Diese Materie kann dann bei späteren Erinne- rungsvorgängen durch Aktivierung der Zellen als Information abge- rufen werden. Im Grunde kann eine derartig gespeicherte Informa- tion nicht mehr vergessen werden, allerdings besteht die Möglich- keit, dass sie verschüttet wird. Auf eine verschüttete Information kann nur noch unter zur Hilfenahme von Drogen oder Hypnose unmittelbar zugegriffen werden. (vgl.: KOMMER/MERSIN, 2002, S.18)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: „Wie gelangt eine Information ins Langzeitgedächtnis?“ (vgl.: KOMMER/REINEKE, 2001, S.173)
Es ist also dem Lernprozess in besonderer Weise zuträglich, wenn sich, angeregt durch möglichst viele Wahrnehmungsimpulse, mög- lichst viele DNS-Spiralen auseinander falten, um als Matrize zur Informationsspeicherung zu dienen. Dementsprechend erweist sich eine Präsentation mit polaren Eigenschaften als besonders effektiv.
Eine gute Präsentation sollte über folgende polare Eigenschaften verfügen:
- logisch/ganzheitlich (Sprache, Text/Bilder, Fakten, Zah- len/Muster, Strukturen)
- sequenziell/gleichzeitig
- statisch/dynamisch
- rational/intuitiv
- sachlich/impulsiv
- zügig/ruhig
(vgl.: KOMMER/MERSIN, 2002, S.17)
Darüber hinaus zeigt sich, dass Bilder mit geringerer Anstrengung, d.h. mehr oder weniger automatisch, ins Langzeitgedächtnis aufgenommen werden. Dies begründet sich darin, dass Texte eher analytisch und Bilder ganzheitlich aufgenommen werden. (vg.: KOMMER/REINKE, 2001, S.175)
Je mehr Sinne angesprochen werden, desto mehr Informationen gelangen ins Langzeitgedächtnis, wobei ein aktiver Umgang mit den Informationen den Lernprozess stärker effektiveren. Der Wir- kungsgrad von sowohl Gesehnem als auch Gehörtem, ist 30% hö- her als bei nur Gehörtem, aber um 40% geringer als bei einem ak- tiven Umgang mit den Informationen. (vgl. KOMMER/MERSIN, 2002, S.16f.; DONNERT/KUNKEL, 2002,S.13)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Wir nehmen auf und behalten…
1.1.2. Wahrnehmungstypologie
Jeder Mensch bevorzugt beim Lernen einen Wahrnehmungskanal (visuell, akustisch, kinästhetisch) besonders. Dieser wird auch als bevorzugter Lernmodus bezeichnet. Das bedeutet, dass sich unter Berücksichtigung der bevorzugten Lernmodi der Teilnehmer, die Effektivität und der Lernerfolg meiner Präsentation weiter steigern lässt. (vgl.: KOMMER/REINKE, 2001, S.175)
Die Wissenschaft unterscheidet entsprechend in drei Lerntypen, welche folgende Eigenschaften bzw. Verhaltensweisen zeigen:
Der visuelle Typ
- liest lieber neues Material als es zu hören;
- fertigt Notizen lieber in Form von Grafiken, Kurvendiagrammen oder Skizzen an;
- entwirft Bilder im Geiste als Gedächtnishilfe;
- präferiert es Berichte schriftlich darzulegen, anstatt mündlich.
Der akustischer Typ
- hört aufmerksam zu, statt sich durch das Anfertigen von Noti- zen ablenken zu lassen;
- bittet um mündliche Erklärung von graphischen Darstellungen; i liest sich komplizierte Anleitungen oder schriftliche Passagen laut vor;
- sorgt stets dafür, dass er wenig Ablenkung hat (insbesondere Störgeräusche).
Der kinästhetische Typ
- bittet um eine praktische Demonstration
- bereitet sich durch Szenarios, die er durchspielt, auf konkrete Ereignisse vor;
- kann schwer stillsitzen, wenn er arbeitet oder lernt, er braucht körperliche Bewegung, um zu denken;
- beobachtet bevorzugt Handlungsabläufe um diese später zu imitieren.
(vgl.: CZICHOS, 1999, S.118f.; DONNERT/KUNKEL, 2002,S.10)
1.2. Zur Psychologie der Wahrnehmung
Das folgende Kapitel widmet sich exemplarisch dem wichtigsten Wahrnehmungskanal - dem Sehen. Schon die alten Chinesen wussten : „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“. Und tatsächlich der Mensch ist ein „Augentier“, bei dem 80% der Sinneswahrneh- mungen über die Augen an das Gehirn weiter gegeben werden. Wer diesen Kanal nicht anspricht, riskiert die Aufmerksamkeit sei- ner Zielgruppe und verschwendet ein großes Potential. (vgl.: DO- NERT/KUNKEL, 2002, S.89f.; CZICHOS, 1999, S.211ff.) „Bilder wirken stark, schnell und emotional, Bilder strukturieren komplexe Zusammenhänge und machen sie verständlich.“ (BERGER/GROB, 2003, S.34)
Ungeachtet seines Lernmodus ist der Mensch also ein „visueller Typ“, der grundsätzlichen Wahrnehmungsprinzipien unterliegt, welche berücksichtigt werden müssen, um die Effizienz einer Prä- sentation nicht unnötig zu reduzieren. Visuelle Reize werden im Grunde vom Gehirn aufgenommen und nicht vom Auge. Dieses findet seine Ursache darin, dass das Auge ein äußerst unzulängli- ches Instrument zur visuellen Wahrnehmung ist. Es bestehen er- hebliche Differenzen zwischen dem auf der Netzhaut abgebildeten Bild und dem Wahrgenommenen. Das Auge erzeugt ein auf dem Kopf stehendes, räumlich verzerrtes, nicht farbkorrigiertes Netz- hautbild, welches dann von unserem Gehirn korrigiert wird. Über diese Fehlerkorrektur hinaus bestehen noch weitere erhebliche Unterschiede zwischen Netzhautbild und der tatsächlichen Wahr- nehmung, wie z.B. das räumliche Wahrnehmen der Umgebung.
Bei der visuellen Wahrnehmung handelt es sich also nicht um die einfache Bewusstmachung des auf der Netzhaut abgebildeten Bildes, sondern eher um eine Interpretation dieses Bildes. (vgl.: BERGER/GROB, 2003, S.35f.) Diese Interpretation folgt bestimmten Interpretationsmustern und psychologischen Gesetzmäßigkeiten auf die nun im Weiteren Eingegangen wird.
1.2.1. Figur-Grund-Gliederung
In der folgenden Abbildung erkennt man spontan eine schwarze Vase auf weißem Hintergrund.
Abbildung 3: Rubensche Vase
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(BERGER/GROB, 2003, S.43):
Bei genauerem Betrachten erkennt man jedoch zwei weiße Ge-
sichter auf schwarzem Hintergrund. Sind beide Figuren einmal ent- deckt, können wir zwischen beiden Bildern hin und her wechseln. Das Erfassen beider Figuren zur gleichen Zeit ist fast unmöglich. Hier zeigt sich, dass unser Gehirn, je nach Wahrnehmungsfokus, einer Figur einen Hintergrund zuteilt, welchem außer seiner Farbe und Funktion als Grund des Bildes keine weitere Deutung beige- messen wird. Trotz der Tatsache, dass wir wissen, dass der Grund über eine deutbare Gestalt verfügt, bleibt unsere Wahrnehmung unbeeinflusst. Das ist ein Beleg dafür, dass der Wahrnehmungs- mechanismus stärker ist als das bewusste Denken. (vgl.: BER- GER/GROB, 2003, S.42f.)
Dieses Prinzip wirkt natürlich nicht nur bei einem abstrahierten Bild wie der Rubenschen Vase, sondern im wahrsten Sinne des Wortes in jedem Augenblick. Je nach momentaner Situation und dement- sprechendem Wahrnehmungsfokus definieren wir unsere Umwelt in Figur und Grund. Der Grund tritt hinter der Figur, dem Gegens- tand des Interesses, zurück und wird nur noch als unscharf und interpretationsfrei wahrgenommen. Er ist schlichtweg Muster und Farbe, der als Hintergrund zur Figur fungiert. (vgl.: KOM- MER/MERSIN, 2002, S.20f)
Abbildung 4: Beispiel selektive Wahrnehmung Figur-Grund (KOMMER/MERSIN, 2002, S.21)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dieser Wahrnehmungsmechanismus schützt das menschliche Ge- hirn vor Überlastung. Ohne diese Funktion wären wir völlig orien- tierungslos, da alles vom Auge Wahrgenommene gleichwertig ne- beneinander stünde. Die Figur-Grund-Gliederung hat also eine strukturierende Funktion, die in der Gestaltung von Präsentations- medien durch ein entsprechendes Layout zu unterstützen ist.
1.2.2. Übersummativität und Transponierbarkeit
„Eine Gestalt ist mehr als die Summe ihrer Einzelteile.“ (KOMMER/MERSIN, 2002, S.24) Die Wahrnehmung generiert unbewusst die einzelnen visuellen Elemente zu einer Gestalt. Die einzelnen Segmente treten hinter dem Gesamteindruck zurück. (vgl.: KOMMER/MERSIN, 2002, S.23f.)
Auf der folgenden Abbildung sehen wir nicht nur eine Ansammlung von geometrischen Formen, sondern erkennen deutlich ein stilisiertes Männchen:
Abbildung 5: Beispiel Übersummativität
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ebenso überfliegt das Auge zunächst eine mit dem Beamer proji- zierte PowerPoint-Folie und nimmt diese als reines graphisches Muster wahr. Erst dann beginnt der Betrachter die einzelnen Seg- mente der Folie, d.h. Bilder, Schrift, Grafiken usw. zu decodieren. Eine Präsentation mit einer heterogenen Typographie und einem unregelmäßigen Layout mit mangelnder Struktur würden den Bet- rachter unnötig in seiner Informationsaufnahme behindern. Dem- gegenüber können wir mit regelmäßigen, sich wiederholenden Mustern und einem gut organisierten in seiner Struktur wiederkeh- renden Folienaufbau die Effektivität der Informationsaufnahmen bedeutend steigern. (vgl.: KOMMER/MERSIN, 2002, S.23ff.) Ein weiterer Beleg für das übersummative Wahrnehmen von Ges- talt findet sich in ihrer Transponierbarkeit. Das bedeutet, dass sich einzelne Segmente einer Gestalt verändern lassen, ohne dass da- durch ihr ganzheitlicher Charakter verloren geht. Beispielsweise lässt sich das Bild der Bochumer Straßenbahn recht stark verän- dern, ohne dass sich ihre Gestalt als solche auflöst. Erst wenn man drastische Kontur- oder Farbveränderungen vornimmt zerfällt
die Gestalt. Das Bildbeispiel ganz rechts lässt seine Kontur nur noch aus dem Kontext der anderen Bilder ableiten. (vgl.: KOMMER/MERSIN, 2002, S.25)
Abbildung 6: Beispiel Transponierbarkeit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.2.3. Gleichheit
Ein weiterer strukturgebender Wahrnehmungsmechanismus ist das Gesetz der Gleichheit. Im Wahrnehmungsprozess werden au- tomatisch Figuren mit gleichen Ausprägungen bzw. Eigenschaften zu einer Gruppe zusammengefasst. Dies bezieht sich u.a. auf die Eigenschaften und Ausprägungen: Form, Größe, Farbe, Tonwert und/oder Bewegung. Besonders stark wirkt die Gleichheit der Far- be und die Gleichheit der Bewegung zum gleichen Zeitpunkt. Das heißt, Folienelemente, die sich zur gleichen Zeit beispielsweise an die untere Ecke der Projektion bewegen, werden sofort in der Wahrnehmung als Gruppe definiert. (vgl.: KOMMER/MERSIN, 2002, S.25f.; BERGER/GROB, 2003, S.46f.)
Abbildung 7: Beispiel Gleichheit der Farbe (BERGER/GROB, 2003, S.47)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.2.4. Nähe
Das Gesetz der Nähe besagt, dass eng beieinander angeordnete Elemente zu einer einzigen Figur zusammengefasst werden. Der Faktor Nähe wirkt bezüglich der Gruppierungstendenzen stärker als der Faktor Gleichheit. (BERGER/GROB, 2003, S.44ff.; KOMMER/MERSIN, 2002, S.26)
Abbildung 8: Beispiel Nähe vor Gleichheit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dieses Gesetz wird häufig zur Strukturierung von längeren Listen, wie z.B. Inhaltsverzeichnissen, Literaturlisten, Linklisten etc. ver- wendet.
1.2.5. Geschlossenheit
Ein noch stärker wirkender Faktor bezüglich der Gruppierung ist das Gesetz der Geschlossenheit. Die geschlossene Form befindet sich stets auf der Innenseite der geschlossenen Linie. (vgl.: BERGER/GROB, 2003, S.44)
Abbildung 9: Beispiel Geschlossenheit vor Nähe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Da in den meisten Fällen die Innenseite mit einer konkav um- schließenden Seite einer Begrenzung identisch ist, haben auch offene Kurven und Winkel nach diesem Gesetz eine formgebende Wirkung, wie es z.B. schon bei dem setzen von Klammern der Fall ist. Dies bedeutet, dass eine durchgezogene Linie nicht zwingend notwendig ist, um eine Gruppierung durch Geschlossenheit zu er- zielen, wie auch das nachfolgende Beispiel demonstriert. (vgl. BERGER/GROB, 2003, S.44; KOMMER/MERSIN, 2002, S.26f.)
Abbildung 10: Beispiel Geschlossenheit ohne durchgezogene Linie (KOMMER/MERSIN, 2002, S.26)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.2.6. Symmetrie
Es werden auch jene Elemente bevorzugt gruppiert, die im Gan- zen symmetrisch bzw. ausgewogen zueinander angelegt wurden. Hierbei ist die auf eine vertikale Achse bezogene Symmetrie eine der wirkungsvollsten Gestaltungsmöglichkeiten. Aber auch Achs- und punktsymmetrische Formen haben eine hohe Prägnanz. (KRECH/CRUTCHFIELD, 1992, S.75; KOMMER/MERSIN, 2002, S.26)
Alle vier Gruppierungstendenzen der Wahrnehmung, also Gleich- heit, Nähe, Geschlossenheit und Symmetrie, können als struktur- gebende Gestaltungselemente im Design von Präsentationsme- dien eingesetzt werden. Eine klare und durchsichtige Struktur hilft dem Zuschauer das Präsentierte leicht und schnell zu erfassen und die einzelnen Segmente zu decodieren, was im höchsten Ma- ße den Lernprozess effektiviert.
1.2.7. Kontext und Erfahrung
Wie bereits bei der Übersummativität (siehe 1.2.2. „Übersummati- vität und Transponierbarkeit“) erwähnt, strebt unsere Wahrneh- mung danach die gesehenen Dinge in Beziehung zueinander zu setzten und das Gesehene zu interpretieren. Dabei setzt sie die gesehenen Elemente nicht nur in Beziehung zueinander, sondern auch in Beziehung zu bereits Erfahrenem oder Erlebtem. Zwei wichtige Interpretationsfaktoren sind also der Kontext in dem das Gesehene steht und die Erfahrung des sehenden Individuums. Das folgende Bildbeispiel demonstriert beide Faktoren:
Abbildung 11: Beispiel Kontext und Erfahrung (BERGER/GROB, 2003, S.37)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Erstens setzt der Betrachter das in der Mitte befindliche Element in den Kontext zueinander, d.h. entweder vertikal in eine Zahlenreihe oder horizontal in eine alphabetische Reihe. Zweitens benötigt er die entsprechende Erfahrung, bzw. das Wissen über Zahlen und Buchstaben, um die Segmente zu erkennen und eine sinnvolle Reihenfolge bilden zu können.
Die Wahrnehmung ist also von den Vorerfahrungen des Einzelnen abhängig. Es werden bekannte Strukturen schneller erkannt als unbekannte, darüber hinaus werden einmal gewonnene Interpreta- tionen von komplexen, visuellen Strukturen memoriert und beein- flussen von nun an alle weiteren Interpretationsprozesse. Die aus der Erfahrung resultierende Vorerwartung kann eine solche Wirk- kraft entfalten, dass fehlende Teile ergänzt oder Details verändert wahrgenommen werden, um das Gesehene an das Erwartete an- zupassen (vgl.: BERGER/GROB, 2003, S.37f.) Außerdem verfü- gen wir über die Fähigkeit unser Erfahrungswissen zu abstrahie- ren. So können wir z.B. den Buchstaben „A“, ganz egal in welcher Schrift, ob mit Schnörkel oder Serifen, sofort erkennen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 12: Beispiel Abstraktionsvermögen von Erfahrungswissen
Hierbei handelt es sich um ein Zusammenwirken von Wahrneh- mungssystem und Gedächtnis. Die Reizinformation wird aufge- nommen und mit bereits erfahrenen Informationen verglichen. Aus Erfahrung erlernen wir die kritischen Formmerkmale einer Figur, beim „A“ sind dies drei in einer bestimmten Weise angeordnete Linien. Dieser Effekt entwickelt selbst dann noch Tragweite, wenn die Figur nur unvollständig oder verzerrt dargestellt ist. (vgl.: KOM- MER/MERSIN, 2002, S.28)
Abschließend ist also festzuhalten, dass die Erfahrungen und das Vorwissen der Zielgruppe bei der Konzeption eines Seminares o.ä. und dem Gestalten der dazu benötigten Präsentationsmedien un- bedingt zu berücksichtigen sind, da diese Faktoren massiven Ein- fluss auf die Wahrnehmung und damit auf den Lernprozess aus- üben.
1.2.8. Anmutungsqualität
Bis hierher wurde auf die emotions- und wertfreien Wahrneh- mungsprozesse eingegangen. Dieses ist aber nur die eine Seite der menschlichen Wahrnehmung. Die andere Seite sind die Ge- fühle und Stimmungen, die Formen, Farben, Layouts etc. beim Betrachter auslösen. Dies bezeichnet man als deren Anmutungs- qualität. Neben vielen individuellen, und damit nicht prognostizier- baren Anmutungsprozessen, gibt es zumindest interindividuelle Tendenzen. So ordnen beispielsweise so gut wie alle Testpersonen den beiden folgenden Figuren die Kunstworte „Maluma“ und „Takete“ gleich zu. (vgl.: KOMMER/MERSIN, 2002, S.30)
Abbilldung 13: „Maluma“ und „Takete“ (vgl.: KOMMER/MERSIN, 2002, S.30)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Insbesondere in Bezug auf Farben ist die Anmutungsqualität sehr individuell, was sich im interkulturellen Vergleich noch deutlicher zeigt.
Bei der Gestaltung von Präsentationsmedien sollte es unbedingt vermieden werden, dass einzelne Betrachter durch eine niedrige Anmutungsqualität, negative Gefühle und Stimmungen empfinden. Ein Design mit einer hohen Anmutungsqualität steigert die Aufund Annahmebereitschaft der Zielgruppe. Besonders stark wirken diesen Punkt betreffend akustische Reize.
Möchte man eine schöne Reise mit PowerPoint präsentieren, sollte man auch eine entsprechende Formatvorlage für das Design wäh- len, also gold-gelbe, „sonnendurchflutete“ Farben, welche im fol- genden Bildbeispiel sogar noch durch entsprechende Symbol er- gänzt werden. Möchte man hingegen nüchtern und seriös die Er- gebnisse einer Erhebung präsentieren sind zurückhaltende nüch- terne Farben mit klaren, schnörkellosen Gestaltungselementen ratsam. Dabei darf das Layout auch nicht zu langweilig ausfallen, da ansonsten die Aufmerksamkeit des Betrachters stark sinkt oder sogar verloren geht. Das hier gezeigte Beispiel ist im Layout an das Design des Duden-Verlages angelehnt, welcher für Glaubwürdigkeit und Seriosität steht, was sich natürlich auf die Anmutungsqualität der Präsentation überträgt.
Abbildung 14: Beispiel „Schöne Reise“ und „Ergebnispräsentation“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.3. Gestaltungsgrundlagen für Präsentationsmedien
Aus den eben beschriebenen Wahrnehmungsgesetzen lassen sich Gestaltungsregeln ableiten derer sich dieses Kapitel widmet. Hierbei wird in Regeln, die das Layout, die Typographie bzw. die Farbund Bilderauswahl betreffen, unterteilt.
Gestaltungsregeln treffen nicht immer auf alle Präsentationsme- dien zu, weshalb sich die nun folgenden Regeln zunächst auf digitale Projektionsmedien, d.h. also Beamer und Laptop beziehen. Auf Ausnahmen bzw. hiervon abweichende Regeln und weitere Möglichkeiten von anderen Medien wird im Kapitel 2. „Präsentationsmedien eingegangen“.
Grundsätzlich gilt: „Keine Regel ohne Ausnahme“. Die folgenden Regeln sind flexibel anzuwenden und an jedes Projekt anzupas- sen. Manchmal muss man sich mühsam und schmerzvoll von alt- bekannten und etablierten Formatvorlagen und Designelementen trennen, um einem neuen, anderen Projekt gerecht zu werden. Design-Grundsätze sind keine Naturwissenschaft mit absolut fest- gelegten Regularien. (vgl.: KOMMER/MERSIN, 2002, S.33)
Zu Beginn des Gestaltungsprozesses ist es von großer Wichtigkeit die eigenen Ziele des zu visualisierenden Projektes klar zu definie- ren. Zum zweiten ist die Zielgruppe bezüglich ihrer Ressourcen, sprich Fähigkeiten, Motivation, Ziele, Vorwissen etc. zu evaluieren. Die Ziele der Adressaten können durchaus von denen des Prä- sentanten abweichen, darüber hinaus können innerhalb der Ad- ressatengruppe höchst unterschiedliche Zielsetzungen, Fähigkei- ten etc. vorhanden sein. (vgl.: BERGER/GROB, 2003, S.11ff.; KOMMER/MERSIN, 2002, S.41ff.) Eine adäquate teilnehmerorien- tierte Auswahl des Inhalts wird also immer schwieriger, je hetero- gener die Zielgruppe ist. Danach sollte die Konzeption und die Feinplanung des Projektes folgen, um dann im letzten Schritt die zu visualisierenden Elemente festzulegen und entsprechend um- zusetzen.
Abbildung 15: Reduzierung (BERGER/GROB, 2003, S.54)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.3.1. Layout
„Weniger ist mehr!“ Professionelle Gestaltung von Vortrags- und Präsentationsmedien ist kein Selbstzweck. Das Design wird bzw. sollte nach einiger Zeit gar nicht mehr vom Betrachter wahrge- nommen werden, der Inhalt ist entscheidend. Reduziert man die Anzahl der Effekte und Gestaltungselemente, so kommt den verbleibenden eine stärkere Wirkung zu. Hingegen behindert etwa der Einsatz von fünf verschiedenen Schrifttypen die bereits er- wähnte strukturierende Tendenz der Wahrnehmung erheblich. Zahlenkolonnen in Form von Tabellen sind unbedingt zu vermei- den, aber auch bei Diagrammen sollte die Anzahl der Kategorien nicht zu hoch ausfallen (siehe 1.3.3. „Farben Grafiken und Bilder“ Tabelle 2). Das in Abbildung 14 gezeigte Beispiel einer Ergebnis- präsentation befindet sich an der absolut oberen Grenze einer noch sinnvollen Darstellung. (vgl.: KOMMER/ MERSIN, 2002, S.45; BERGER/GROB, 2003, S. 55ff.)
Ein Computer bleibt eine Maschine. Auch bei einer noch so großen Anzahl von Formatvorlagen, Authoring-Tools, Design-Detektiven und anderen Gestaltungshilfen bleibt der Mensch verantwortlich für das Endprodukt. Der Computer kann an dieser Stelle höchstens eine erste Orientierungshilfe bieten. Einige Formatvorlagen, z.B. unter PowerPoint, sind ohnehin kritisch zu bewerten. Stellenweise enthalten sie Kontraste, die nur wenige Beamer bei Tageslicht problemlos projizieren können (z.B. gelbe Schrift auf tiefdunkel- grünem Grund) oder das Layout enthält zu viele Schrägen und Kreise, die von digitalen Medien aufgrund ihrer auf Pixel basieren- den Darstellungstechnik nur mit mittlerer Qualität wiedergegeben werden. Die Präsentation ist also so klar und so einfach wie mög- lich zu gestalten, dies gilt auch und besonders für die Navigation bzw. die Bedienbarkeit der einzelnen Folien. (vgl.: KOM- MER/MERSIN, 2002, S.45f., 72f.)
Es ist stets für eine hohe Konsistenz zu sorgen. Sie ist eine Grundanforderung für effektives Design. Dies erleichtert die Struk- turierung und vereinfacht das Aufnehmen und Behalten der prä- sentierten Informationen, darüber hinaus werden Irritationen beim Betrachter vermieden. So erscheint z.B. ein neuer Titel eines neu- en Themas immer an der gleichen Stelle in der gleichen Animation auf einer neuen Folie. Auf diese Weise erkennt jeder Zuschauer den Neubeginn, da er das gesehene Prozedere bereits kennt und schon einmal decodiert hat. Einmal eingeführte Symbole dürfen keinesfalls ihre Bedeutung verändern, dies gilt natürlich in gleicher Weise für Terminologien. Konsistenz heißt nicht, dass alle Folien exakt identisch aussehen müssen, ein langweiliges Design kostet die Aufmerksamkeit der Adressaten. (vgl.: KOMMER/MERSIN, 2002, S.47)
Die üblichen Konventionen sind einzuhalten. Ein am unteren Bild- schirmrand platzierter Folientitel würde von den meisten Zuschau- ern nicht als dieser wahrgenommen werden, da erwartet wird das ein Titel am oberen Rand platziert ist. Besonders originelle Gestal- tungsmöglichkeiten sind also nur nach einer kritischen Prüfung in Erwägung zu ziehen. Das Einhalten von Konventionen gilt in glei- cher Weise für den Einsatz von Symbolen oder Bildmetaphern, so kann z.B. ein Panzer nicht als Friedenssymbol verwendet werden. (vgl.: KOMMER/MERSIN, 2002, S.29, S.48f.)
Eine gute Struktur ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine gelungene Präsentation. Dies ist in erster Linie durch visuelle Gruppierung und eine visuelle Reihenfolge zu erreichen. Man er- leichtert dem Betrachter das Erfassen der präsentierten Folie, in- dem man einzelne Elemente unter zu Hilfenahme der o.g. Grup- pierungstendenzen inhaltsadäquat vorsortiert. Unter visueller Rei- henfolge wird die Reihenfolge verstanden in der das Auge des Bet- rachters die Projektion wahrnimmt. Zunächst nimmt der Betrachter die Folie als Ganzes wahr. Danach wird normalerweise das Bild von links nach rechts und von oben nach unten decodiert. Dabei verweilt der Blick längere Zeit in den oberen beiden Ecken, dann in der optischen Mitte und zuletzt in der unteren rechten Ecke. (vgl.: KOMMER/MERSIN, 2002, S.49ff., S.65f.)
Abbildung 16: Visuelle Reihenfolge (KOMMER/MERSIN, 2002, S.66)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Durch animierte und statische Designelemente können wir den Blick unseres Publikums steuern, also die visuelle Reihenfolge festlegen. Die wohl einfachste, sicherste und wirkungsvollste Me- thode festzulegen, was in welcher Reihenfolge von der Zielgruppe wahrgenommen wird, ist natürlich schlicht und ergreifend auch ein- fach nur das Anzuzeigen, was auch gesehen werden soll. Dies hätte allerdings zur Folge, dass immer nur ein kleiner, kurzer Satz auf die Leinwand projiziert würde, mit der Folge, dass die Ziel- gruppe gelangweilt woanders hinschaut. Eine weitere Möglichkeit ist es die einzelnen Punkte einfach von oben nach unten auf der Folie erscheinen zu lassen, wobei schon besprochene zum Thema dazugehörende Punkte stehen bleiben. Diese Variante ist sehr klassisch, sollte aber durch Bilder, Piktogramme, Grafiken etc. in seiner Anmutungsqualität verbessert werden. Darüber hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten die visuelle Reihenfolge des Bet- rachters zu beeinflussen. Die nun folgenden Regeln verstehen sich allerdings lediglich als Tendenzen:
- Der Blick fällt zuerst auf bewegte bzw. animierte Elemente.
- Links und oben angeordnete Elemente werden zuerst betrach- tet.
- Die Elemente werden im Uhrzeigersinn betrachtet.
-Horizontale Anordnungen werden vertikalen vorgezogen. i Bunte Elemente werden vor unbunten wahrgenommen.
-Isolierte Elemente werden vor Elementen in einer Gruppe wahr- genommen.
- Grafische Elemente werden vor Textelementen wahrgenom- men.
- Menschliche Darstellungen werden vor Darstellungen von Tie- ren wahrgenommen. Dann folgen Darstellungen von Gegens- tänden, dann von Farben und zuletzt von geometrischen For- men.
(vgl.: KOMMER/MERSIN, 2002, S.51f., S.67)
Der Beschaffenheit des Hintergrundes kommt wie bereits erwähnt im Strukturierungsprozess eine Schlüsselfunktion zu. Ein gut gewählter Hintergrund erleichtert dem Betrachter die Differenzierung zwischen Figur und Grund.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 17: Beispiel “Klarer Hintergrund“ und „Ungünstiger Hintergrund“ (KOMMER/MERSIN, 2002, S.23)
Im rechten Beispiel ist der Hintergrund viel zu dominant. Aufgrund seiner vielen Formen und Farben bedient er nicht das darzustel- lende Diagramm, sondern entwickelt einen Selbstwert. Zunächst sucht der Betrachter die Hauptaussage der Folie, und wenn sie dann entdeckt ist, fällt es immer noch relativ schwer sich auf das Diagramm zu konzentrieren. Das linke Beispiel verfügt über eine klare Gliederung von Figur und Grund. Da in dem Diagramm nur zwei Säulen darzustellen waren, konnte man sich beim Design einen 3D-Effekt erlauben, um die Anmutungsqualität etwas zu steigern. Bei umfangreicheren Diagrammen ist von einem 3D- Effekt abzuraten, da dieser dann den ohnehin umfangreichen Decodierungsaufwand unnötig verstärkt.
Um eine gute Struktur zu erzielen, ist für reichlich leere Flächen zu sorgen. Erstens sorgt dies für eine gute Figurgrundgliederung, zweitens werden Elemente durch Leerräume visuell gruppiert. Bei der Verwendung von Leerräumen ist darauf zu achten, dass Ele- mente, provoziert durch den Folienwechsel, nicht den Eindruck erwecken, dass sie wild umherspringen. Es ist also das Gebot der Konsistenz auch bei leeren Flächen anzuwenden. (vgl.: KOM- MER/MERSIN, 2002, S.60ff.)
Eingefärbte Flächen haben eine gruppierende Wirkung (siehe 1.2.5. „Geschlossenheit“). Jedoch neigen sie dazu, das Gesamt- bild zu stark zu dominieren. Es ist darauf zu achten, dass die Folie nicht in zwei exakt gleiche Hälften unterteilt wird, da dies sehr sta- tisch wirkt und der Flächenaufteilung kein Gewicht gibt um, den Strukturierungsprozess zu unterstützen. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass die Tonfläche im unteren Teil nicht dunkler ist als im oberen Teil, da dies den Schwerpunkt der Folie zu weit nach unten ziehen würde. (vgl.: KOMMER/MERSIN, 2002, S.67f)
Abbildung 18 Beispiel: „Flächenbalance“ (KOMMER/MERSIN, 2002, S.68)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grundsätzlich sollte man die mathematische Mitte meiden, sie mag zwar einerseits korrekt wirken, ist dafür aber langweilig. Kernaus- sagen, wie z.B. bei Titelfolien, sollten etwas oberhalb der mathe- matischen Mitte positioniert werden. Es wird in diesem Falle von der optischen Mitte gesprochen. (vgl.: KOMMER/MERSIN, 2002, S.64f.)
Abbildung 19: Beispiel „Optische Mitte“ und „Mathematische Mitte“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
„Wichtige Aussagen, Bilder, Texte usw. sollten im Normalfall nicht unterhalb der mathematischen Mitte platziert werden.“ (KOMMER/MERSIN, 2002, S.65)
1.3.2. Schrift und Typographie
Zunächst ist die Terminologie dieses Sektors der medialen Gestal- tung zu klären. Ein Buchstabe lässt sich unterteilen in Oberlänge, Mittellänge und Unterlänge. Die Mittellänge ist nach unten be- grenzt durch die Grundlinie, welche praktisch die Linie ist auf der geschrieben wird. Die Buchstabenbestandteile unterhalb dieser Linie werden als Unterlänge definiert. Über der Mittellänge befindet sich die Oberlänge eines Buchstabens. Das „Gerüst“ eines Buch- stabens bildet der so genannte Grundstrich. Als Serifen werden die Querstriche an den oberen und unteren Enden eines Buchstabens bezeichnet, welche bei den herkömmlichen Printmedien für eine gute Lesbarkeit der Schrift sorgen. (vgl.: KOMMER/MERSIN, 2002, S.109)
Abbildung 20: Anatomie der Schrift (KOMMER/MERSIN, 2002, S.109)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
- Arbeit zitieren
- Dominik Sauer (Autor:in), 2004, Wahrnehmung, Präsentation und Moderation und ihre Bedeutung für die berufliche Weiterbildung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79960
Kostenlos Autor werden


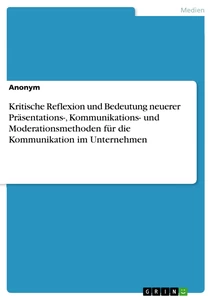
















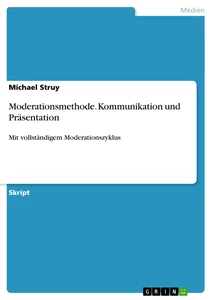
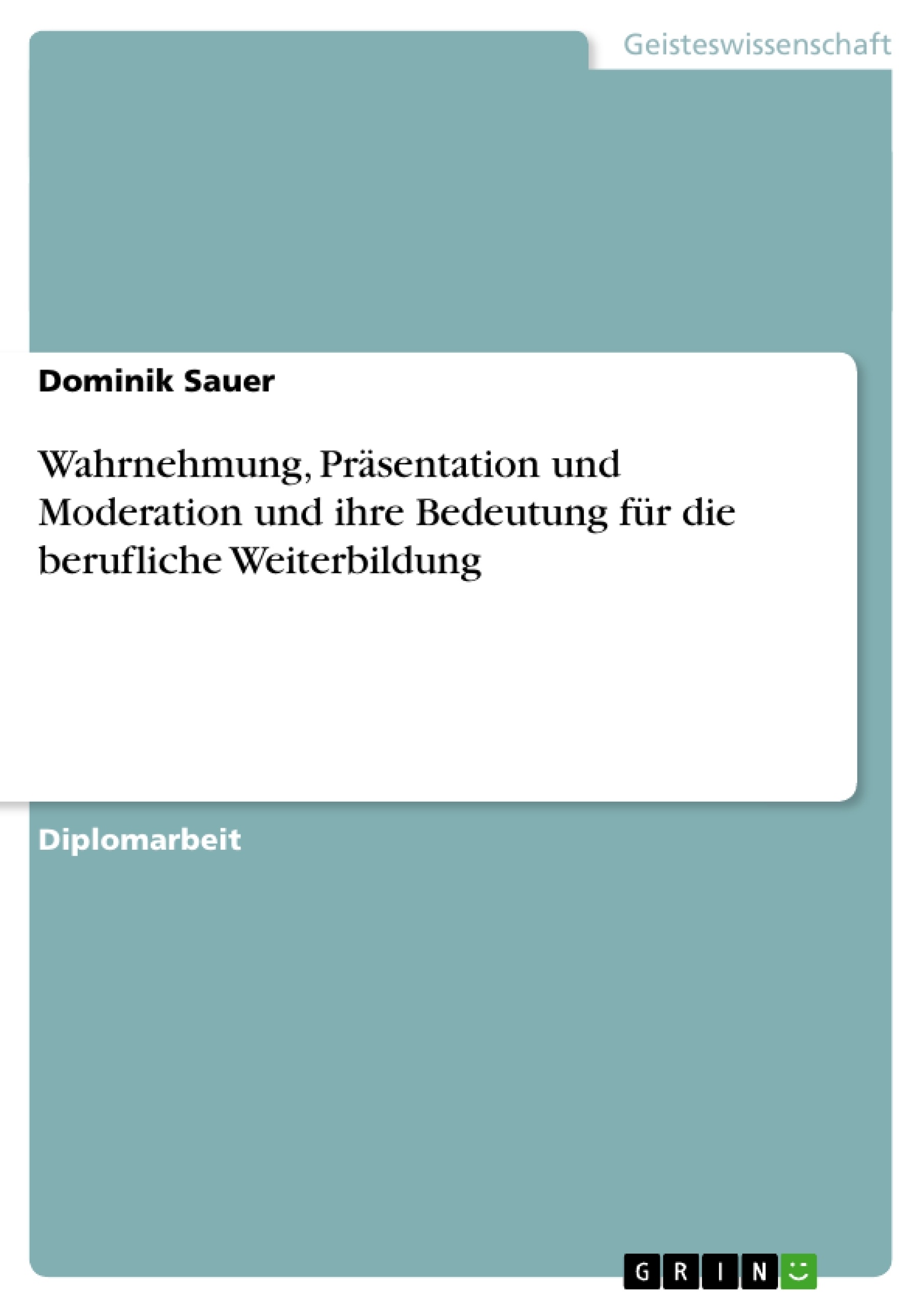

Kommentare