Leseprobe
Inhalt
Einleitung
1. Aufmerksamkeit und Medienkonkurrenz
1.1 Vom Informationsfluss zur Informationsflut?
1.2 Aufmerksamkeit als zentrale Ressource im publizistischen System
1.3 Die ökonomische Nutzbarmachung von Aufmerksamkeit
1.4 Medien im Spannungsfeld zwischen öffentlichem Auftrag und kommerziellen Interessen
1.5 Kommerzialisierung und Konvergenz als Prozesse
1.6 Medienkonkurrenz und ihr Einfluss auf publizistische Konzepte
2. Bestandsaufnahme und Gründe des Online-Engagements der Tageszeitungen
2.1 Juristische und mediendefinitorische Gründe
2.2 Vorgängermodelle und erste Angebote im Internet
2.3 Entwicklung flächendeckenden Engagements
2.4 Eine neue Dimension der Crossmedialität
2.5 Kategorisierungen des Online-Engagements
2.6 Verstärktes Engagement bei lokalen und regionalen Tageszeitungen
2.7 Weshalb Ausbau statt Rückzug?
3. Medienspezifische Charakteristika
3.1 Aktualität und Aktualisierbarkeit
3.2 Skalierbare Informationstiefe
3.3 Multimedialität
3.4 Korrigierbarkeit nach Veröffentlichung
3.5 Gestaltung der Startseite
3.6 Wie lässt sich Informationsfülle visualisieren?
3.7 Verfügbarkeit
3.8 Bebilderung
3.9 (Un)berührbarkeit
3.10 Individualisierbarkeit der Nachrichtenauswahl
3.11 Eignung als Werbeträger
3.12 Tabellarischer Vergleich der genannten Charakteristika
4. Zukunftsperspektiven der Printzeitungen und ihres Online-Engagements
4.1 Das Rieplsche Gesetz in der Diskussion
4.2 Printzeitungen und die Notwendigkeit einer neuen Rollendefinition
4.3 Entschleunigung als Chance für die Hintergrundberichterstattung
4.4 Wandlungspotentiale aus funktionaler Sicht
4.5 Perspektiven für die Online-Ausgaben der Zeitungen
4.6 Crossmedialität und Vertrauen
4.7 Online-Engagement bleibt Herausforderung
4.8 Haben kostenpflichtige Inhalte eine Chance?
Fazit
Einleitung:
Wer wissen möchte, an welchem Ort der Erde sich ein Land befindet, dem hilft der Globus mehr als ein Stadtplan der jeweiligen Hauptstadt. Ähnlich verhält es sich auch bei dem Thema dieser Diplomarbeit: Die Gründe, Probleme und Perspektiven des Online-Engagements deutscher Tageszeitungsverlage lassen sich am besten verstehen, wenn dabei der gesamte publizistische Globus, sprich der Medienmarkt mitsamt seinen Entwicklungen, Systemimmanenzen und spezifischen Transferprozessen im Blickfeld bleibt und das Thema somit in einem Gesamtzusammenhang behandelt wird.
Ziel dieser Ausarbeitung ist folglich eine zukunftsorientierte Bestandsaufnahme des bisherigen Online-Engagements deutscher Tageszeitungen. Hierbei sollen auch Beziehungen, Wechselwirkungen und mögliche Synergien zwischen den Print- und Onlineausgaben von Zeitungen beleuchtet werden.
Es geht jedoch nicht darum, mit Blick auf den Dotcom-Tod einen analogen Beweis für die ökonomische Aussichtslosigkeit journalistischer Angebote im Internet zu liefern. Denn das World Wide Web ist zu jung für solche Grabgesänge. Trotz der Krise der IT-Branche wächst es in unterschiedlicher Hinsicht; zum einen was die Zahl von Nutzern und Webseiten betrifft, zum anderen hinsichtlich der Quantität und Qualität seiner technischen Möglichkeiten.
Umso wichtiger ist es, die Probleme journalistischer Online-Angebote zu ergründen und zu benennen. Fakt ist zwar, dass sich die anfänglichen Gewinnerwartungen vieler Verlagshäuser in den letzten Jahren nicht oder nur bedingt erfüllt haben. Und die Frage nach dem Warum soll in dieser Diplomarbeit Raum bekommen. Nicht minder wichtig ist aber auch die Frage, wie die Verlagshäuser mit dieser Erkenntnis dieser Erkenntnis umgehen und wie sich dies auf ihr Online-Engagement auswirkt. Welche Kurskorrekturen haben in manchen Redaktionen bereits stattgefunden? Zeichnen sich bei einzelnen Portalen neue Strategien ab, die auch für andere Verlagshäuser interessant sein könnten?
Gegliedert ist diese Hausarbeit nach fünf Leitfragen, die zugleich der Kapitelstruktur entsprechen:
- 1. Kapitel: Welches sind die generellen Trends der Medienentwicklung, in die das Online-Engagement der Verlage eingebettet ist?
- 2. Kapitel: Wie und weshalb präsentieren sich Zeitungen im Internet?
- 3. Kapitel: Welches sind die spezifischen Charakteristika und Rezeptionsmöglichkeiten von Print- und Onlinemedien?
- 4. Kapitel: Wie kann eine adäquate und zukunftsfähige mediale Arbeitsteilung zwischen der Print- und der Onlineausgabe einer Zeitung aussehen?
Diese Ausarbeitung trägt den Titel „Mehrwert bieten, mehr Wert schaffen“. Das Wort Mehrwert bezieht sich dabei sowohl auf die Online- als auch auf die Printausgaben von Zeitungen. In einer Zeit, die von einer immer größer werdenden Zahl von Informations- und Unterhaltungsangeboten gekennzeichnet ist, kommt der Aufmerksamkeit des Rezipienten eine besondere Bedeutung zu - näheres dazu in Kapitel 1. Umso wichtiger ist die Frage nach den Alleinstellungsmerkmalen und marktrelevanten Vorteilen der einzelnen Medienangebote - nach dem, was sie letztlich unersetzlich und unverwechselbar macht. Hier zeichnet sich bereits die Dimension des Wortes Mehrwert ab. Mehrwert soll hier nicht als rein quantitative, sondern vor allem als qualitative Größe verstanden werden. Dabei geht es um zwei Fragen:
Zum einen geht es um den grundsätzlichen Mehrwert - darum, welche Gründe es überhaupt gibt - oder geben sollte - trotz einer Vielzahl anderer Informations- und Unterhaltungsangebote Tageszeitungen und ihre OnlineAusgaben zu rezipieren. Zum anderen geht es um den individuellen Mehrwert - also um die Frage, wie eine komplementäre Nutzung der Print- und der Onlineausgabe einer Zeitung begünstigt werden kann.
Neben dem zusammengeschriebenen Mehrwert, trägt der Titel auch noch einen auseinander geschriebenen „mehr Wert“ in sich, der an dieser Stelle nicht nur als ökonomische Größe verstanden werden soll. Vielmehr soll deutlich gemacht werden, dass es sich bei der Frage nach dem Mehrwert von Medien nicht nur um eine reine Was-hab-ich-was-Du-nicht-hast-Frage, um ein komparatives Betrachten unterschiedlicher journalistischer Leistungsprofile und -potentiale dreht.
Wer den publizistischen Globus im Blick behalten will, der muss auch die übergeordnete Frage stellen, nämlich die, welchen (Stellen-)Wert und welche Rolle Zeitungen und ihre Onlineausgaben in Deutschland haben oder haben sollten. Dies lenkt den Blick auf die Funktionszuweisungen, die sich unter anderem in den Pressegesetzen niederschlagen. Wie aber können Aufgaben wie Information und Meinungsbildung in einer Gesellschaft erfüllt werden, die als Wissens- oder Informationsgesellschaft, aber auch als Risikogesellschaft tituliert wird?
Die These dieser Arbeit lautet: Zeitungen müssen, auch bedingt durch ihre vergleichsweise langsame Produktions- und Distributionsweise, hintergründiger werden und ihren Informationsauftrag nicht nur als Auftrag zur Nachrichtenselektion verstehen, sondern auch als Bildungsauftrag. Das Internet kann ihnen dabei helfen. Denn je stärker es als permanent aktualisierbares Medium genutzt wird, desto mehr können sich die Printausgaben auf die Geschichten hinter den Nachrichten konzentrieren, ohne dass der Verlag seinen eigenen Aktualitätsanspruch verliert. Eine solche Arbeitsteilung zwischen Zeitung und Internet lässt jedes Medium als Mehrwertträger für das jeweils andere Medium fungieren und begünstigt somit zugleich eine komplementäre Nutzung von Print- und Onlinezeitung.
1. Aufmerksamkeit und Medienkonkurrenz
Charakterisierend für die Entwicklung des Medienmarktes in den letzten zwei Jahrzehnten sind vor allem zwei grundsätzliche Tendenzen, die in einem Zusammenhang stehen und oft mit den Schlagwörtern Informationsflut und Kommerzialisierung versehen werden. Auf sie soll in diesem Kapitel zunächst näher eingegangen werden.
1.1 Vom Informationsfluss zur Informationsflut?
Der Begriff Informationsflut deutet auf eine große Menge an Informationen hin, ein ständig anwachsendes Überangebot, von dem der einzelne Rezipient durch einen Mangel an Zeit nur einen Bruchteil nutzen kann. Treffend ist die Bezeichnung Flut in diesem Fall vor allem, weil eine Flut in der Regel durch kräftige Regengüsse entsteht. Die Medienlandschaft ist, um im Bild zu bleiben, durch mehrere große Güsse geprägt, die das Flussbett zunächst aufgefüllt und die Stromschnellen immer weiter beschleunigt haben. Auf die Frage, ob diese Güsse den Fluss auch über die Ufer treten ließen, wie es der Begriff „Flut“ suggeriert, komme ich an anderer Stelle zurück.
Bis ins 19. Jahrhundert hinein waren Informationen über das Zeitgeschehen ein rares Gut und die Zeitungslektüre ein Privileg wohlhabender Klassen. - Diese Tatsache war nicht nur darauf zurückzuführen, dass sich, abseits von Adel und Bürgertum, kaum jemand eine Zeitung leisten konnte. Die Druckkosten sanken im 19. Jahrhundert durch Fortschritte in der Druck- und Satztechnik.1 Selbst wenn es nicht so gewesen wäre, hätten große Teile der Bevölkerung mit dem bedruckten Papier zuvor nichts anzufangen gewusst. Erst durch die Einführung der allgemeinen Schulpflicht wurden Lesen und Schreiben zu Kenntnissen, die von immer größeren Teilen der Bevölkerung beherrscht wurden. Der Fluss, um auf das anfängliche Bild zurückzukommen, hatte noch einen niedrigen Wasserstand, begann aber, sich im 19. Jahrhundert kontinuierlich zu füllen.
Durch die Entwicklung von Rundfunk und Film traten neue Informationskanäle hinzu; speziell durch den Rundfunk wurde es erstmals möglich, Informationen ohne Zeitverzögerung zu übermitteln. Der Fluss füllte sich weiter mit Wasser, die Stromschnellen, respektive die Informationswege, wurden schneller. Durch die Filmtechnik wurde es zudem möglich, Informationen vermittels bewegter Bilder zu zeigen, die mit Untertiteln und später mit Ton unterlegt wurden. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich dann schließlich auch das Fernsehen zu einem Massenmedium.
Der Fluss war nun gut gefüllt, der Begriff Informationsflut erlangte jedoch erst in den letzten zwanzig Jahren des 20. Jahrhunderts in Deutschland Beachtung. Denn im Zuge wachsenden Wohlstands und technischer Weiterentwicklungen wuchs auch der publizistische Markt. Kennzeichnend dafür waren zum einen stetig wachsende Zahlen von Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt und eine immer weiter fortschreitende Diversifizierung auf dem Zeitschriftenmarkt. Diese drückte sich sowohl in einer wachsenden Zahl General-Interest-Titeln aus, als auch in einer immer größer werdenden Auswahl an Fachzeitschriften und Special-Interest-Titeln. Zum anderen kamen erweiterte Übertragungskapazitäten für Radio und Fernsehen hinzu. In Deutschland wurde durch ein neues Gesetz am 1. Januar 1984 der Weg frei für privatwirtschaftliches Engagement auf dem Radio- und Fernsehmarkt. Das duale Rundfunksystem2 entstand - und mit ihm die ersten privaten Radio- und Fernsehsender. Anfangs noch bespöttelt, entwickelten sie sich immer stärker zu ernst zu nehmenden Konkurrenz für die gebührenfinanzierten Rundfunkanstalten öffentlichen Rechts. Des Weiteren wurde auch der Bildschirm erstmals als Medium für textbasierte Informationsangebote genutzt. Die ersten Videotextangebote entstanden. Der Fortschritt in der Computertechnik ließ zudem Informations- und Kommunikationswerke und damit auch das World Wide Web entstehen, das sich in der zweiten Hälfte der 90er Jahre von einem Insider- zu einem Massenmedium entwickelte. Ermöglicht wurde diese Entwicklung durch die Digitalisierung. Gemeint ist damit die Überführung verschiedener kodierter Inhalte (z.B. Texte, Musik, Bilder, Filme) in ein einheitliches Grundformat. Hieraus resultiert die Möglichkeit Medienmischungen, also Multimedialität, herzustellen - z.B. in Form einer Videosequenz, die innerhalb eines Textes aufgerufen werden kann.3 Digitalisierung betrifft dabei nicht nur das Internet sondern auch andere Medien z.B. das Fernsehen, dessen Empfang in den kommenden Jahren in Deutschland flächendeckend digitalisiert werden soll, wodurch u.a. eine größere Programmauswahl resultiert - auch für jene Zuschauer, die nicht über eine Satellitenschüssel oder einen Kabelanschluss verfügen.
Die so genannte Informationsflut entstand somit aus unterschiedlichen Regengüssen: Zum einen stieg der Wasserstand durch das Anwachsen der klassischen Medien; es gab mehr Printprodukte, mehr Radio- und Fernsehsender. Zum anderen ließen Videotext und Internet als neue bildschirmbasierte Darreichungsformen von Informationen den Pegel steigen. Insbesondere das Internet mit seiner Fähigkeit, Informationen auch ohne großen finanziellen Aufwand weltweit verfügbar und abrufbar zu machen, stellte hierbei eine bedeutende Erweiterung des Medienspektrums dar.
Ist nun der (Informations-)Fluss einfach nur voller, tiefer und schneller geworden, oder tritt er über die Ufer? Der Begriff Informationsflut ist insoweit fragwürdig, weil er suggeriert, dass das Vorhandensein einer großen Auswahl an Informationen etwas grundsätzlich Bedrohliches ist. Flut lässt an den Zorn Gottes im Alten Testament denken. Oder an die Jahrhundertflut. Dabei ist hier ja nicht von Not, sondern von einem riesigen Angebot die Rede. Aus einem knappen und teuren Gut ist - zumindest in Demokratien der so genannten Ersten Welt - eine nahezu unbegrenzt verfügbare Ware geworden.
Diese Entwicklung stellt allerdings neue Anforderungen. Wenn schon der Begriff der Informationsflut benutzt wird, dann wäre es fragwürdig, wenn sich die Diskussion zu diesem Thema im Feststellen und fatalistischem Beklagen wachsender Unüberschaubarkeit erschöpft. Denn wenn von einer Flut die Rede ist, dann empfiehlt es, auch darüber zu reden, wie die Rezipienten ihre Arche bauen und steuern können. Anders gesagt: Menschen benötigen eine verstärkte Medienkompetenz, um mit der Informationsfülle umgehen zu können. Zum einen müssen sie wissen, wo und wie sie die für sie relevanten Informationen finden können. Zum anderen stehen vor immer neuen Auswahlentscheidungen, denn ihre Freizeit und ihre Lebenszeit reichen bei weitem nicht aus, um alles, was ihnen an Informations- und Unterhaltungsangeboten offeriert wird, auch zu nutzen. Damit der Informationsreichtum nicht zum embarras de richesse führt, die Wahl nicht zur Qual verkommt, müssen sich die Rezipienten stärker als zuvor bewusst machen, was sie am meisten interessiert, und welchen Informationsanbietern sie vertrauen. Matthias Rath stellt zum Begriff der Medienkompetenz folgendes fest:
„Sicher ist, dass damit nicht allein die technische Fertigkeit, moderne Medien zu nutzen, gemeint sein kann, sondern auch die Fähigkeit, die Medienangebote, Produkte wie Dienstleistungen, in ihrer weltvermittelnden und auch -verbiegenden Bedeutung zu erfassen, zu verstehen und gegebenenfalls zu kompensieren. Medienkompetenz ist somit ebenfalls, je nach medialer Nutzung, noch inhaltlich zu füllen, zum Beispiel durch Suchkompetenz im überflutenden Informationsangebot, durch die Fähigkeit zur ergänzenden Mediennutzung, zum Beispiel schnelle und oberflächliche Medien (Fernsehen, Internet) durch langsamere, aber tiefer gehende Medien (Zeitungen, Zeitschriften, Bücher).“4
Die Einteilung in „schnelle und oberflächliche“ und „langsamere, aber tiefergehende Medien“ ist in dieser Pauschalität zwar hinterfragenswert (dazu mehr in Kapitel 3); dennoch macht die vorliegende Definition deutlich, dass unterschiedliche Medien ihrem Wesen nach auch unterschiedlichen Nutzen bringen können, sofern der Rezipient sie für seine Informationsziele einzusetzen versteht und in der Lage ist, diese Medien, wo nötig, hinsichtlich ihrer Berichterstattung in Frage zu stellen.
1.2 Aufmerksamkeit als zentrale Ressource im publizistischen System
Informationsanbieter haben es infolge einer größer gewordenen Medienauswahl schwerer, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Denn Informationen sind - trotz zunehmender Medienkonzentration5, anders als früher, heutzutage kein knappes Gut mehr.
Der steigende Wettbewerb um die Aufmerksamkeit wird dadurch begünstigt, dass Informationen im Gegensatz zu materiellen Gütern, einer so genannten Nichtrivalität im Konsum6 unterliegen. Hanno Beck beschreibt dies so: „Wenn Sie beispielsweise eine Hose kaufen und anziehen, so schließt das den Konsum der Hose durch jemand anderen aus (das wollen wir zumindest einmal für Sie hoffen). Nicht so beim Konsum von Informationen: Die Tatsache, dass Sie eine Fernsehsendung verfolgen, schließt den Konsum dieser Fernsehsendung durch andere Personen nicht aus.“7 Beck rechnet vor: „Die Herstellung einer Nachrichtensendung beispielsweise kostet einen bestimmten, festen Betrag für die Bereitstellung des Studios, die Bezahlung des Nachrichtensprechers und der Agenturen, von denen man die Meldungen erhält u.s.w.“8 Wie viele Personen diese Nachrichten dann sehen, hat jedoch keinen Einfluss auf die Herstellungskosten. Mike Friedrichsen schreibt hierzu: „Einmal produziert, bewirkt die Nichtrivalität im Konsum, dass die Versorgung weiterer Rezipienten mit den erstellten Rundfunkinhalten ohne zusätzliche Kosten möglich ist.“9 - Ähnlich verhält es sich bei Printmedien. Ein hoher Anteil ihrer Erstellungskosten (Personal, Druckvorlagenerstellung etc.) sind Fixkosten. Die zusätzlichen Kosten, die anfallen, wenn weitere Abonnenten hinzu kommen (Papier, Stücklohn für den Austräger etc.) sind vergleichsweise sehr gering.
Technisch ist es zwar möglich, Menschen vom Konsum gewisser Medienangebote10 auszuschließen, aber seitens der Medienunternehmen nicht unbedingt wünschenswert: „Nehmen sie als Beispiel das Kabelfernsehen. Ein Ausschluß von der Nutzung ist technisch ohne weiteres möglich, aber im Hinblick auf die Werbeeinnamen eher kontraproduktiv, da zusätzliche Nutzer zusätzliche Werbeeinnahmen versprechen und - sind die Kabel erst einmal installiert - keine zusätzlichen Kosten verursachen“, schreibt Hanno Beck.11
Medienunternehmen haben aus den oben genannten Gründen ein besonders großes Interesse daran, dass ihre Produkte von so vielen Menschen wie nur möglich gelesen, gesehen, oder gehört werden. Die Erfüllung dieses Wunsches wird aber vor allem durch eine Tatsache erschwert: Die Zeit, die die Rezipienten mit der Nutzung von Medien verbringen, ist es nur noch in begrenztem Ausmaß steigerbar. Lag der tägliche Konsum aktueller und inaktueller Medien eines Bundesbürgers 1980 laut ARD/ZDF- Langzeitstudie Massenkommunikation bei weniger als sechs Stunden (346 Minuten), so waren es im Jahr 2000 bereits über acht Stunden (502 Minuten).12 Nicola Sennewald beschreibt dies am Verhältnis zwischen Internet und klassischen Medien:
„Der Wettbewerb zwischen dem Internet und den traditionellen Medien ist teils komplementärer, teils substitutiver Natur. Er ist insofern komplementärer Natur, als jedes Medium nur einen begrenzten Beitrag zur Information und Unterhaltung zu leisten vermag, deshalb insoweit ergänzungsbedürftig ist und von Rezipienten, die auf vielseitige Berichterstattung Wert legen, auch ergänzt wird - durch die parallele Nutzung anderer Medien. Gleichzeitig ist das Verhältnis zwischen den Medien aber insoweit substitutiv, als der Nachfrager nur über ein begrenztes Zeit- und Einkommensbudget verfügt und die Nutzung eines neuen Mediums automatisch zu Lasten der anderen Medien geht.“13
Das wiederum führt dazu, dass sich Medien zwar in einer Nicht-Rivalität im Konsum aber in einer Rivalität um die knapper werdende Ressource Aufmerksamkeit befinden. Wobei Aufmerksamkeit der Rezipienten nicht immer zwingend auch Geld der Rezipienten bedeuten muss. Private Rundfunk- und Fernsehsender verlangen, mit Ausnahme des Pay-TV’s, kein Geld für die Nutzung; Anzeigenblätter und -zeitungen, Kundenzeitschriften und viele Stadtmagazine sind kostenlos verfügbar; genauso wie zahlreiche Angebote im Internet.
Die Tatsache, dass der Rezipient nicht direkt14 an der Finanzierung vieler Informations- und Unterhaltungsangebote beteiligt ist, macht umso stärker den Wert deutlich, der seiner Aufmerksamkeit zukommt. „Während für Wirtschaftsmärkte die Ressource Geld elementar ist, handelt es sich beim publizistischen Markt um einen nicht monetären oder prämonetären Markt. Der „unit act“ des publizistischen Marktes ist damit nicht die Zahlung, sondern der Tausch“, schreibt Anna Maria Theis-Berglmair. Es ist ein Tausch von zwei immateriellen Ressourcen, Aufmerksamkeit und Informationen. „Der Wettbewerb zielt dabei um die knappe Ressource Aufmerksamkeit.“15 Bei diesem Tausch seien zwar auch andere Ressourcen, beispielsweise Zeit, involviert. Letztgenannte sei jedoch bereits in der Aufmerksamkeit eingeschlossen: „Wenn ich Aufmerksamkeit schenke, gebe ich gleichzeitig Zeit, umgekehrt ist dies nicht zwingend der Fall.“16 Aufmerksamkeit ist aber nicht nur aufgrund des verstärkten Wettbewerbs eine wichtige Determinante in der Medienlandschaft. Sie ist grundsätzlich die zentrale Ressource im publizistischen System, das Theis-Berglmair nicht als Teil des Wirtschaftssystems, sondern als eigenständiges Funktionssystem der Gesellschaft ansieht. Sie nimmt hierbei Bezug auf die Systemtheorie nach Niklas Luhmann, die jeden gesellschaftlichen Funktionssystem (Wirtschaft, Politik, Recht, Wissenschaft, Publizistik) ein Steuerungsmedium und einen entsprechenden operativen Code zuweist, der es von anderen Systemen unterscheidbar und abgrenzbar macht.
„Steuerungsmedium und Code haben jeweils nur für ein spezifisches Funktionssystem Geltung und können nicht auf andere Systeme übertragen werden: Geld ist das Steuerungsmedium der Wirtschaft; dementsprechend wird nach dem zweiwertigen Code „zahlen - nicht zahlen“ über die Systemrelevanz von Ereignissen entschieden. Im Falle der Politik mit dem Steuerungsmedium „Macht“ entscheidet ein anderer Code (gewählt - nicht gewählt) über Systemrelevantes. Als Steuerungsmedium der Publizistik gilt Publizität, Themen werden nach dem Code „veröffentlicht - nicht veröffentlicht“ bzw. „öffentlich - nicht öffentlich“ behandelt.“17
1.3 Die ökonomische Nutzbarmachung von Aufmerksamkeit
Der publizistische Markt konzentriert sich dem oben genannten systemtheoretischen Theoriemodell zufolge auf das Akkumulieren von Aufmerksamkeit; erst dann kommt es im Wirtschaftssystem zu Anschlusshandlungen - z.B. dem Kauf oder Abonnement des publizistischen Produkts oder der Schaltung von Anzeigen oder Werbespots.18
Diese Anschlusshandlungen sind nötig. Denn Aufmerksamkeit ist für sich genommen eine immaterielle Ressource; sie lediglich zu akkumulieren kann, für sich allein genommen, folglich nicht die Kosten decken, die für die Produktion eines Medienangebots anfallen. „Zuwendung und Aufmerksamkeit lassen sich nicht erzwingen.“, schreibt Theis-Berglmair, „Sie lassen sich - im Gegensatz zu marktgängigen Gütern - nicht ohne weiteres weitertauschen, da sie im Akt der Zuwendung unmittelbar ‚verzehrt’ werden.“19 Zur wirtschaftlich relevanten Größe wird Aufmerksamkeit für die Medienunternehmen erst dann, wenn es ihnen gelingt „Beachtungsreichtum zu akkumulieren“, so Theis-Berglmair. „Reich an Beachtung ist derjenige, der ständig, d.h. fortlaufend, mehr Aufmerksamkeit einnimmt, als er selbst geben könnte.“ Dieses Faktum trifft auf Medien (Aufmerksamkeitsbündelung durch Medienorganisationen20 ) ebenso zu wie auf Prominente (akteur- oder individuenbezogene Aufmerksamkeitsakkumulation21 ). - Eine Eigenschaft, die beide Gruppen in die Lage versetzt, Aufmerksamkeit wirtschaftlich nutzbar zu machen. Aufmerksamkeit steigt in den Rang einer Währung. „Sie ist akkumulier- und quantifizierbar und hat universellen Tauschwert“, schreibt Theis- Berglmair.22 Prominente bekommen vor allem deshalb hohe Gagen, weil ihre Auftraggeber sich von ihrer Popularität einen Nutzen versprechen - zum Beispiel durch höhere Verkaufszahlen an den Kinokassen, oder durch gesteigerte Umsatzzahlen dank prominent besetzter Werbespots.
Im Falle der Medien „wird Aufmerksamkeit gesammelt und als „Paket“ an die werbetreibende Wirtschaft gegen Geld eingetauscht“, schreibt Theis- Berglmair.23 Das Bündeln von Aufmerksamkeit zeigt sich somit auch in ihrem Transformationsmodell der Publizistik. Medien wirken hier wie ein Brennglas, dass in der Lage ist, Lichtstrahlen zu bündeln. Dieser Vergleich ist treffend: Im Brennglas steigt die Hitze mit der Anzahl und der Stärke der gebündelten Strahlen. Bei Medien steigt statt der Hitze der Werbewert. Die Chance, zahlreiche Menschen gleichzeitig mit Werbebotschaften zu erreichen, macht Medien für werbetreibende Unternehmen und Institutionen attraktiv. Aus einem für sich genommen immateriellen Gut entsteht durch Bündelung und Tausch von Werbezeit oder Werbeplatz gegen Geld ein materieller Vorteil.24
Eine zusätzliche Differenzierung in Anzahl und mutmaßliche Stärke der Aufmerksamkeits-Strahlen macht bei der genannten Theorie Sinn. Denn der Werbewert eines Mediums richtet sich nicht ausschließlich danach, wie viele Menschen erreicht werden, sondern auch welche Menschen erreicht werden. Gut belegen lässt sich dies anhand der Johannes Ludwig beschriebenen Werbeträgereigenschaften:
„Regelmäßig erscheinende Produkte wie Zeitschriften und Tageszeitungen, Fernsehen oder Internetauftritte weisen durch ihre Periodizität bereits eine von mehreren Werbeträgereigenschaften auf. Weitere notwendige Eigenschaften bestehen in der Existenz einer definierbaren Zielgruppe und deren Qualität für die werbetreibenden Auftraggeber, in der Akzeptanz von Werbung durch den Rezipienten und in der finanziellen Ergiebigkeit für das Unternehmen.“25
Vor allem private Fernsehsender betonen oft, dass sie vor allem ein jüngeres Publikum erreichen, weil Marketingstrategen Menschen ab 50 eine geringere Konsumbereitschaft nachsagen als den 14- bis 49-Jährigen. Auch Zeitungs- und Zeitschriftenverlage weisen gern darauf hin, wenn unter ihrer Leserschaft angeblich mehr konsumfreudige Besserverdiener befinden.26 Und Fachzeitschriften können auch mit kleineren Auflagen einen respektablen Werbewert erzielen, weil Unternehmen aus der jeweiligen Branche wissen, dass sie hier viel zielgerichteter werben können, als in einem General Interest-Blatt. Eine hohe verkaufte Auflage oder Einschaltquote ist somit zwar ein Indikator für Werbewert, aber nicht der einzige. Ob es sinnvoll ist, die Konsumfreude von Menschen an ihrem Alter festzumachen, oder ob bestimmte Märkte einfach noch nicht hinreichend erschlossen sind, sei dahingestellt. Zumindest aber ist die öffentliche Einordnung von Rezipienten in werbewirtschaftlich interessante und weniger interessante Zielgruppen bereits ein Teilaspekt der anfangs genannten Tendenz zur Kommerzialisierung, von der im Verlauf dieses Kapitels noch häufiger die Rede sein wird.
1.4 Medien im Spannungsfeld zwischen öffentlichem Auftrag und kommerziellen Interessen
Bei dem von Theis-Berglmair beschriebenen „unit act“ der Publizistik, Information gegen Aufmerksamkeit, handelt es sich zweifelsohne um einen immateriellen Tauschprozess. Aus dieser Feststellung lässt sich jedoch nicht ableiten, dass Medienhäuser grundsätzlich frei von ökonomischen Interessen sind. Denn nur weil der Rezipient in immer selteneren Fällen für Informationen zahlen muss, heißt dies nicht, dass Medienunternehmer sie grundsätzlich aus rein altruistischen Motiven anbieten. Fakt ist zwar, dass eine Dienstleistung, in diesem Fall das Bereitstellen von Informations- und Unterhaltungsangeboten, oft nur zu einem Bruchteil oder gar nicht direkt von demjenigen bezahlt wird, der diese Dienstleistung in Anspruch nimmt. Aber das bedeutet keineswegs, dass diese Dienstleistung grundsätzlich unentgeltlich, also ehrenamtlich, erbracht wird. Es heißt vielmehr, dass das jeweilige publizistische Produkt entweder ganz oder zumindest zu einem maßgeblichen Teil aus anderen Quellen finanziert wird.
Die Akkumulation von Aufmerksamkeit ist unter rein ökonomischen Gesichtspunkten weder Endziel noch Selbstzweck eines gewinnorientierten Medienunternehmens; sie ist vielmehr Mittel zum Zweck. Der publizistische Markt wird bedient, damit auf dem Wirtschaftsmarkt Anschlusshandlungen erfolgen können. So wird Aufmerksamkeit gegen Geld getauscht und damit wirtschaftlich nutzbar gemacht. Den größten Teil machen hierbei in den meisten Fällen die Werbeeinnahmen aus, andere Finanzierungsquellen sind beispielsweise Merchandising, Clubmitgliedschaften, Einnahmen aus Telefon-Hotlines und der Kartenverkauf (z.B. für eigene Sendungen oder in den Zeitungshäusern stellvertretend für andere Veranstalter). Bei Medienkonzernen können zudem Synergien zwischen unterschiedlichen Sparten des Unternehmens entstehen. Der Erfolg einer Casting-Show wie „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL gab einem Medienkonzern wie Bertelsmann beispielsweise die Möglichkeit, den Erfolg des mehrheitlich hauseigenen Senders nicht nur zum Generieren von Werbeeinnahmen zu nutzen. Auch die Folgeerträge aus dem Verkauf von CDs blieben in der Firmenfamilie, weil dafür das eigene Label BMG genutzt werden konnte. So immateriell der beschriebene „unit act“ der Publizistik auch sein mag, so materiell sind also die Interessen, die seitens vieler Medienunternehmen dahinter stehen.
Nicht dennoch sondern gerade deshalb macht aber die Trennung eines publizistischen Markts vom Wirtschaftsmarkt Sinn. Denn so lässt sich am besten verdeutlichen, dass sich Medien in einem Spannungsfeld befinden.27
Einerseits haben sie als eigenständiges Funktionssystem der Gesellschaft einen spezifischen Auftrag zu erfüllen. Ihr Umgang mit der ihnen geschenkten Aufmerksamkeit ist in einer Demokratie einerseits mit einer großen gesellschaftlichen Verantwortung und hohen normativen Erwartungen28 hinsichtlich ihrer informierenden und meinungsbildenden Funktion sowie ihrer Fähigkeit zu Kritik und Kontrolle der Staatsgewalt verknüpft. Diese Funktionszuweisungen konkretisieren ihre öffentliche Aufgabe und schlagen sich in den Pressegesetzen nieder. Andererseits sind viele Medienhäuser aufgrund der genannten Anschlusshandlungen im Wirtschaftssystem auch gewinnorientierte Unternehmen.29 - Tom Koch beschreibt diesen Zwiespalt in seinem Buch Journalism for the 21st Century: „Daily journalists, like their employers, are faced with balancing economic necessity against both the institutional and the instrumental myths that culturally define their professional function”30 Zwar ist es fragwürdig, normative Funktionszuweisungen salopp als Mythen zu bezeichnen, Kochs Schlussfolgerung aus diesem Konflikt ist jedoch zutreffend: „Reporters’ and editors’ livelihoods and the journalistic forum itself thus continually must balance functional self-interest (the necessity for sustained corporate profits) with professional values of objectivity and the self-esteem and professional acclaim that accrues from the acquisition of journalistic coup.”31
Kommerzialisierung kann bedeuten, dass der gesellschaftliche Auftrag in zugunsten von pekuniären Interessen in den Hintergrund tritt. Die von Donsbach beschriebene „Ablösung eher inhaltlich-publizistischer Verlegerpersönlichkeiten durch anonyme, rein nach ökonomischen Interessen geführte Konzerne“32 trägt zu dieser Entwicklung bei - genauso wie die Entscheidung mancher Medienhäuser, Chefredakteure zu bescheinigt.“ Mitgliedern der Geschäftsführung zu ernennen. Ziel ist hierbei meist, so Donsbach, die Chefredaktion „in die Verantwortung für das Betriebsergebnis einzubinden und zweitens über sie einen Einfluss auf redaktionelle Entscheidungen nach ökonomischen Gesichtspunkten nehmen zu können.“33
1.5 Kommerzialisierung und Konvergenz als Prozesse
Vor dem beschriebenen Hintergrund besehen, ist es kein Widerspruch, einerseits vom steigenden Wert der immateriellen Ressource Aufmerksamkeit zu sprechen und andererseits eine Kommerzialisierung in der Medienlandschaft zu konstatieren. Vielmehr scheinen diese beiden Tendenzen ineinander zu greifen und sich gegenseitig zu bestärken. Der Gewinn wächst, je mehr Aufmerksamkeit erreicht wird. In Folge dessen wird der Publikumsgeschmack, "zu einem natürlichen Entscheidungskriterium für die Inhalte“, schreibt Donsbach.34 Gut beobachten lässt sich die Tendenz zur Kommerzialisierung u.a. am dualen Rundfunksystem in Deutschland.
Das Beispiel der öffentlich-rechtlichen Rundfunksender zeigt zunächst einmal, dass Medien nicht immer privatwirtschaftliche Unternehmen sind, sondern dass sie auch als Institutionen fungieren können, denen vom Staat bestimmte Aufgaben zugewiesen werden. So verfolgen öffentlich-rechtliche Sender als Anstalten des öffentlichen Rechts juristisch gesehen nicht das Ziel, Gewinne zu erwirtschaften, sondern müssen lediglich so viel Geld einnehmen, wie es für ihren Fortbestand und die Erfüllung der ihnen zugewiesenen Funktionen notwendig ist. Während sich der öffentlich- rechtliche Rundfunk zu einem erheblichen Teil aus Gebühreneinnahmen finanziert, generieren Privatsender ihre Einnahmen, wie erwähnt, vor allem aus Werbung und Merchandising, für die Nutzung an sich entstehen dem Zuschauer keine direkten Kosten.
Im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte haben die öffentlich-rechtlichen Sender jedoch einen erheblichen Teil der Aufmerksamkeit der Fernsehzuschauer, die ihnen zuvor zuteil wurde, an die privaten Fernsehsender abtreten müssen. Das bleibt nicht ohne ökonomische Konsequenzen, denn die Rundfunkgebühren sind zwar eine wichtige aber nicht die einzige Finanzierungsquelle der öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender. Auch wenn sie aufgrund der Werbebeschränkungen die gewonnene Aufmerksamkeit nicht im selben Maße ökonomisch nutzbar machen können wie die Privatsender, so tragen die Einnahmen aus dem Ausstrahlen von Werbespots, also der Tausch Aufmerksamkeit gegen Geld, doch erheblich zur Finanzierung des Programms bei.
Der daraus resultierende Wettbewerb zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Programmanbietern hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass erfolgreiche Sendeformate und Präsentationsstile der Privatsender von den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten nachgeahmt wurden - Beispiele bilden Seifenopern, Nachmittagstalkshows, Quizsendungen oder Boulevardmagazine.35
In der Medienwissenschaft fand diese Entwicklung in einer so genannten Konvergenz-Hypothese ihren Niederschlag. Diese besagt, dass sich die öffentlich-rechtlichen und privaten Hörfunk- und Fernsehprogramme in Präsentation und Inhalt immer stärker angleichen.36
Über den Spagat zwischen Anspruch und Boulevardisierung im öffentlichrechtlichen Rundfunk äußert sich Merten auch in seinem Werk Grundlagen der Kommunikationswissenschaft:
„Bei Beibehaltung ihrer Programmstruktur, so stand zu befürchten, würden ihnen Zuschauer und Zuhörer davonlaufen, so daß sie nur noch von einer marginalen Zielgruppe rezipiert werden würden (Marginalisierungshypothese). Veränderten die öffentlich-rechtlichen Sender jedoch ihr Programm in Richtung der privaten Sender, so würden sie nicht nur vergleichsweise überflüssig, sondern genügten auch ihrem gesetzlichen Programmauftrag zur Grundversorgung nicht mehr (Konvergenzhypothese).“37
Juristisch gesichert wurde der Fortbestand der öffentlich-rechtlichen Sender durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGe 83: 238), das am 5.2. 1991 entschied, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Bestandsgarantie haben müsse.38. Merten konstatiert, dass durch die Einführung des privaten Rundfunks die erwarteten positiven Folgen vor allem eine Vergrößerung der Informationsvielfalt sind nicht eingetreten sind. Den öffentlich-rechtlichen Sendern bleibe jedoch die Möglichkeit, um Gebührenerhöhungen zu werben und mit einem qualifizierten Programm aufzuwarten.39
Das Beispiel des dualen Rundfunksystem zeigt, dass der Blick auf die Einschaltquoten an Bedeutung gewonnen hat, weil das Konkurrenzfeld größer geworden ist. Denn der Wert der Aufmerksamkeit wächst, weil sie, wie bereits erwähnt, schwieriger zu gewinnen ist. „In einer mitteilungsreichen Gesellschaft ist es die Aufmerksamkeit, die knapp und daher begehrt ist“; schreibt Anna Maria Theis-Berglmair. Ob es deshalb die Aufgabe öffentlich-rechtlicher Fernsehanstalten ist, die Formate der Privatsender um gebührenfinanzierte Varianten zu ergänzen, sei dahingestellt. In jedem Fall trifft der Begriff Kommerzialisierung auf die deutsche Rundfunklandschaft in unterschiedlicher Hinsicht zu: Zum einen, weil durch den Erfolg der privaten Fernseh- und Radiosender ein immer größerer Teil der akkumulierten Aufmerksamkeit der Rezipienten in den oben beschriebenen Tauschprozessen ökonomisch verwertet wird. Zum anderen, weil die öffentlich-rechtlichen Sender kommerziell erfolgreiche Programmideen der privaten Sender übernommen und sich somit in einen Wettbewerb mit kommerziellen Anbietern begeben haben.
Die Konvergenz-Hypothese wird in der Medientheorie mittlerweile nicht nur auf in Bezug auf die beiden Anbietergruppen im dualen Rundfunksystem angewendet, sondern besagt auch, dass sich die Medien im Zuge des sich verstärkenden Wettbewerbs in punkto Themenauswahl und - präsentation insgesamt immer weiter annähern. - Eine Entwicklung, die auch bei den journalistischen Akteuren selbst mitunter Skepsis an der eigenen Branche auslöst. Menso Heyl, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts konstatiertAbendblatts konstatiert im „journalist“: „Früher hat es die Scheidung von Willy Brandt nicht in die ‚Tagesthemen’ oder ins ‚Heute Journal’ geschafft. Die Scheidung von Diana hat später aber ganze Sendungen gefüllt.“40 ZDF- Chefredakteur Nikolaus Brender beschreibt die Gefahr eines mit der zunehmenden Konvergenz eingehenden Glaubwürdigkeitsverlustes: „Wenn Programme und Zeitungen sich zunehmend angleichen, traut der Rezipient seiner Zeitung, seinem Radio- oder Fernsehprogramm nichts Besonderes mehr zu. Jedem ist dann alles zu glauben - oder nichts.“41
Kommerzialisierung beschreibt einen Prozess und keine von vorn herein feststehende Systemimmanenz innerhalb der Medienwelt. Fakt ist zwar, dass jedes Medium Geld benötigt, um existieren zu können. Fakt ist aber auch, dass die Bedingungen, unter denen dieses Geld den Unternehmen zufließt, und die Quellen aus denen es kommt, unterschiedlich sein können. Eine entscheidende Determinante ist hierbei der Grad des Wettbewerb, in der sich Medien befinden. Je stärker die Konkurrenz ist, desto schwieriger wird es für jedes einzelne Medium, Aufmerksamkeit zu akkumulieren. Aus gefragten Informationsvermittlern werden Nachfragende, die sich mit unterschiedlichen Strategien um die Aufmerksamkeit der potentiellen Rezipienten bewerben.
Wettbewerbsfördernd wirkt dabei, dass Entscheidungen für oder gegen die Wahl bestimmter Medienangebote sich häufig als so genannte low cost decisions bezeichnen lassen; im Gegensatz zu einer Entscheidungsfrage wie „Soll ich ein Haus kaufen oder Miete zahlen?“, erfordert oder vermeidet eine Entscheidung über die momentane Mediennutzung in der Regel keinerlei großen Geld- oder Arbeitsaufwand.42 Michael Jäckel beschreibt dies so:
„Entscheidungen für die Nutzung bestimmter Medieninhalte sind jederzeit reversibel. Man kann aus- oder umschalten, das Buch oder die Zeitung zur Seite legen, sich einem anderen Artikel zuwenden, auf eine andere Website surfen usw. Hinzu kommt eine hinreichende Transparenz der Kosten. Die monetären Kosten im Falle von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften sind überschaubar, im Falle des gebührenfinanzierten Rundfunks sind die regelmäßig anfallenden Ausgaben kalkulierbar und unabhängig von der Nutzungsintensität konstant.“43
Für die Nutzer sind die so genannten Opportunitätskosten, die mit einem Wechsel des genutzten Mediums einhergehen, also meist gering, für die Medien aber sind die Auswirkungen bedeutend, wenn sich viele Nutzer ähnlich entscheiden.
1.6 Medienkonkurrenz und ihr Einfluss auf publizistische Konzepte
Konkurrenz belebt nicht nur die Medienlandschaft, sie verändert auch ihre Spielregeln. Anders gesagt: Der verstärkte Wettbewerb um die Aufmerksamkeit und die damit verbundene Konzentration auf das Interesse der Rezipienten bleibt meist nicht ohne Folgen für die publizistischen Konzepte. Medien, die sich in einer starken Konkurrenzsituation befinden, blicken in der Regel stärker auf Einschaltquoten, Auflagen- oder Abonnentenzahlen, als es bei Medien in einer unangefochtenen Stellung der Fall ist. „Dem ökonomischen Ansatz zufolge führt insbesondere Wettbewerb in der Regel zu Vielfalt, da die Anpassung des Angebots an die Konsumentenpräferenzen eine der wesentlichen Funktionen des Wettbewerbs ist“, schreiben beispielsweise Czygan und Kallfaß. Die Frage ist nur, ob im Falle der Medien wirklich um Vielfalt im Sinne einer größer gewordenen Palette konzeptionell unterschiedlich ausgerichteter Medienangebote handelt? Oder ob es nicht eher das ist, worauf die Kovergenz-Hypothese schließen ließe, nämlich um eine Vielzahl publizistischer Programme, die zwar nicht exakt dasselbe bieten, aber konzeptionell häufig das Gleiche?44
Norbert Jonscher nimmt zur Frage nach dem Einfluss des Wettbewerbsgrads auf die Medienvielfalt am Beispiel der lokalen Publizistik Stellung:
„Daß Medienwettbewerb allein bereits eine ausreichende Aussagenvielfalt evoziert, muß dagegen stark bezweifelt werden, das heißt, daß Gruppen ihre Interessen leichter gegen Redaktionen durchdrücken können. Bei nur einem Lokalmedium am Ort besteht dagegen für beide Seiten ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis, denn auch die Gruppen sind ja letztlich auf die Medien zur eigenen Unterrichtung und Veröffentlichung ihrer Informationen (Anzeigen, Mitteilungen) angewiesen.“45
Das Paradoxon der Medienentwicklung ist, dass der wachsenden Auswahl von Medienangeboten eine immer kleiner werdende Zahl von anbietenden Unternehmen gegenübersteht. Große, teils sogar multinationale Medienkonzerne bestimmen einen immer größer werdenden Teil des publizistischen Angebots. Eine synergetische Mehrfachwertung von Inhalten ist oft die Folge, dies ist beispielsweise der Fall, wenn die selben Nachrichtenbeiträge auf unterschiedlichen Fernsehsendern zu sehen sind. In einigen Fällen wächst diese Kultur der Mehrfachwertung sogar zu einer Gefahr für die publizistischen Vielfalt heran: Gut beobachten lässt sich dies an der Entwicklung des Zeitungsmarktes in den letzten fünf Jahrzehnten: Mit dem Begriff der publizistischen Einheit werden Zeitungsausgaben zusammengefasst, deren Mantelteil in wesentlichen Teilen übereinstimmt. Deren Zahl ist von 225 im Jahre 1954 auf 136 im Jahr 2001 gesunken. Gravierende Veränderungen gab es auch bei der Herausgeberschaft: Im Jahr 1954 waren es noch 634 Verlage, die 1500 Zeitungen herausgaben. Im Jahr 2001 gab es insgesamt 1584 verschiedene Zeitungsausgaben, die von 356 Verlagen herausgegeben wurden.46
Primärer Konkurrenzfaktor ist also derzeit nicht etwa eine steigende Zahl von Medienunternehmen sondern eine gewachsene und weiter wachsende Zahl von Medienangeboten, Mediengattungen und Distributionsmöglichkeiten für journalistische Inhalte. Nicht selten handelt es sich um eine unternehmensinterne Konkurrenz, etwa bei jenen Medienkonzernen, die in einem Land gleich mehrere Fernsehsender unterhalten. Sie wissen, dass ein Sender dem anderen möglicherweise Aufmerksamkeit wegnimmt, aber da sich mit mehreren Sendern leichter unterschiedliche Publikumsinteressen bedienen lassen, rechnen sie damit, dass die Summe der insgesamt dazu gewonnenen Aufmerksamkeit größer ist, als wenn sie nur einen Fernsehsender betreiben würden.
Unabhängig davon welche Faktoren sich als Motor von Konkurrenz erweisen: Entscheidend für dafür, ob es sich um eine Vielfalt oder eine Vielzahl handelt, ist vor allem die Frage wie autonom die einzelnen Medien in ihren publizistisch-inhaltlichen Entscheidungen sind, und wie sie dem gestiegenen Wettbewerb um die Aufmerksamkeit begegnen. Hier einige Szenarien:
Konkurrenz als Initialzündung für Innovationen
Eine mögliche Auswirkung des Wettbewerbs ist, dass innerhalb von Redaktionen bürokratische Strukturen, traditionelle publizistische Schemata, klassische Ressortaufteilungen und altvertraute Arbeitsroutinen hinterfragt werden und möglicherweise flexibleren Abläufen und neuen inhaltlichen Konzepten weichen.47 Von diesen Möglichkeiten wird in dieser Ausarbeitung noch häufiger die Rede sein.
Boulevardisierung als partikularer Funktionsverlust Steigende Konkurrenz kann aber auch zur Folge haben, dass Medien mit verstärktem Blick auf die Quote nicht mehr die normativen Funktionen erfüllen, die ihnen in einer Demokratie zufallen. Trifft letzteres Szenario zu, dann kann Konkurrenz zur Kommerzialisierung führen und zugleich Popularisierung, oder enger gefasst, Boulevardisierung mit sich bringen. Boulevardmedien bedienen bestimmte publikumswirksame traditionelle Funktionen wie Unterhaltung (z.B. durch Geschichten über Prominente) und neuere wie Service (z.B. durch Verbrauchertipps) zwar durchaus, andere Funktionen treten jedoch in den Hintergrund. So erfüllen sie den Bildungsanspruch, der Medien in der vielzitierten Wissens- und Informationsgesellschaft zukommt, durch ihre Themenauswahl -und in manchen Fällen auch durch ihren Satzbau- nur sehr bedingt. Kritik und Kontrolle an gesellschaftlichen Vorgängen üben sie zwar (z.B. bei Korruptionsfällen und Steuererhöhungen), als sachliche Moderatoren gesellschaftlicher Diskurse erweisen sie sich jedoch selten, da sie oft Bericht- und Kommentarelemente vermengen und somit mehr der Emotionalisierung als der Meinungsbildung dienen48 - auch wenn sie in der Werbung anderes behaupten („Bild Dir Deine Meinung“49 ).
„Die Popularisierung des Journalismus zeigt - in einer systemtheoretischen Perspektive - deutlich die Ausdifferenzierung seiner Primärfunktion hin zu Zeitvertreib und Alltagsspaß, auf Unternehmerseite aber auch zu Profitmaximierung“50, konstatieren Renger und Habit. Zu einem ähnlichen Urteil kommt auch Jim Hall: „News on the web as in the traditional media is now led by scandal, celebrity watching, weather reports, sports scores, the market, health and lifestyle, and consumer information including listings“51, konstatiert er und benennt sogleich jene Themen, die bei dieser Auswahl weniger Berücksichtigung finden. „News that are not amenable to spectacularisation - the more complex issues that demand economic or political analyses - are summarised and may well eventually disappear from broadcast systems.”52
Der Begriff Boulevardisierung verweist seinem Ursprung nach auf die Boulevardzeitungen. Diese heißen deshalb so, weil sie nur selten im Abonnement bezogen werden können, sondern beim Kiosk um die Ecke oder eben auch bei Zeitungshändlern an den großen Boulevards gekauft werden können. Das heißt im Umkehrschluss: Boulevardzeitungen versuchen durch ihre Schlagzeilengestaltung Aufmerksamkeit zu gewinnen und Einfluss auf das Kauf- und Leseverhalten zu nehmen; denn ihre Leser zahlen nicht monatlich für den Bezug, sondern täglich. Bei manchen Stammlesern mag dies keinen Unterschied machen. Randleser müssen jedoch jeden Tag neu erreicht werden. Je nach Nachrichtenlage und Interesse an den Seite-1-Themen variiert deshalb die Zahl der verkauften Exemplare. Bei Abonnementzeitungen sind diese Schwankungen hingegen deutlich geringer, weil sie nur einen geringen Teil ihrer Auflage im Händler- oder Automatenverkauf absetzen.
Das Prinzip, sich Aufmerksamkeit zu erkämpfen, ist Boulevardblättern deshalb schon länger vertraut als beispielsweise den Abonnementzeitungen oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Das macht den Begriff der Boulevardisierung umso bedeutender, wenn es um den Wandel in der Medienlandschaft geht. Denn er vereint zwei Tendenzen, die in einem Zusammenhang miteinander stehen. Boulevardisierung deutet einerseits auf den Kampf der Medien um Aufmerksamkeit und die Wahlmöglichkeiten des Rezipienten hin, der, wie auf einem großen Boulevard, unterschiedlichen Interessen nachgehen kann. Boulevardisierung ist andererseits aber auch eine -aus diesem Wettbewerb mitunter resultierende- Tendenz der inhaltlichen und optischen Gestaltung von Medien.
Steigender Aktualitätszwang als publizistisches Risiko Ein verschärfter Wettbewerb unter den Medien kann auch bedeuten, dass diese sich einem immer stärkeren Zwang zur Aktualität aussetzen - ein an sich lobenswerter Vorsatz, der aber mit unangenehmen Nebenwirkungen behaftet sein kann: „Ich fürchte, dass Presse und Medien täglich mehr Enten produzieren, als wir ahnen“, sagt beispielsweise ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender und fordert: „Penible Recherche darf nicht von der Droge Schnelligkeit überholt werden.“53 Dort wo Medien in Konkurrenz zueinander stehen, wächst das Bedürfnis, etwas zu vermelden, was der Mitbewerber noch nicht hat; gleichzeitig wird aber auch die Gefahr größer, dem Rezipienten unzureichend recherchierte und im schlimmsten Fall völlig unzutreffende Informationen vorzusetzen. „Der Grat zwischen sehr aktuell und sehr peinlich ist schmaler denn je“, sagt Tagesspiegel-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo und gibt zu: „Auch wir haben beim Rattenrennen um die Exklusivität manche Meldung zu schnell herausgeschossen.“54 Hinzu kommt, dass eine vermeintliche Exklusiv-Meldung auch andere Medien nachziehen lässt, die die Recherchen der Konkurrenz mitunter ungeprüft übernehmen. „The fact that news providers report a story, even when it’s offered as unconfirmed, in itself gives the it the credibility to merit repetition“, konstatiert Jim Hall.55 Hierbei kann ein fragwürdiger Veredelungsprozess einsetzen, wenn sich z.B. Qualitätszeitungen in ihrer Berichterstattung auf Boulevardmedien stützen - wie z.B. im „Fall Sebnitz“ oder der plötzlichen Medienpräsenz von „Florida Rolf“.56 „Der Wettbewerb um Aktualität, Exklusivität und Sensationen scheint die Unart der Nicht- Recherche -frei nach dem Motto: Die Konkurrenz hat das für uns erledigt - zu verstärken“, schreibt Wolfgang Scheidt im „journalist“57. Menso Heyl, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts hält diese Entwicklung auch in Bezug auf das Ansehen des Berufsstandes für bedenklich: „Der Glaubwürdigkeitsverlust setzt dann ein, wenn Redaktionen nur noch Verwerter von Fremdmeldungen, der Agenturen zum Beispiel, sind und zur eigenen journalistischen Anstrengung nicht mehr fähig.“58 Hinzu kommt: Wann immer Falschmeldungen herausgeschossen werden, tritt eine Situation ein, in der Medien ihre Informationsfunktion nicht nur nicht erfüllen, sondern in der sie das Gegenteil von dem leisten, was sie leisten sollen. Desinformation wird hier an die Stelle von Information gesetzt. Es würde allerdings zu kurz greifen, wenn die Auswirkungen dieses Funktionsversagens nur in Bezug auf die Beziehung zwischen Medium und Rezipient gesehen würden. Denn falsche Berichterstattung kann auch die Menschen, über die berichtet wird, öffentlich brandmarken und ihr Verhältnis zur Umwelt langfristig trüben. Bei den Folgen falscher Berichterstattung handelt es sich also mitunter um deutlich mehr als um ein rein funktionelles Leistungsversagen wie etwa im Falle eines defekten Wasserhahns im Hotelzimmer. Das Thema hat auch eine ethische Dimension, die aus dem Spannungsfeld zwischen Freiheit und Verantwortung journalistischer Berufe resultiert.
[...]
1 Vgl. Beck, 2002; S. 83-85; Wilke., 2003, S. 477
2 Vgl. Mathes / Donsbach; 2003; S. 568 ff, Sennewald, 1998, S. 163
3 Vgl. Paschen u.a. 2002, S. 37
4 S. 96) verweist auf die Notwendigkeit von Medienkompetenz zum publizistischen Qualitätserhalt: „Grundsätzlich besteht die Gefahr, dass Medienorganisationen, nachdem sie erst einmal die Rezipienten mit Medienmarken- Argumenten überzeugt haben, im Laufe der Zeit aus Kostengründen die inhaltliche Qualitätsorientierung zurückfahren und sich auf ihren guten Ruf verlassen. Deshalb ist es unabdingbar, dass RezipientInnen darin unterstützt werden, Medienkompetenz aufzubauen und dadurch in die Lage versetzt werden, dauerhaft die Qualität der Inhalte besser beurteilen zu können.“
5 Vgl. Sennewald, 1998, S. 69/70
6 siehe Beck, 2002, S. 6 ff.
7 Beck, 2002; S. VI
8 Beck, 2002; S. 9
9 Friedrichsen, 2002, S. 67
10 Nichtrivalität im Konsum und Nicht-Ausschließbarkeit vom Konsum gelten als ökonomische Kriterien; erfüllt ein Gut beide Kriterien, gilt es als öffentliches Gut. (Vgl. Beck, 2002, S. 12ff; Friedrichsen, 2002, S. 67; Kulenkampff, 2000, S. 61ff). Medien selbst gelten zumindest per definitionem nicht als klassische öffentlichen Güter, da der Ausschluss vom Konsum (s.o.) vielfach möglich, wenn auch nur selten erwünscht ist. (Vgl. Beck, 2002, S. 14) Nichtsdestoweniger werden Medieninhalte (z.B. Informationen)durchaus als öffentliche Güter bezeichnet. (Vgl. Kiefer, 2003, S. 206) Beck empfiehlt zwischen Informationen als oftmals öffentlichem Gut und den Dienstleistungen der Medienunternehmen (Selektion, Aufbereitung und Vertrieb von Informationen) zu trennen, da bei letzteren ein Ausschluss vom Konsum möglich ist. Auch der öffentliche Auftrag von Medien deutet Beck zufolge nicht darauf hin, dass es sich bei ihnen per se um öffentliche Güter handelt, sondern dass sie eine öffentliche Funktion haben.
11 Beck, 2002, S. 10
12 Vgl. Van Eimeren / Ridder, 2002, S. 80
13 Sennewald, 1998, S. 112
14 Die Unterteilung in eine direkte und eine indirekte Beteiligung an der Medienfinanzierung macht Sinn. Rezipienten beteiligen sich dann indirekt an der Medienfinanzierung, wenn sie die in den Medien beworbene Produkte kaufen. In deren Preisgestaltung fließen die Kosten für Werbung mit ein.
15 Theis-Berglmair, 2000, S. 314
16 Ebd.
17 Theis-Berglmair, 2000, S. 310; vgl. hierzu auch die ausführliche Darstellung von Luhmann (1987, S. 625 ff), der in seinem Buch Soziale Systeme u.a. die spezifische Operationsweise verschiedener Gesellschaftssysteme erläutert, die sie von anderen Systemen unterscheidbar und abgrenzbar macht.
18 Vgl. Pethig, 2003, S. 145: „Werbung ist die Verbreitung von Werbegütern unter Verwendung eines Mediums im engeren Sinn mit dem Ziel, die Einstellung von Konsumenten zu dem beworbenen Produkt in einer für Absatz und/ oder Image des Unternehmens günstigen Weise zu beeinflussen“.
19 Theis-Berglmair, 2000, S. 316
20 Ebd. S. 319
21 Ebd. S. 318
22 Ebd. S. 316
23 Theis-Berglmair, 2000, S. 319. Vgl. hierzu auch Sennewald (1998, S. 72), die Aufmerksamkeit als Indikator für die Wirkungswahrscheinlichkeit einer Werbebotschaft beschreibt.
24 Dieses Prinzip ist seit langem bekannt. Bohrmann schreibt zur Werbefinanzierung: „Dass die Presse (vor allem Tageszeitungen, illustrierte Zeitschriften und andere Blätter in hoher Auflage) als Koppelprodukt von Anzeigen und journalistischem Inhalt auftritt, hat man natürlich auch schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts genau gewusst.“ (2002, S. 113). Die Querfinanzierung mittels Werbung kristallisierte sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts heraus (Vgl. Ludwig, 2003, S. 204) , in Ansätzen war sie jedoch schon früher bekannt. Anfang des 18. Jahrhunderts gab es so genannte Intelligenzblätter (von intellegre = lat. für Einsicht nehmen) auf, die sich auch aus Anzeigeneinnahmen finanzierten (siehe Beck, 2002, S. 82).
25 Ludwig, 2003, S. 201 [Hervorhebung d. TJ]
26 Gut beobachten lässt sich dies an den Präsentationsbroschüren für potentielle Werbekunden, in denen Statistiken aus Rezipientenbefragungen veröffentlicht und kommentiert werden - hier ein Beispiel aus einer entsprechenden Publikation aus der Anzeigenabteilung der Frauenzeitschrift Brigitte: „Es gibt undefinierbare Frauen. Und es gibt Brigitte-Frauen. Unsere Leserinnen haben ein klares Profil und stehen mitten im Leben. Sie sind überwiegend 20 bis 49 Jahre alt, überdurchschnittlich gebildet, meist berufstätig und verfügen über ein hohes Haushaltseinkommen. Wer konsumstarke Frauen erreichen will, kommt an Brigitte nicht vorbei.“ (Brigitte-Profil, 2002, S.4)
27 Vgl. Renger / Habit, 2002, S. 189: „Journalismus und Ökonomie stehen in einem spezifischen Spannungsfeld zueinander. Hinsichtlich ihrer „Steuerungsmedien Publizität und Geld“ wird ihnen generell eine gegenseitige, wenn auch selektive Akzeptanz
28 Claudia Mast (1998, S. 137) fasst diese Erwartungen so zusammen: „Die öffentliche Aufgabe des Journalisten wird in den Pressegesetzen erläutert. Sie besteht darin, Nachrichten zu beschaffen und zu verbreiten, Stellung zu nehmen und Kritik zu üben, an der Meinungsbildung mitzuwirken und einen Beitrag zur Bildung zu leisten. Die Tätigkeit der Presse ist ein notwendiges Gegengewicht zur Staatsgewalt. Sie unterzieht diese der Kritik und wirkt an der öffentlichen Meinungsbildung mit.“
29 Vgl. Donsbach, 2003, S. 111/112
30 Koch, 1991, S. 13
31 Koch, 1991, S. 13
32 Donsbach, 2003, S. 111
33 Ebd.
34 Donsbach, 2003, S. 111
35 Eine weitere Folge der Wettbewerbssituation ist, dass das System der Gebührenfinanzierung häufiger in die Kritik gerät, da die Fernseh- und Radionutzung nicht mehr zwingend mit der Nutzung der öffentlich-rechtlichen Programmangebote gleichgestellt ist. Das heißt: Medienrezipienten, die lediglich die privaten Sender nutzen, sehen es mitunter nicht ein, dass sie andere Sender, die sie gar nicht nutzen möchten, aufgrund ihres staatlichen Auftrags und der vorhandenen Möglichkeit zur Nutzung, mitfinanzieren müssen. (Vgl. Pethig, 2003, S. 145.) Das ist zwar bei anderen öffentlich finanzierten Kultur- und Informationsangeboten (z.B. Theater, Museen) nicht anders, fällt aber im Fall der Rundfunkgebühren deutlicher auf. Zum einen, weil sie nicht als Abgabe sondern immer noch als Gebühr tituliert werden. Zum anderen, weil sie separat erhoben werden, und nicht, wie etwa der Anteil an den Kultursubventionen, in der gesamten Steuerlast des einzelnen Bürgers enthalten sind.
36 Vgl. Merten, 1993, S. 2 ff sowie Mathes / Donsbach, 2003, S. 591
37 Merten, 1999, S. 402
38 Vgl. hierzu auch Merten, 1999, S. 401; Mathes / Donsbach, S. 572
39 Merten, 1999, S. 401/402
40 Heyl zitiert nach Scheidt, 2004, S. 27
41 Brender zitiert nach Scheidt, 2004, S. 26
42 Vgl. Jäckel; 2003; S. 38
43 Jäckel, 2003, S. 38
44 Dreier (2002, S. 41) spitzt diese Frage noch weiter zu. Mit dem Titel „Vielfalt oder Vervielfältigung?“ hat er einen Beitrag über Medienangebote und ihre Nutzung im digitalen Zeitalter betitelt.
45 Jonscher, 1995, S. 504. Vgl. hierzu auch Hamm (1987, S. 67/68). Deren Studie ergab, dass Print- Radio- und lokale TV-Journalisten in Dortmund, einer Stadt mit großer lokaler Medienvielfalt aufgrund annähernd übereinstimmender Selektionskriterien häufig die selben Themen auswählten und aufgriffen. Sie zeigten ein positives, aufstrebendes Bild der Stadt, die hohe Arbeitslosigkeit schlug sich dagegen kaum in der Berichterstattung nieder.
46 Schütz, 2001, S. 602-603
47 Vgl. hierzu auch Sennewald (1998, S. 88), die insbesondere auf den lokalen Informationsmärkten angesichts hoher Markteintrittsbarrieren wenig Konkurrenz und dadurch eine geringen Grad an Produktneuerungen und innovativer Effizienz konstatierte.
48 Renger und Habit (2002; S. 192) beschreiben die Boulevardisierung am Beispiel der Boulevardzeitungen. „Boulevardzeitungen präsentieren allgemein eine dramatisierte, sensationalisierte und nicht selten fiktionalisierte Weltsicht.“ Als weitere Merkmale nennen sie u.a eine Konzentration der journalistischen Arbeitsschwerpunkte auf die Bereiche Lokales, Human interest’ und Sport sowie ein „niedriges Einstiegsniveau für die LeserInnen.“
49 Werbeslogan der Bild-Zeitung.
50 Renger / Habit; 2002; S. 193
51 Hall, 2001, S. 137
52 Ebd.
53 Brender zitiert nach Scheidt, 2004, S. 26
54 di Lorenzo zitiert nach Scheidt, 2004, S. 28
55 Hall, 2001, S.131
56 Vgl. Scheidt, 2004, S. 38 sowie Stern, 1/2004, S. 108-114
57 Scheidt, 2004, S. 26-28
58 Heyl; zitiert nach: Scheidt, 2004, S. 27/28
- Arbeit zitieren
- Thomas Joppig (Autor:in), 2004, Mehrwert bieten, mehr Wert schaffen: Perspektiven deutscher Tageszeitungen und ihres Online-Engagements, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25814
Kostenlos Autor werden
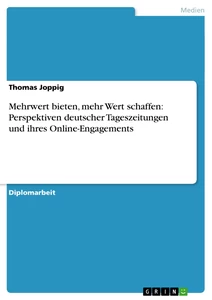













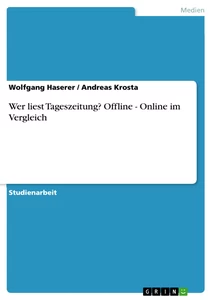
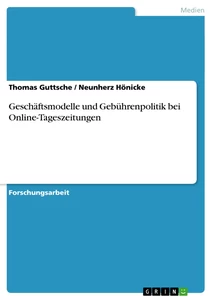



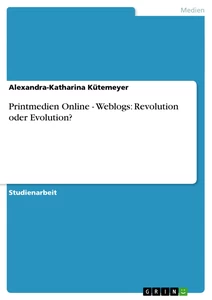
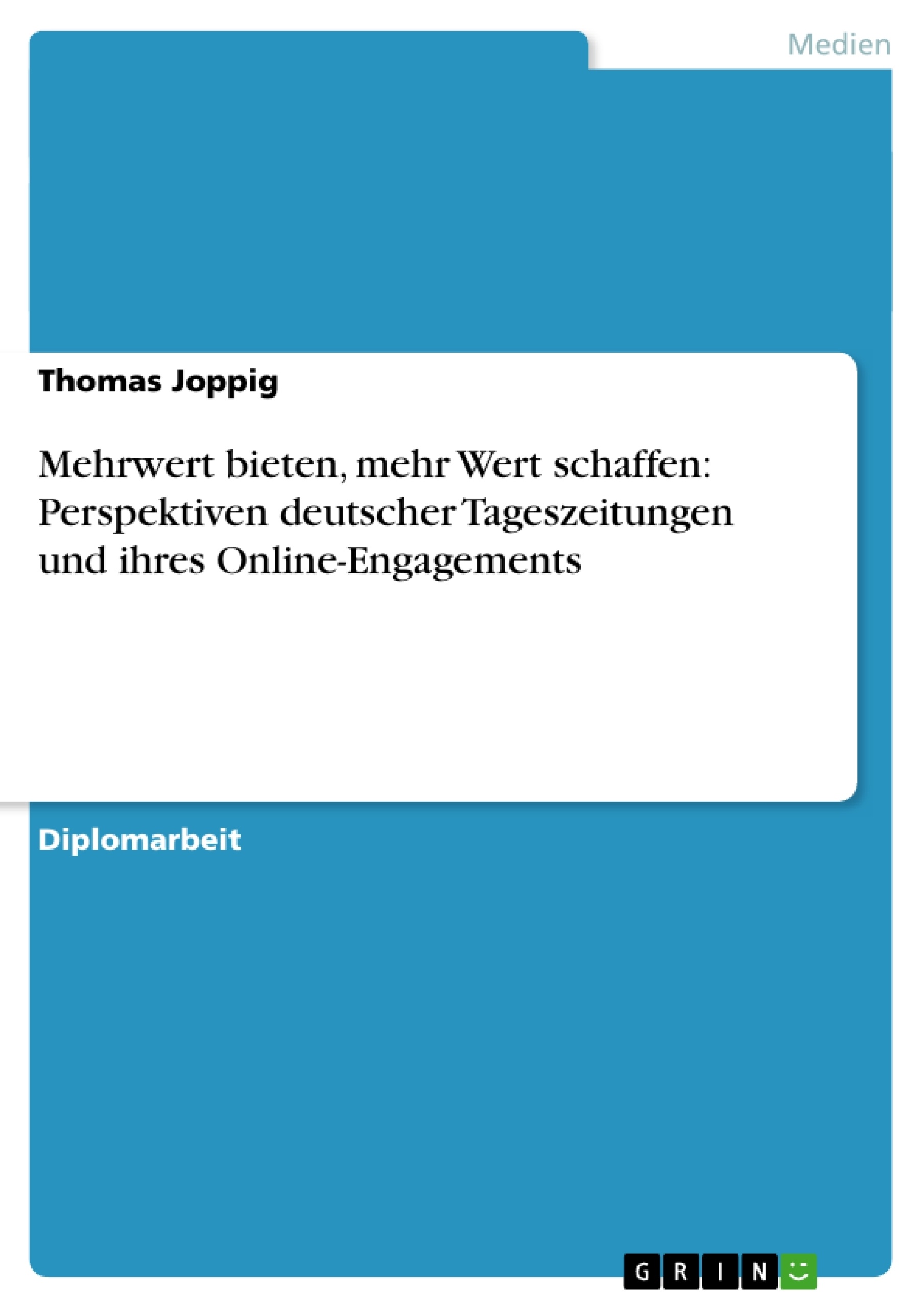

Kommentare