Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. SoD: Wesen – Einflussfaktoren – Wirkungen
2.1 Was ist eigentlich SoD? Herkunft und Geschichte des Begriffs
2.2 Perceived Reality – ein mehrdimensionales Phänomen
2.3 Rezeptionserleben
2.3.1 Unterhaltung als Makroemotion
2.3.2 Enjoyment – the core of Media Entertainment
2.3.3 Spatial Presence
2.4 Zusammenfassung und Ausblick auf die Empirie
3. Forschungsfragen
4. Methode und Design
4.1 Experimentaldesign und Stimulusauswahl
4.2 Fragebogenaufbau und Messung der Variablen
4.3. Unabhängige und abhängige Variablen
4.3.1 Die unabhängige Variable
4.3.2 Enjoyment – Operationalisierung
4.3.3 Enjoyment – Indices
4.3.4 Spatial Presence – Operationalisierung und Indexbildung
4.4 Auswahlverfahren der Versuchspersonen
4.5 Ablauf und Durchführung der Studie
5. Ergebnisse
5.1 Vorbereitende Datenanalyse
5.1.1 Ausschluss von Fällen
5.1.2 Treatmentchecks
5.1.3 Gesamtbewertung der Treatmentchecks
5.2 Die Zusammensetzungen der Gruppen
5.3 Vertiefte Auswertung
6. Schlussfolgerungen
6.1 Interpretation der Ergebnisse und Diskussion
6.2 Methodenkritik und Ausblick
7. Literaturliste
8. Anhang: Fragebogen Film Epilog
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Der Zusammenhang zwischen Perceived Reality und SoD
Abbildung 2: The complexity of Entertainment Experience
Abbildung 3: Tripartite Model of Media Enjoyment's Effects on Viewing and Content Related Behaviour
Abbildung 4: Das Zwei-Ebenen-Modell räumlichen Präsenzerlebens.
Abbildung 5: Das Versuchslabor
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Dimensionen der Perceived Reality
Tabelle 2: Korrelationsmatrix SoD-Items
Tabelle 3: Dimensionen von Enjoyment
Tabelle 4: Zusammenfassung Reliabilitätsanalyse
Tabelle 5: Treatmentcheck Sessel
Tabelle 6: Treatmentcheck Papierkorb
Tabelle 7: Treatmentcheck Telefon
Tabelle 8: Zusammenfassung Treatmentcheck sich bewegende Gegenstände
Tabelle 9: Treatmentcheck 1 SoD
Tabelle 10: Treatmentcheck 2 SoD
Tabelle 11: Geschlechterverteilung in den Gruppen
Tabelle 12: Durchschnittsalter nach Geschlecht in den Gruppen
Tabelle 13: Experimentalbedingungen in den Gruppen
Tabelle 14: Belief-, Disbelief- und SoD-Index – Mittelwerte in den Gruppen
Tabelle 15: Mittelwerte der AV-Indices in den Gruppen
Tabelle 16: Mittelwerte der Gesamtnote des Filmes innerhalb der einzelnen Gruppen
Tabelle 17: Varianzanalyse Bilanz-Index
Tabelle 18: Varianzanalyse Machart-Index
Tabelle 19: Korrigiertes R-Quadrat und F-Werte
Tabelle 20: Prämissenprüfung Varianzhomogenität Levene-Test
1. Einleitung
The Willing Suspension of Disbelief (nachfolgend stets SoD genannt) ist ein Konzept, welches schon früh Eingang in den Sprachgebrauch der Geisteswissenschaften fand – und neuerdings auch in den der Neuropsychologie und der empirischen Publizistikwissenschaft (vgl. Coleridge 1817; Holland 1967; Holland 2002; Böcking/Wirth 2005; Böcking/Wirth/Risch 2005). So haben Theater- und Literaturwissenschaftler sich immer wieder – implizit oder explizit – auf diesen Begriff berufen (vgl. Böcking/Wirth 2005: 3). Grundsätzlich meint man mit SoD die Tatsache, dass ein fiktionaler narrativer Medieninhalt – sei es die Geschichte in einem Roman, eine Theateraufführung oder ein Actionfilm – oftmals von Ereignissen oder Personen erzählt, die sich so in der „Realität“[1] nicht zutragen können. In „Crouching Tiger Hidden Dragon“ können die Protagonisten, scheinbar schwerelos, ihre Kämpfe in der Luft ausfechten – eine Fähigkeit, die jeder vernünftige Mensch keinem auch noch so begabten Schwertkämpfer zusprechen würde. Um einen solchen Film trotzdem geniessen zu können, indem man die Inhalte nicht ständig auf ihre Übereinstimmung mit der Realität prüft, muss ein Rezipient eine gewisse Toleranz gegenüber dem Gezeigten aufbringen, in dem Sinne, dass er inkonsistente Ereignisse oder logische Brüche im Plot nicht ständig hinterfragt, sein Nicht-Glauben also ausblendet. Neben den unrealistischen Inhalten gibt es aber auch noch andere SoD-auslösende Faktoren. Inhaltliche und logische Brüche in der Handlung oder unverständliche Handlungen können ebenfalls dazu führen, sein Disbelief zu suspendieren. Es scheint also ein wichtiger Bestandteil der Rezeption von narrativen fiktionalen Medieninhalten zu sein, sein Nicht-Glauben in den Hintergrund treten zu lassen, sich auf den Inhalt einzulassen, um sich selbst den Filmgenuss nicht zu verderben.
Böcking/Wirth/Risch (2005: 40) halten fest, dass sich zwar verschiedene Autoren des Begriffs bedient haben, dass aber „bislang ein einheitliches Verständnis von Willing Suspension of Disbelief, das auch für eine empirische Untersuchung dieses Phänomens fruchtbar gemacht werden könnte“, fehlt (Hervorheb. i.O.).
Verschiedene Faktoren können nun einen Einfluss haben, ob und in welchem Masse der Rezipient[2] bereit ist, sich auf den fiktionalen narrativen Inhalt einzulassen und somit SoD als Verarbeitungsmodus anzuwenden oder nicht. Als auslösender Faktor spielen die oben genannten Inkonsistenzen beim Medieninhalt eine wichtige Rolle. Der Rezipient wird dann – je nach Grad der Inkonsistenzen – verschiedene Rezeptionsmodi anwenden. Das ist folgendermassen zu verstehen: Menschen gehen mit unterschiedlichen Eigenschaften, Fähigkeiten und Interessen an einen Medieninhalt heran. Ob SoD als Verarbeitungsart gewählt wird oder nicht, hängt also von den Eigenschaften sowohl des Mediums als auch des Rezipienten ab (vgl. Suckfüll 2004: 13). Als Beispiele können auf der Rezipientenseite das Konzept Need for Cognition (z.B. Cacioppo/Petty 1982) und damit einher gehend Critical/Evaluativ Thinking (z.B. Vorderer 1991) sein. Auf Seiten des Mediums (oder dessen Inhalts) können logisch Brüche im Plot oder inkonsistente (oder unrealistische) Ereignisse als SoD auslösende Eigenschaften genannt werden. Des Weiteren stellt sich auch die Frage, welche Erwartungen Menschen an einen Medieninhalt haben, welche Hypothesen sie über resp. welche Erwartungen sie an diesen haben (vgl. z.B. Rusch 1997:129). Während der Rezeption kann der Rezipient verschiedene Strategien (Rezeptionsmodalitäten) anwenden, mit dem Inhalt umzugehen. Dabei kann er zwischen unterschiedlichen Rezeptionsmodi (interessierte (i.e. kritisch distanzierte) vs. involvierte Rezeption) hin und her wechseln (vgl. Suckfüll 2004: 120ff, Vorderer 1991: 165ff).
SoD hängt also von verschiedenen Faktoren sowohl auf der Seite des Mediums resp. dessen Inhalt als auch auf der Seite des Rezipienten ab. Umgekehrt ist SoD unter anderem auch dafür verantwortlich, ob und wie sehr sich ein Rezipient unterhalten fühlt, oder allgemeiner, wie der Rezipient sich während der Rezeption gefühlt hat. Und genau hier liegt der Fokus der vorliegenden Arbeit. Sehr allgemein formuliert interessiert folgende Frage. Wer erlebt bei wie viel SoD (resp. Glauben oder Nicht-Glauben) die Rezeption eines fiktionalen narrativen Medieninhalts auf welche Art und Weise? Um dies herauszufinden, wurde ein Experiment durchgeführt, bei dem den Versuchspersonen (nachfolgend Vpn) jeweils unterschiedlich (in-)konsistentes Filmmaterial gezeigt wurde, unter der Annahme, dass ein konsistenterer Inhalt zu weniger SoD bei den Vpn führt als ein weniger konsistenter Inhalt. Nach der Rezeption des einen oder anderen Inhalts (konsistent vs. (leicht/stark)inkonsistent), bei dem weniger oder eben mehr SoD zum Einsatz kam, sollten sich die Rezipienten – so die Annahmen – auch anders fühlen oder anders über das Gesehene nachdenken (für die genauere Methodenbeschreibungen s. Kap. 4).
Die Arbeit ist folgendermassen aufgebaut: Zuerst soll genauer auf das Phänomen SoD eingegangen werden (s. Kap. 2). Es soll geklärt werden, welche Faktoren auf der Medien- und der Rezipientenseite für SoD „verantwortlich“ sind (s. Kap. 2.1, 2.2). In einem nächsten Schritt geht die Arbeit genauer auf das Konstrukt Rezeptionserleben ein (s. Kap. 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3). In das dritte Kapitel fallen die Forschungsfragen und deren theoretische Herleitung. Design, Methode und Operationalisierung der verschiedenen Konstrukte werden im vierten Kapitel vorgestellt. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse des Experiments vorgestellt und diskutiert, und in Kapitel 6 werden die Ergebnisse in Bezug auf die theoretischen Überlegungen zusammengefasst und diskutiert.
2. SoD: Wesen – Einflussfaktoren – Wirkungen
Eine genaue theoretische Konzeptualisierung des Konstruktes SoD sowie eine Definition, die den Begriff der empirischen Forschung zugänglich macht, wurden bisher nicht vorgenommen, obwohl der Begriff von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen immer wieder gebraucht wurde (vgl. Böcking/Wirth/Risch 2005: 150f).
Im Folgenden soll daher genauer auf das Wesen von SoD eingegangen, die Einflussfaktoren, die zu SoD führen, beleuchtet sowie die Wirkungen auf das Rezeptionserleben aufgezeigt werden. Es sollen also Fragen wie die folgenden geklärt werden: Wie ist das Konstrukt SoD zu konzeptualisieren? Was löst SoD aus, d.h. welche Eigenschaften muss ein fiktionaler narrativer Medieninhalt haben, damit SoD als Verarbeitungsart gewählt wird? Welche Rezipienteneigenschaften führen dazu, dass ein Rezipient SoD (nicht) als Verarbeitungsmodus wählt?
Zunächst sollen nun Herkunft und Geschichte des Begriffs genauer beleuchtet werden.
2.1 Was ist eigentlich SoD? Herkunft und Geschichte des Begriffs
Der Terminus SoD wurde erstmals im 18. Jahrhundert von Coleridge verwendet. Er benutzte die Wendung im Zusammenhang mit der Lektüre von Gedichten und war der Ansicht, dass ein Leser von Gedichten sich auf den fiktionalen Inhalt einlassen muss (vgl. Holland 2002: 1; Kauvar 1969: 91f). Aber was tut man eigentlich genau, wenn man seinem Nicht-Glauben keinen Raum gibt, es also in den Hintergrund treten lässt?
Wiley (2000: 26) sieht SoD als Brücke zwischen der realen Welt und sog. „special worlds“, in die ein Rezipient während der Rezeption eines fiktionalen narrativen Medieninhalts eintritt.
SoD kann auch als Medienhandlungsstrategie (vgl. Rusch 1997) angesehen werden, nämlich als Fiktionalisierung. Fiktionalisierung meint eine kognitive Operation, welche intentional ausgeführt wird (vgl. ebd.: 131). Vor der Rezeption eines fiktionalen narrativen Medieninhalts (oder beim ersten Kontakt mit diesem) hat ein Rezipient bereits eine gewisse Vorstellung darüber, was ihn erwartet – m.a.W, er hat eine Hypothese über die (Mach-)Art des Films[3]. Es handelt sich dabei um keine einzelne Hypothese, sondern vielmehr um ein Hypothesenbündel aus Annahmen über Genre (Genrewissen spielt hier eine Rolle), Realitätsgehalt etc.
Während der Rezeption (und damit Informationskonstruktion) werden diese Hypothesen mit dem Weltwissen und genrespezifischen Erwartungen abgeglichen (vgl. ebd.: 129ff). Um diese Abgleichung vorzunehmen, wendet der Rezipient verschiedene Strategien an (Fiktionalisierung/Faktualisierung[4] ).
SoD kann nun als Fiktionalisierung angesehen werden im Sinne einer Quasi-Ontologisierung, einer Quasi-Referenzialisierung (vgl. ebd.: 131ff). Man lässt sich also bewusst auf die im Medieninhalt aufgebaute Quasi-Welt ein, und zwar in dem Moment, wo die Parameter der „realen“ Welt nicht mehr zu greifen scheinen. Schon Coleridge verlangte von den Lesern von Gedichten „that willing suspension of disbelief for the moment which constitutes poetic faith“ (vgl. Coleridge 1817 zit. nach Holland 1967:1).
Diese Überlegungen führen zwangsläufig zur Frage, welche Eigenschaften ein fiktionaler narrativer Medieninhalt haben muss, damit die Parameter der „realen“ Welt nicht mehr greifen, damit also SoD angewendet wird.
2.2 Perceived Reality – ein mehrdimensionales Phänomen
Sicherlich wird in einer Informationssendung nicht viel Disbelief auszublenden sein, da diese Medieninhalte sich gerade durch ihren Realitätsbezug auszeichnen. Bei fiktionalen narrativen Medienangeboten verhält es sich anders. Das Adjektiv fiktional weist explizit auf den fehlenden Realitätsbezug, auf die Erdachtheit des Medieninhalts hin. In einer erdachten (fiktionalen) Welt können nun Dinge passieren, die nicht mit der Realitätskonstruktion eines Mediennutzers übereinstimmen, die also gegenüber der Weltkonstruktion des Rezipienten Inkonsistenzen aufweisen – oder anders gesagt – , die nicht mit dem Weltwissen des Rezipienten (z.B.: „Menschen können nicht fliegen.“) übereinstimmen. In der Fiktion werden also Wahrheitskriterien, die normalerweise Geltung haben, verletzt (vgl. Böcking/Wirth/Risch 2005: 148). In einer Geschichte passieren oft Dinge, die sich so in der realen Welt nicht zutragen können. SoD ist dann der Mechanismus, der einen solche inkonsistenten Inhalte ausblenden oder zumindest nicht als störend empfinden lässt. Es handelt sich also immer um eine rezeptionsseitige Einschätzung des Verhältnisses des (fiktionalen) Medieninhalts und der Realität. Diese rezeptionsseitige Einschätzungen des Realitätsgehalts eines audiovisuellen Medienprodukts ist innerhalb der Medienpsychologie Gegenstand der Perceived Reality-Forschung (vgl. Rothmund/Schreier/Groeben 2001b: 85). Das Konstrukt wurde bereits in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts innerhalb der Medienwirkungsforschung eingeführt (vgl. z.B. Hawkins 1977). Bereits zu dieser Zeit wurde diese Realitäts-Fiktionsunterscheidung als mehrdimensional aufgefasst. Allerdings halten Rothmund/Schreier/Groeben (2001a: 36) fest, dass die Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion primär auf der Darstellungsdimension verortet wird. Bei der Inhaltsdefinition geht es um die Beurteilung des Realitätsgehalts „die durch einen Vergleich medialer Inhalte mit der im Weltwissen repräsentierten Realität“ (vgl. ebd.).
Aus Platzgründen soll hier nicht weiter auf die unterschiedlichen Dimensionierungen eingegangen werden. Tabelle 1 soll lediglich illustrieren, dass verschiedene Forscher (mit verschiedenen Forschungsgegenständen) die Realitäts-Fiktionsunterscheidung unterschiedlich dimensioniert haben, und dass deren Dimensionierungen Unschärfen und Inkonsistenzen aufweisen (vgl. Rothmund/Schreier/Groeben 2001a: 33).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1 : Dimensionen der Perceived Reality (vgl. Rothmund/Schreier/Groeben 2001: 36)
Auch Busselle und Greenberg (2000: 249) sind dieser Ansicht: „[…] the perceived reality literature suffers from conceptual inconsistencies that have the potential to interfere with […] the success of future studies”.
Im Zusammenhang mit SoD sind unserer Ansicht nach andere Perceived Reality Dimensionen als die in Abbildung gezeigten von Bedeutung. Vor allem vier Dimensionen sind u.E. wichtig[5]: Plausibility, Typicality, Narrative Consistency und Perceptional Persuasiveness.
Plausibility ist dann gegeben, wenn das, was gezeigt wird, eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, sich wirklich so zu ereignen (vgl. Hall 2003: 629). In ihrer qualitätiven Studie fand Hall heraus, dass Plausability „one of the primary ways in which audiences defined realism“ war (ebd.). Plausibility ist zudem ein notwendiges Kriterium für das andernorts (vgl. Busselle/Greenberg 2000: 257) genannte Kriterium Probability, also die Wahrscheinlichkeit, dass etwas, das im Fernsehen gezeigt wird, sich in der realen Welt ereignen kann. Typicality, eine weitere Dimension, wird sowohl von Hall (vgl. 2003: 632) als auch von Shapiro/Chock (vgl. 2003: 167ff) als wichtiges Kriterium bei der Realitäts-Fiktionsunterscheidung betrachtet. Diese Dimension ist mit der Social Realism-Dimension von Fitch/Huston/Wright (1993) vereinbar. Sie umschreibt die Ähnlichkeit eines Medieninhalts mit Begebenheiten in der realen Welt. Narrative Consistency ist ein Kriterium, mit dem der Realitätsgehalt eines Medieninhalts an seinem kohärenten Aufbau gemessen wird. Der Medieninhalt sollte sich auch intern nicht selbst widersprechen (vgl. Hall 2003: 636). Denn eine in sich inkohärente Geschichte vermag nicht zu überzeugen, was zur letzten Dimension – Perceptual Persuasiveness – führt. Bei dieser Dimension geht es darum, dass eine filmische Darstellung eine „Compelling Visual Illusion“ (Hall 2003: 637) herstellt. Als Beispiel könnte ein abgeschossenes Bein (resp. dessen Darstellung) eines Soldaten in einem Kriegsfilm dienen oder auch eine Kulisse eines Westernfilms aus den 50er Jahren
(, wo die visuelle Illusion ja meist nicht ganz so überzeugend ist).
Die folgende Abbildung soll den Zusammenhang zwischen Perceived Reality und SoD verdeutlichen. Sie ist folgendermassen zu lesen: Am Anfang steht ein fiktionaler narrativer Medieninhalt. Der Rezipient hat nun die Möglichkeit, diesen als „wahr“ zu akzeptieren, ihm also zu glauben, was nicht zu SoD sondern zu Belief führt. Weist der Inhalt jedoch Inkonsistenzen auf, die als Nicht-Vorhandensein der oben genannten Realitätskriterien beschrieben werden können (Das „(-)“ bei den Dimensionen soll verdeutlichen, dass, wenn diese Anforderungen nicht erfüllt sind, der Medieninhalt nicht als real angesehen wird), so wird das entweder dazu führen, dass der Rezipient dem Medieninhalt nicht glaubt (Disbelief)[6], oder dass er sein Disbelief ausblendet (SoD).
Nun ist es aber nicht unbedingt so, dass alleine Eigenschaften des medialen Inhalts zu (Dis-) Belief resp. zu SoD führen. Eigenschaften des Rezipienten spielen dabei ebenfalls eine Rolle. Jemand, der schlecht gemachte B-Movies mag, wird sich an den dort auftretenden Inkonsistenzen weniger oder gar nicht stossen als jemand, dem dieses Genre weniger zusagt oder der es nicht kennt. Genrepräferenzen spielen somit eine Rolle. Unterschiede zwischen Rezipienten lassen sich auch betreffend Need for Cognition (vgl. Cacioppo/Petty 1982) finden. Der Eine denkt gerne und viel nach während der Andere dies viel weniger gerne tut. Dabei spielt es auch eine Rolle, welche Hypothese ein Rezipient vor der Rezeption eines fiktionalen narrativen Medieninhalts hat.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 : Der Zusammenhang zwischen Perceived Reality und SoD
Es soll nun abschliessend eine Definition von SoD nach Böcking/Wirth/Risch (2005: 26) gegeben werden, In dieser Definition wird SoD als eine Verarbeitungsart von fiktionalen, narrativen Medieninhalten verstanden:
Nach ihnen ist SoD “a processing of narrative fictional media content during which the user does not scrutinize the consistency of the plot and the realism of the fictional media content, nor pay attention to corresponding infractions or violations“.
Mit „consistency of the plot“ ist genau die Narrative Consictency bei Hall (2003: 636) angesprochen.
Es wurde bereits erwähnt, dass SoD unter anderem dafür verantwortlich ist, dass man trotz Inkonsistenzen und Ungereimtheiten im Filmgenuss nicht gestört wird, dass also das Rezeptionserleben ein positives bleibt. Eben dieses Rezeptionserleben soll im nächsten Kapitel genauer betrachtet werden.
2.3 Rezeptionserleben
Beim Konstrukt Rezeptionserleben interessiert man sich dafür, wie sich jemand während der Rezeption eines fiktionalen narrativen Medieninhalts fühlt, wie er die Rezeption erlebt hat, und ob er die Rezeption als unterhaltend empfunden hat. Zusätzlich ist die Frage nach der affektiven und kognitiven Bewertung des Medieninhalts (Unterhaltungserleben) von Interesse. Damit sind also die Wirkungen und Bewertungen des fiktionalen narrativen Medieninhalts auf Rezipientenseite angesprochen. Unterhaltung (Entertainment) wird Früh (2003) folgend als Makroemotion verstanden.
Ein anderes Konzept, welches unserer Ansicht nach im Rezeptionserleben enthalten ist, das räumliche Präsenzerleben (Spatial Presence), soll an dieser Stelle auch angesprochen werden. Spatial Presence kann im weitesten Sinne als ein Shift „in self-perception“ (Louwerse/Kuiken 2004: 170) verstanden werden, insofern, dass man sich als Rezipient nicht mehr als vor-dem-Fernseher-sitzend fühlt, sondern sich soz. in das Geschehen des Films hinein begibt. Bevor aber genauer auf diesen Punkt eingegangen wird, gilt es nun, sich zu fragen, was denn überhaupt Unterhaltung bedeutet. Es wird sich zeigen, dass Unterhaltung nicht auf der Produktions- resp. Angebotsseite entsteht, sondern dass immer der Rezipient entscheidet, ob etwas unterhaltend war/ist. Das folgende Kapitel trägt zur Klärung bei.
2.3.1 Unterhaltung als Makroemotion
Ob ein Medieninhalt als Unterhaltung bezeichnet werden kann, ist nicht eine Frage des Mediums oder dessen Inhalts. Man spricht zwar oftmals von Unterhaltungsangeboten im Fernsehen, ob sich aber ein Rezipient tatsächlich unterhalten fühlt, wird letztlich nicht auf Produktions- sondern auf Rezipientenseite entschieden (vgl. Früh 2003: 27f). Zudem fast Früh (2003: 28) Unterhaltung als „eigenständiges, charakteristisches Erleben auf, das sich von anderen positiven Empfindungen unterscheidet“. Unterhaltung wird im Rahmen der triadisch-dynamischen Unterhaltungstheorie (vgl. Früh 2003; Früh/Wünsch/Klopp 2004) als Makroemotion verstanden – dies vor allem deswegen, weil Unterhaltung auch negative Emotionen mit einschliesst. So ist es möglich, dass man sich bei der Rezeption eines traurigen Films trotz der Tränen unterhalten fühlt (vgl. Oliver 1993). Makroemotion[7] meint in diesem Zusammenhang Reaktionen auf Emotionen (oder eben deren Bewertung) (vgl. Oliver 1993: 316). Unterhaltung ist als Makroemotion ein eigenständiges, charakteristisches Erleben, welches nicht nur positive Empfindungen enthält, sondern auch negative[8]. Als Grundlage für Frühs Theorie der Unterhaltung dient der ebenfalls von ihm entwickelte dynamisch-transaktionale Ansatz (vgl. Früh 1991). Der Unterhaltungstheorie liegen dabei zwei Prämissen zugrunde (Früh 2003: 29): „Prämisse 1: Unterhaltung ist tendenziell positives Erleben Prämisse 2: Unterhaltung ist selbstbestimmt (kann also nicht gefordert oder erzwungen werden)“.
Warum nun suchen Menschen Unterhaltung? Welche Handlungsziele liegen einer Medienzuwendung in der Hoffnung, unterhalten zu werden, zugrunde? Welches sind also die unterhaltungsspezifischen Gratifikatoren? Vier allgemeine Grundlagen sind in diesem Zusammenhang von Bedeutung (vgl. Früh 2003: 29ff):
1. Menschen können nur den Energieanteil selbstbestimmt verteilen, der ihnen nach der Erfüllung unbeeinflussbarer äusserer Anforderungen verbleibt. Diesen selbstbestimmten Energieeinsatz wollen Menschen 2. selbst optimieren. 3. Die Optimierung geschieht auf der Grundlage von drei positiv erlebten Handlungszielen:
a.) Regulation des Energiebudgets
b.) Streben nach einem angenehmen Erleben
c.) Arrangement/Optimierung verschiedener externer und/oder interner Anforderungen bzw. Denk-, Erlebens- und Handlungsziele
Es wird dabei ein dynamisches Konzept der Energiebudgetierung angenommen. D.h. auf einen Zustand niedriger Aktivierung folgt ein Zustand hoher Aktivierung, und dieser wird vom Menschen als angenehm empfunden (s. dynamisches Energiemanagement auf physischer und kognitiv-affektiver Ebene (vgl. ebd.: 29ff)). Wird das Vorhandensein von Energie als Variable aufgefasst, so kann man festhalten, dass sich die Variable dadurch, dass sie wirkt, selber permanent verändert, was als Transaktion bezeichnet wird (vgl. Früh 1991: 153ff).
Eine weitere Komponente ist das Streben nach angenehmem Erleben, welches sich aus drei Unteraspekten zusammensetzt, die Früh als Gratifikatoren bezeichnet (vgl. ebd. 2003: 35): Abwechslung, Souveränität/Selbstbestimmung und Kontrolle.
Abwechslung wird dabei als kognitive Grösse verstanden. Souveränität meint die Möglichkeit, dass der Rezipient selbst entscheiden kann, ob und welchem medialen Angebot er sich in welcher Weise und Intensität aussetzen möchte. So ist es zum Beispiel möglich, alle externen Rollenerwartungen von sich zu weisen und sich für einmal mit den „Natural Born Killers“ zu identifizieren (vgl. Früh 2003: 31f). Früh (vgl. ebd.: 31f) unterscheidet passive und aktive Souveränität. Passive Souveränität wird dadurch ausgeübt, dass man Situationen internaler oder externaler Zumutung bewusst ausblendet oder einfach ignoriert. Dadurch wird ein Freiraum geschaffen, den der Rezipient mehr oder weniger ausnutzen kann (aktive Souveränität). SoD kann demnach als Resultat passiver und aktiver Souveränität verstanden werden. Das Adjektiv „willing“ führt zu einem weiteren Unterhaltungsfaktor, der Kontrolle.
Diesem Faktor schreibt Früh eine zentrale Rolle bei der Unterhaltungskonstitution zu. Das Bedürfnis nach Kontrolle entspringt einer biologischen Notwendigkeit, sich ständig auf ändernde Umweltumstände einzulassen zu müssen oder diese gar zu kontrollieren. Auch hier unterscheidet Früh (vgl. 2003: 32) wieder zwischen aktiver und passiver Kontrolle[9], welche nicht nur in der Beziehung Mensch-Umwelt zum Einsatz kommt, sondern auch in der Beziehung eines Menschen zu sich selbst (internale Kontrolle). Um Kontrolle zu erfahren, muss es zu irgendeinem früheren Zeitpunkt einen Zustand der geringeren Kontrolle gegeben haben. Je grösser das Risiko des Scheiterns ist, desto intensiver wird das Kompetenzerleben ausfallen. „Unterhaltung wird zum grossen Teil durch einen kontrollierten Kontrollverlust ermöglicht […]“ (Früh 2003: 34; Hervorheb. i.O.). Kontrolle meint also – zusammengefasst – die Beherrschbarkeit und die Überschaubarkeit der Konsequenzen unterhaltender Rezeption (vgl. Früh/Wünsch/Klopp 2004: 519). Das Resultat erfolgreich ausgeübter Kontrolle ist dann erlebte Kompetenz (vgl. Früh/Wünsch/Klopp 2004: 519).
„Am intensivsten ist das Unterhaltungserleben dann, wenn erstens die Beschäftigung mit dem Gegenstand durch Aufmerksamkeit und Involvement[10] sehr stark in den Vordergrund und komplementär dazu das Bewusstsein der Vermitteltheit stark in den Hintergrund rückt, und wenn zweitens ein möglichst grosser Kontrollverlust auf der Ebene der geschützten Lebensweltepisode […] riskiert und im Vollzug wiedergewonnen wird“ (Früh 2003: 34).
Sofern die drei Gratifikatoren vorhanden sind, kann jede Emotion zur Unterhaltung werden.
Der Mensch strebt nicht nur nach einem positiven Erleben und nach Abwechslung, sondern er ist auch auf eine Optimierung seiner Gefühle aus, um allfällige interne Konflikte zu vermeiden. Optimierung meint die Abstimmung und Abstufung verschiedener u.U. konkurrierender Handlungsziele. Unterhaltung entsteht durch eine geeignete Passung der drei Faktoren Objekt/Stimulus, Person und situativer bzw. gesellschaftlicher Kontext. Diese Passung wird als „triadisches fitting“ (Früh 2003: 39) bezeichnet. Zusammenfassend bezeichnen Früh/Wünsch/Klopp (2004: 519) Unterhaltung als „ein a.) tendenziell positives kognitiv-affektives Erleben, b.) das auf der Makroebene c.) im Rahmen einer geeigneten Bedingungskonstellation entsteht und d.) Souveränität/Kontrolle voraussetzt.“
Aufbauend auf dem triadisch-dynamischen Unterhaltungsansatz haben Früh/Wünsch/Klopp (vgl. 2004: 515ff) ein Messinstrument entwickelt, das Unterhaltungserleben einer empirischen Untersuchung zugänglich macht (vgl. Kapitel 4.3.2).
Im Folgenden wird versucht, Enjoyment als Kern des Unterhaltungserlebens (vgl. z.B. Vorderer/Klimmt/Ritterfeld 2004) zu konzeptualisieren.
2.3.2 Enjoyment – the core of Media Entertainment
Der Begriff Enjoyment wurde von Zillmann und anderen Autoren (vgl. dazu Oliver 1993, Raney 2003, Zillman 1988 a/b, Zillmann/Bryant 1994) zur Beschreibung und Erklärung positiver Reaktionen gegenüber einem Medieninhalt eingeführt und wird innerhalb der Kommunikationswissenschaft als Kernkomponente von Entertainment Experience verstanden (vgl.Vorderer/Klimmt/Ritterfeld 2004: 388). Aus dem Artikel von Vorderer/Klimmt/Ritterfeld (2004) geht nicht hervor, wie man Entertainment Experience und Enjoyment eindeutig gegeneinander abgrenzen kann. Es sollte aber im vorherigen Kapitel klar geworden sein, dass Entertainment Enjoyment subsumiert und nicht umgekehrt. Auch Nabi/Krcmar (vgl. 2004: 288ff) machen zwischen diesen beiden Begriffen keine klaren Abgrenzungen und halten fest, das Konzept Enjoyment müsse noch klar definiert und in der Medienwirkungsforschung eindeutiger konzeptualisiert werden. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass „most measures of the construct are somewhat unsatisfying“ (ebd.: 291).
Enjoyment besteht aus verschiedenen Komponenten: Erstens aus einer „message-related (the extent to which the content was evaluated positively or negatively, based on cognitive and affective assements)” (ebd.: 291) und einer “experience-related (the extent to which the consumption experience is itself pleasurable […]” (ebd.: 291) Komponente. Nabi/Krcmar (vgl. ebd.: 292) sehen Enjoyment als eine Art Umschreibung des grösseren Konstrukts Attitude, welches unter anderem durch die Komponenten „valence, sensitivity to measurement specificity, and affective and cognitive components“(ebd.:292) definiert ist. Um Enjoyment aber als Attitude zu konzeptulisieren, bedarf es einer weiteren Komponente, der Behavioral Component (vgl. ebd. 292). Da im Rahmen dieser Arbeit das Konstrukt Attitude aber nicht weiter von Bedeutung ist, wird nicht näher auf Attitude eingegangen. Es ist wichtig festzuhalten, dass auch Vorderer/Klimmt/Ritterfeld (vgl. 2004: 389) drei Komponenten (cognitiv, affectiv, physiologisch) als essentiell für Enjoyment betrachten. Die letzte dieser drei Komponenten, Physiological Component und Behavorial Component[11], kann man als die konative (verhaltenbetreffende) Komponente verstehen. Diese drei Komponenten werden als „tripartite model“ (Nabi/Krcmar 2004: 292, Abbildung 2) bezeichnet und werden zur Konzeptualisierung von Enjoyment verwendet. Inwiefern man die affektive und kognitive Komponente zueinander abgrenzen kann, ist nicht eindeutig. „[...] it appears that cognitive judgments are somehow interwined with the affective processes associated with enjoyment“ (ebd.: 294). Nabi/Krcmar (vgl. ebd.:294) erwähnen auch, dass die Behavorial Component noch nicht klar als eine Dimension von Enjoyment angesehen werden kann.
Enjoyment muss aber nicht nur als positive, sondern kann auch als negative Emotion auftreten (vgl. Nabi/Krcmar 2004: 291, Vorderer/Klimmt/Ritterfeld: 2004: 394).
So kann bspw. aufkommende Melancholie oder Angst grundsätzlich als angenehm empfunden werden. Solche Gefühle können als Meta- oder eben als Makroemotionen verstanden werden.
„These meta-emtions occur as individuals reflect upon their feelings and evaluations and respond affectively to their response. In other words, there are situations and circumstances in which most individuals experience unpleasant emotions on the object level. Nonetheless, they also experience appreciation, pride, and even enjoyment on a meta-emotional level […]” (Vorderer/Klimmt/Ritterfeld 2004: 394).
Um einen fiktionalen narrativen Medieninhalt geniessen zu können, ist es oftmals notwendig, SoD temporär einzuschalten. Zweitens ist es notwendig, dass sich Rezipienten in die Lage der Charaktere (sei es in einem Film oder Buch) versetzen und mit ihnen mitfühlen können. Frühere Forschungen zeigen (bspw. Nathanson 2003, Zillman 1991), dass der Grad, in welchem Individuen Empathie mit den Charakteren zeigen, mit zwei Faktoren variiert: Erstens meint Empathie die Fähigkeit mit den Charakteren mitzufühlen und zweitens auch die Bereitschaft, dies zu tun. Eine dritte Bedingung richtet sich an die Fähigkeit und die Wünsche des Publikums, mit den Charakteren eine Art Verbindung einzugehen. Eine andere Voraussetzung ist, dass sich der Mediennutzer in die Handlung hineinfühlen kann und somit mit den Charakteren mitfühlt. Die letzte und wichtigste Voraussetzung ist, dass der Mediennutzer das Interesse an einem spezifischen Thema überhaupt mitbringt, wozu natürlich auch ein gewisses Vorwissen (z.B. Genrewissen) nötig ist (vgl. Vorderer/Klimmt/Ritterfeld 2004: 395f).
Nachfolgend ist das Modell von Vorderer/Klimmt/Ritterfeld (2004) und von Nabi/Krcmar (2004) dargestellt. Im Modell von Vorderer/Klimmt/Ritterfeld sieht man zur Linken die verschiedenen Voraussetzungen, welche für Enjoyment nötig sind und auf der rechten Seite die Effekte, welche durch Enjoyment auftreten. Für die vorliegende Studie ist zentral, wie sich Enjoyment manifestieren kann (s. Abbildung 2). Im Modell von Nabi/Krcmar sind auf der linken Seite die drei Komponenten des Tripartite Models dargestellt, welche auf Enjoyment einwirken und Enjoyment im eigentlichen Sinn darstellen. Da diese drei Komponenten auf Enjoyment einwirken, werden sie in wechselseitiger Beziehung zu Enjoyment von Enjoyment selbst wieder beeinflusst. Das geschieht andauernd, weshalb eine Messung von Enjoyment an nur einem Zeitpunkt als problematisch bewertet werden muss. Aus forschungsökonomischen Gründen ist dies aber nicht anders möglich (vgl. Nabi/Krcmar 2004: 292ff).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 : The complexity of Entertainment Experience (Vorderer/Klimmt/Ritterfeld 2004: 393)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3 : Tripartite Model of Media Enjoyment's Effects on Viewing and Content Related Behaviour (Nabi/Krcmar 2004: 297)
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Enjoyment ein mehrdimensionales Konstrukt ist, welches sich aus kognitiven, affektiven und konativen (nach Nabi/Krcmar 2004: Behavorial Component, nach Vorderer/Klimmt/Ritterfeld 2004: Physiological component) Komponenten zusammensetzt. Enjoyment kann sich in positiven wie auch negativen Emotionen (Meta-/Makroemotionen) manifestieren.
Im folgenden Kapitel soll auf eine weitere Komponente des Rezeptionserlebens eingegangen werden, das räumliche Präsenzerleben (engl. Spatial Presence).
2.3.3 Spatial Presence
Räumliches Präsenzerleben (spatial presence) ist ein in der Kommunikationswissenschaft erst vor Kurzem beachtetes Konzept (vgl. Hartmann et al. 2005: 21). Es wird als Rezeptionsmodalität verstanden, und zwar in dem Sinne, dass sich der Rezipient in einem massenmedial vermittelten Raum selbst anwesend fühlt und sogar in diesem Raum handeln zu können meint (vgl. Mögerle et al. 2006: 1). Das heisst umgekehrt auch, dass ein Rezipient die reale Umgebung, in der er sich befindet, zumindest temporär vergisst. Spatial Presence ist dabei nicht nur durch die Ansprache vieler Sinnkanäle induziert (wie z.B. in Virtual Reality-Umgebungen), sondern beruht auf kognitiven Konstruktionsprozessen des Publikums, was die Anwendbarkeit des Konstruktes auch auf weniger immersive Medien (Bücher, Informationssendungen) zulässt (vgl. Hartmann et al. 2005:21f).
Mit dem sog. Zwei-Ebenen-Modell sollen die Erlebnisdimensionen, die Entstehung und die Determinanten dieses Rezeptionsmodus modelliert werden (vgl. Hartmann et al. 2005: 22).
Die räumliche Präsenz ist dabei ein binäres und kein graduelles Konstrukt, da es bei der räumlichen Wahrnehmung kein „Weniger“ oder „Mehr“ gibt (vgl. Wirth et al. submitted). Berichte von Rezipienten über eine graduelle An- resp. Abwesenheit sind auf ein kognitives Hin-und-Her-Switchen zwischen der medialen und der tatsächlichen Welt im Zeitverlauf zurückzuführen (vgl. Hartmann et al. 2005: 22).
Das Zwei-Ebenen-Modell ist folgendermassen aufgebaut (vgl. ebd.: 24): Zuerst muss sich ein Rezipient kognitiv ein räumliches Situationsmodell aufbauen. Es handelt sich dabei um eine mentale Repräsentation des medialen Raumes. Diese wird durch verschiedene Faktoren bestimmt: Medienfaktoren (Media Factors), Prozesskomponenten (Process Components), Rezipientenhandeln (User’s Action) sowie Rezipientenmerkmale (User Factors).
Mit Medienfaktoren sind zum Einen situationsmodellfördernde Hinweisreize und zum Anderen aufmerksamkeitsevozierende Eigenschaften des Medienangebots (sowohl in Bezug auf die Form als auch auf den Inhalt[12] (vgl. Wirth et al. submitted)) gemeint. Die situationsmodellfördernden Hinweisreize haben dabei einen direkten Einfluss auf die Konstruktion des räumlichen Situationsmodells (Man weiss dann, wie der Schauplatz der Handlung aussieht oder ist zumindest fähig, diesen in einer subjektiv angemessenen Weise zu konstruieren). Die Wirkung aufmerksamkeitsevozierender Medienfaktoren (z.B. besonders dramatische Musik oder eine besonders spannende narrative Struktur) begünstigen, dass der Rezipient sich dem Medieninhalt überhaupt zuwendet, ihm seine Aufmerksamkeit schenkt. Unter dem Einfluss der aufmerksamkeitsevozierenden Medienfaktoren geschieht diese Zuwendung automatisch, d.h. nicht vom Rezipienten intendiert (vgl. Wirth et al submitted). Diese automatische Zuwendung wird im Modell unter den sog. Prozesskomponenten verortet und kommt vor allem in solchen Situationen vor, in denen der Rezipient sich der Zuwendung zum medialen Inhalt schwerlich oder gar nicht entziehen kann (z.B. in Kinos oder in einer Experimentalsituation)(vgl. Hartmann et al. 2005: 25). Ebenfalls als Prozesskomponente gilt die kontrollierte Aufmerksamkeitszuwendung, welche vom bereichsspezifischen Interesse (domain-specific interest (DSI)) – einem Rezipientenmerkmal (vgl. Wirth et al. submitted) – abhängt und vor allem bei weniger immersiven Medieninhalten zum Tragen kommt (z.B. bei Büchern). Wirth et al. (submitted) sind der Ansicht, dass die intendierte Aufmerksamkeitszuwendung in einem negativen Verhältnis zur Immersivität eines Medieninhalts stehen. Man kann davon ausgehen, dass bereichsspezifisches Interesse und aufmerksamkeitsevozierende Medienfaktoren in Kombination zu Spatial Presence führen, wobei die räumlich-visuelle Vorstellungskraft des Rezipienten ebenfalls eine Rolle spielt.
Die bis jetzt genannten Faktoren (Medienfaktoren, Prozesskomponenten, Rezipientenhandeln, Rezipientenmerkmale) führen zur mentalen Konstruktion eines räumlichen Situationsmodells (erste Modellebene). Verschiedene Rezipienten- und Medieneigenschaften führen also zu einer mentalen Repräsentation des dargestellten Raumes (vgl. Mögerle et al. 2006: 3; Wirth et al. submitted). Aufgrund der (automatischen oder kontrollierten) Aufmerksamkeitszuwendung werden aus der Umwelt stammende Hinweisreize ausgeblendet. Man vergisst also bspw., dass man gerade in einem Kinosessel sitzt (vgl. Hartmann et al. 2005: 26)[13]. Werden nicht genügend Informationen über die Beschaffenheit des medialen Raums gegeben, können diese Defizite durch „memorisierte räumliche Vorstellungen“ (vgl. Hartmann et al. 2005: 26; Wirth et al. submitted) ergänzt werden. Wie weit diese Ergänzung gehen kann, hängt dann von der räumlich-visuellen Vorstellungskraft des Rezipienten ab und der Fähigkeit, das räumliche Vorwissen in mentale Bilder umzusetzen (vgl. Mögerle et al. 2006: 6).
Das nun entstandene Situationsmodell „im Kopf“ des Rezipienten führt aber noch nicht zu dem Gefühl, physisch im medialen Raum anwesend zu sein oder gar in ihm handeln zu können. Daher enthält das Modell noch ein zweite Ebene (vgl. Hartmann et al. 2005: 27). Auf dieser zweiten Ebene liegt dann das räumliche Präsenzerleben, das durch die gleich kategorisierten Dimensionen beeinflusst wird. Die Absorptionsfähigkeit und das bereichsspezifische Interesse, beides Rezipienteneigenschaften, sind auf dieser zweiten Ebene als Faktoren bei der Konstitution räumlichen Präsenzerlebens (vgl. Mögerle et al. 2006: 6) wirksam.
Der Rezipient ist bemüht, immer in einem mehr oder weniger stabilen Lokalisationsrahmen (PERF = Primary Egocentric Reference Frame (vgl. Wirth et al. submitted)) zu bleiben, sei es der medial vermittelte oder der, in dem er sich tatsächlich befindet (vgl. Hartmann et al. 2005: 27). Die Hypothesentheorie der Wahrnehmung (vgl. Bruner/Postman/Rodriguez 1951; Lilly/Frey 1993) kann erklären, wie ein solcher Lokalisierungsrahmen aufgebaut werden kann. Nach dieser Theorie ist Wahrnehmen kein direktes Abbilden der Welt sondern ein Ergebnis des Abgleichs zwischen Erwartungen/Hypothesen an/über und eingehenden Informationen über die Realität. Angewandt auf das Modell des räumlichen Präsenzerlebens kann man von zwei konkurrierenden Hypothesen ausgehen: Die erste Hypothese ist die Annahmen des realen Lokalisationsrahmens (Realhypothese) und die zweite die Annahme des medialen Lokalisationsrahmens (Präsenzhypothese) (Hartmann et al. 2005: 30). Zu Beginn der Rezeption ist die Realhypothese stärker, und es kommt auf die Bereitschaft des Rezipienten an, ob er sich in die mediale Welt „begeben“ will oder nicht. Hierbei spielen mediale Faktoren wie die Machart, oder die überzeugende Darstellung des medialen Raums eine Rolle sowie stabile Rezipientenmerkmale (sog. traits) und situativ bedingte Handlungen (states) (vgl. Mögerle et al. 2006: 5ff) eine Rolle. SoD und Involvement haben ebenfalls eine Wirkung. Diese beiden Faktoren werden dabei als aktive Beiträge des Rezipienten verstanden. Sie verstärken die Präsenzhypothese. SoD ist also nötig, um störende Informationen oder Inkonsistenzen nicht allzu sehr in Konkurrenz zur Präsenzhypothese treten zu lassen. Involvement kann sowohl auf kognitiver und affektiver als auch auf konativer Ebene angesiedelt werden. Rezipienten machen sich oft intensive Gedanken über das Geschehen und fühlen mit dem Protagonisten mit (kognitives und affektives Involvement) (vgl. Hartmann et al 2004: 34; Donnerstag 1996: 52ff). Diese Prozesse können durch entsprechende Mimik oder Gestik begleitet werden, was man als konatives Involvement bezeichnet. Es konnte gezeigt werden, dass, je höher eine Person bei der Rezeption eines Medieninhalts involviert ist, sie diesen als umso „realer“ beurteilen wird (vgl. Schreier/Groeben 1998: 241)[14].
Die genannten Faktoren führen schliesslich dazu, dass ein Rezipient nach der mentalen Repräsentation des medialen Raumes (erste Modellebene) sich in diesem auch anwesend oder gar handlungsfähig fühlt, dass also die Realhypothese zugunsten der Präsenzhypothese während der Rezeption aufgegeben wird. Der medial gezeigt Raum wird dann zum primären Lokalisationsrahmen (PERF). Abbildung 4 zeigt das Zwei-Ebenen-Modell räumlichen Präsenzerlebens
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4 : Das Zwei-Ebenen-Modell räumlichen Präsenzerlebens (vgl. Wirth et al. submitted).
Wie deutlich zu erkennen ist, werden sowohl Involvement als auch SoD als bedingende Faktoren für räumliches Präsenzerleben angesehen. Der Einfluss von SoD auf Spatial Presence ist folgendermassen zu verstehen: SoD lässt einen Informationen, welche die Annahme der Hypothese, dass der mediale Raum den primäre Referenzrahmen darstellt, stören könnten, ausblenden. Somit sorgt SoD dafür, dass der mediale Raum als primärer Referenzrahmen (PERF) bestehen bleibt. Dieser Verarbeitungsmodus kommt erst bei Inkonsistenzen zum Einsatz, an denen sich der Rezipient stören könnte (vgl. Wirth et al. submitted). SoD unterstützt also die Annahme der „medium-as-PERF-hypothese“ (vgl. Wirth et al. submitted) – dies vor allem bei wenig immersiven Medieninhalten.
[...]
[1] Die Diskussion über den ontologischen Status einer allen menschlichen Beobachtern äusserlichen Realität (z.B. im Rahmen des radikalen Konstruktivismus) sei hier ausgeblendet. Realität bezieht sich auf die externe (also nicht medienimmanente) Welt. Die Unterscheidung real/nicht real beinhaltet also einen Vergleich des Medieninhalts mit der nicht-medialen Welt (vgl. Böcking/Wirth/Risch 2005: 154).
[2] In der vorliegenden Arbeit wird, wenn die männliche Form genannt wird, die weichliche immer mitverstanden.
[3] Vgl. Hypothesentheorie der (sozialen) Wahrnehmung (z.B. Lilly/Frey 1993; Bruner/Postman/Rodriguez 1951).
[4] Faktualisierung als Medienhandlungsstrategie meint das Messen des Inhalts an Kriterien der „realen“ Welt. Diese Strategie wird zum Beispiel bei Nachrichtensendungen angewendet.
[5] Wir stützen uns dabei auf Forschungen von Hall (2003), Busselle/Greenberg (2000) sowie von Shapiro und Chock (2003). Dies aus folgenden Gründen: Erstens sind die Texte neueren Datums (2000/2003) und zweitens stützen wir uns auf Ergebnisse sowohl einer qualitativen (Hall 2003) als auch einer quantitativen Studie (Shapiro/Chock 2003) und auf eine Theoretical Review bisheriger Konzeptualisierungen (Busselle/Greenberg 2000).
[6] Der „Weg“ zu Disbelief ist in der Grafik nicht dargestellt, denn es soll ja nur der Zusammenhang zwischen der Realitäts-Fiktionsunterscheidung mit SoD aufgezeigt werden.
[7] Vorderer/Klimmt/Ritterfeld (vgl. 2004: 394) und Oliver (vgl. 1993: 316) sprechen von Metaemotionen, während Früh/Wünsch/Klopp (vgl. 2004: 515) von Makroemotionen sprechen. Wir verstehen die beiden Ausdrücke als äquivalent, da sie beide eine Bewertung von Emotionen meinen (kognitiv oder affektiv).
[8] Hedonismus als zentrales Motiv der Medienzuwendung (z.B. im Rahmen der Mood-Management-Theorie Zillmanns (vgl. Zillmann 1988a/b) wird als nicht mehr haltbar angesehen (vgl. Wirth/Schramm 2006).
[9] Früh/Wünsch/Klopp (2004: 522) unterscheiden nebst aktiver und passiver Souveränität resp. Kontrolle noch eine affektive und ein kognitive Strategie. Diese Strategien sind nach Ansicht der Autoren „empirisch kaum strikt
trennbar, da im Rahmen des dynamisch-transaktionalen Wirkungsansatzes Emotion und Kognition als ein „transaktional verbundenes Syndrom“ verstanden werden.
[10] Involvement wird von Louwerse und Kuiken (2004: 17) als „primary mode of comprehension“ definiert.
[11] Es sollte an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Behavioural und die Physiological Component sich trotzdem unterscheiden. So würde man einen erhöhten Puls wohl nicht als Behavioural Component bezeichnen – wohl aber als Physiological.
[12] Mit inhaltlichen Merkmalen sind etwa die Plausibilität oder Konsistenz aber auch ein interessanter Aufbau des Plots sowie die Leistungen der Schauspieler gemeint.
[13] Holland (2002: 2) bezeichnet dieses „neglect of surroundings“ als wichtigen Bestandteil von SoD.
[14] Des Weiteren können aber auch Faktoren wie parasoziale Interaktion und parasoziale Beziehungen (vgl. Klimmt/Hartmann/Schramm (in Druck)) als zum Involvementkonzept gehörend verstanden werden.
- Arbeit zitieren
- Matthias Hofer (Autor:in)Matthias Wirz (Autor:in), 2005, Wer (nicht) glaubt geniesst (weniger)? - Ein Versuch zur Beschreibung des Zusammenhangs von SoD und Rezeptionserleben, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66079
Kostenlos Autor werden












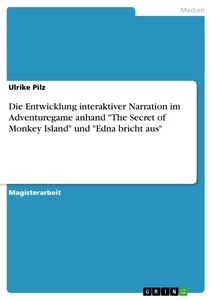




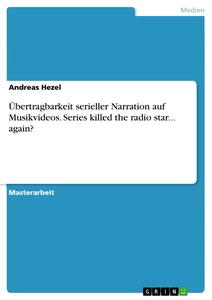




Kommentare