Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Anmerkungen zur Gliederung und Benutzung des Handbuchs
1. Zum sozioökonomischen und fachlichen Kontext der Qualitätsdebatte
1.1 Zur Aktualität und Herkunft des Qualitätsdiskurses im Humandienstleistungsbereich
1.2 Exkurs: Der Qualitätsdiskurs in der sozialwiss. und psychologischen Literatur 11
1.3 Zur Professionalisierung sozialer Berufe
1.4 Zum Stellenwert der Fachlichkeit
1.5 Zu ethischen Aspekten des Qualitätsthemas
1.6 Zur Ethik des Marktes
1.7 Struktur des deutschen Sozialsystems und Rolle freier Träger
1.8 Rechtsgrundlagen und Zuständigkeiten im Überblick
1.9 Zur Ökonomisierung des Sozialen
1.10 Zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung
2. Qualitätsmanagement als interdisziplinäres Konzept
2.1 Qualitätsspezifische Grundlagen im Überblick
2.1.1 Kurze Geschichte der Qualität und ihres Managements
2.1.2 Qualität
2.1.3 Qualitätsmodelle
2.1.4 Qualitätsmanagement (QM)
2.1.5 QM-Modelle
2.1.6 Qualitätstechniken und -instrumente
2.1.7 QM-Kontextkonzepte
2.1.8 QM-Implementierungskonzepte
2.2 Zur Verortung des Qualitätsmanagements in Wissenschaft und Praxis
2.3 Ausgewählte Schnittmengen von Qualitätsmanagement und Organisationsforschung
2.3.1 Organisationsdiagnose und -analyse
2.3.1.1 Organisationsstruktur
2.3.1.2 Organisationskultur
2.3.1.3 Organisationsklima
2.3.2 Organisationsentwicklung und Change Management
2.3.3 Personalentwicklung und Human Resource Management
2.3.4 Mitarbeiterbeteiligung und Empowerment
2.3.5 Lernende Organisation und organisationales Lernen
2.4 Zur postmodernen Kritik des Qualitätsdiskurses
2.5 Resümee zur Konvergenz und Integration der Konzepte
3. Besonderheiten sozialer Dienstleistungen und ihres Managements
3.1 Formale und inhaltliche Abgrenzungen des Dienstleistungsbegriffs
3.1.1 Systematik betrieblicher Leistungen
3.1.2 Dienstleistungen: Definitionen und allgemeine Merkmale
3.1.3 Merkmale sozialer Dienstleistungen
3.1.4 Qualitätsmerkmale sozialer Dienstleistungen
3.2 Perspektiven der Qualitätsbestimmung sozialer Dienstleistungen
3.3 Qualitätsmodelle sozialer Dienstleistungen
3.3.1 Vorbemerkungen
3.3.2 Das Qualitätsmodell von Donabedian und angelehnte Konzepte
3.3.3 Beurteilung und Integration der verschiedenen Ansätze
3.4 Aspekte eines sozialen Dienstleistungsmarketings
4. Qualitätskonzepte und -instrumente für soziale Einrichtungen und Dienste
4.1 Zur Beschreibung und Bewertung von Qualitätskonzepten
4.2 Formale Systematisierung von Qualitätskonzepten
4.3 Qualitätskonzepte: Gesamtübersicht
4.4 Darstellung und Kritik ausgewählter Qualitätskonzepte
4.4.1 Formale Universalkonzepte (branchenunabhängige QM-Modelle
und allgemeine Strategien)
4.4.1.1 Normen und Empfehlungen zum QM nach DIN EN ISO 9000 ff.
4.4.1.2 Das Konzept des Total Quality Management (TQM)
4.4.1.3 Das Konzept des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP, Kaizen)
4.4.1.4 Das Excellence Modell der EFQM
4.4.1.5 Integriertes QM nach dem St. Galler Management Konzept
4.4.2 Formale Branchenkonzepte (adaptierte Universalmodelle und feldspezifische Strategien)
4.4.2.1 Service Assessment (ServAs) – Qualitätsmanagement für Dienstleister
4.4.2.2 Qualität als Prozess (QAP) – Spezifikationen des EFQM-Modells
4.4.2.3 Das 2Q-System – Qualität und Qualifizierung
4.4.2.4 Das GAB-Verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
4.4.2.5 CBO – Dezentrale Qualitätsentwicklung in der Interkollegialen Methode
4.4.2.6 Partizipatives Qualitätsmanagement nach dem Münchner Modell
4.4.2.7 Internes Qualitätsmanagement – organisationsspezifische Phasenmodelle
4.4.2.8 Qualitätsmanagement als Lernstrategie – ein allgemeiner Verfahrensrahmen
4.4.2.9 Das Konzept „Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Selbstevaluation“ (QQS)
4.4.2.10 Qualitätssteuerung sozialer Arbeit (AZOMP)
4.4.2.11 QUIND – Eine Methode zur Selbststeuerung und Selbstevaluation für Schule
4.4.2.12 „Qualität in ...“ (QUI) – Entwurf eines integrativen Qualitätskonzepts
4.4.3 Materiale Branchenkonzepte
(feldspezifische Anforderungskataloge und Regelwerke)
4.4.3.1 Ziel- und kriterienbezogenes Qualitätsmanagement
4.4.3.2 Das Konzept „Wege zur Qualität“
4.4.3.3 Das Konzept „Qualitäts-Check“
4.4.3.4 Changeover – Qualitätsentwicklung in sozialen Organisationen
4.4.3.5 Dormagener Qualitätskatalog der Jugendhilfe
4.4.3.6 KDA – Qualitätshandbuch Wohnen im Heim
4.4.3.7 Qualitätssiegel der BAGSO „Seniorengerechtes Leben und Wohnen“
4.4.3.8 Das Konzept „Heime zum Leben“
4.4.3.9 Kooperation für Transparenz und Qualität im Krankenhaus (KTQ)
4.4.3.10 MUM – Monitoring Evaluation Management in der pflegerischen Qualitätssicherung
4.4.3.11 Lörracher Qualitätskonzept für die Krankenhaus-Sozialarbeit
4.4.3.12 Arbeitshilfe zur Qualitätsentwicklung in Familienunterstützenden und Familienentlastenden Diensten (AQUA-FUD/FED)
4.4.3.13 ProPsychiatrieQualität (PPQ) – Leitzielorientierte Qualitätsentwicklung in der Sozialpsychiatrie
4.4.4 Materiale Branchenkonzepte (operationalisierte Prüfkriterien und standardisierte Bewertungsverfahren)
4.4.4.1 Selbstbewertungssystem für stationäre Einrichtungen der Altenhilfe (SEA)
4.4.4.2 Standardisiertes Instrumentarium zur Evaluation von Einrichtungen der stationären Altenhilfe (SIESTA)
4.4.4.3 LEWO – Lebensqualität in Wohnstätten für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung
4.4.4.4 GBM – Verfahren zur EDV-gestützten Gestaltung der Betreuung für Menschen mit Behinderungen
4.4.4.5 Das System der Leistungsbeschreibung, Qualitätsbeschreibung und Entgeltberechnung (SYLQUE) in der Behindertenhilfe
4.4.4.6 Dialogische Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen
(Kronberger Kreis)
4.4.4.7 Kindergarten-Einschätz-Skala (KES/KES-R)
4.4.4.8 Kieler Instrumentarium für Elementarpädagogik und Leistungsqualität (K.I.E.L.)
4.4.4.9 Das Konzept WANJA – Von der Selbstevaluation zum Wirksamkeitsdialog in der kommunalen Jugendhilfe/Jugendarbeit
4.4.4.10 Selbstbewertung des Qualitätsmanagements in der Jugendhilfe (SQ-J)
4.4.4.11 Evaluations-Instrumentarium kommunaler Arbeitsmarktpolitik (EIKAP)
4.4.5 QM-Kontextkonzepte und Qualitätstechniken (formalisierte Verfahren und Instrumente)
4.4.5.1 Evaluation als allgemeines Konzept der Qualitätsbewertung
4.4.5.2 Controlling als allgemeines Konzept der Qualitätssteuerung
4.4.5.3 Das Konzept der Balanced Scorecard (BSC)
4.4.5.4 Das Konzept des Quality Function Deployment (QFD)
4.4.5.5 Benchmarking als organisationale Lernstrategie
4.4.5.6 Managementinformationssysteme (MIS)
4.5 Ansatzpunkte für eine kriteriengeleitete Auswahl von Qualitätskonzepten
4.5.1 Ordnungs-, Differenzierungs- und Gütekriterien von Qualitätskonzepten
4.5.2 Checklisten zur Selbstbewertung von Qualitätskonzepten
4.6 Instrumente des Qualitätsmanagements
4.6.1 Zum Stellenwert der "Technik" im Qualitätsmanagement
4.6.2 Kurzbeschreibung der bekanntesten Werkzeuge
4.6.2.1 Vorbemerkungen
4.6.2.2 Seven tools
4.6.2.3 New seven tools
4.6.2.4 Qualitätstechniken für Dienstleister
4.6.2.5 Weitere Instrumente
4.6.3 Beschreibung ausgewählter Instrumente
4.6.3.1 Qualitätsleitbild
4.6.3.2 Qualitäts(management)handbuch
4.6.3.3 Qualitätszirkel
4.6.3.4 Qualitätsbeauftragte
4.6.3.5 Kunden- und Mitarbeiterbefragungen
4.6.3.6 Kundenpfadanalyse
4.6.3.7 Prozessmanagement
4.6.3.8 Beschwerdemanagement
4.6.3.9 Vorschlagswesen/Ideenmanagement
4.6.3.10 Wissensmanagement
4.7 Zur Implementierung von Qualitätskonzepten
4.7.1 Vorbemerkungen
4.7.2 Wie viel Qualitätsmanagement braucht die Organisation?
4.7.3 Essentials einer vernünftigen Implementierung von Qualitätskonzepten
4.7.4 Vermeidbare Fehler
4.8 Zur Zertifizierung und Selbstbewertung von Qualitätskonzepten
4.8.1 Vorbemerkungen
4.8.2 Zertifizierung von Qualitätskonzepten in sozialen Handlungsfeldern
4.8.2.1 Zur Aktualität des Themas
4.8.2.2 Ziele und Grenzen des Zertifizierungsansatzes
4.8.2.3 Argumente gegen den Zertifizierungsansatz
4.8.3 Selbstbewertung als Methode des Qualitätsmanagements
4.8.3.1 Merkmale der Selbstbewertung
4.8.3.2 Zur besonderen Zweckmäßigkeit einer Qualitätsprüfung durch Selbstbewertung
5. Resümee und Ausblick
5.1 Sozialwirtschaftliches Qualitätsmanagement – ein Ansatz sui generis !?
5.2 Zur Zukunft des Qualitätsmanagements
6. Glossar
7. Bibliographie
7.1 Verzeichnis nach thematischen Schwerpunkten
7.2 Verzeichnis nach Arbeitsfeldern
8. Quellenverzeichnis und Gesamtbibliographie
9. Verzeichnis der Übersichtstafeln und Abbildungen
Vorwort
Der ökonomische und gesellschaftliche Strukturwandel setzt die Soziale Arbeit und ihre Verwandten in zentral personenbezogenen Handlungsfeldern stark unter Druck.
Dem gesellschaftlichen Auftrag verpflichtet, das verfassungsmäßig verankerte Sozialstaatsgebot im Sinne eines Abbaus von Ungleichheit und Benachteiligung umzusetzen, sehen sich die sozialen Berufe zunehmend mit Zweifeln konfrontiert, ob ihre Arbeit gut genug ist, diese Aufgabe überhaupt zu erfüllen. Offenkundige oder vermeintliche Qualitätsmängel im Erziehungs-, Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen werden nicht nur an Stammtischen als Argumente benutzt, eine „härtere Gangart“ einzufordern. Allenthalben werden öffentliche Sozialleistungen verstärkt auf den Prüfstand von Wirtschaftlichkeit und Nutzen gestellt – zumindest von denjenigen, welche sie nicht in Anspruch nehmen müssen. Den leistungserbringenden Organisationen und ihren Akteuren obliegt dabei die Bringschuld, deutlicher als bisher nachzuweisen, dass sie öffentliche Mittel wirkungsvoll und ressourcenschonend einzusetzen verstehen.
Die Entwicklung firmiert unter Modernisierung der Gesellschaft. Wenn auch die haushaltsbedingten Änderungen der sozialen Finanzierungsstrukturen bei allen Reformen Pate standen und das Tempo bestimmten, so spielen ebenso gesellschaftliche Wandlungsprozesse eine Rolle, wenn „das Soziale ... nicht mehr voraussetzungslos als etwas Schätzenswertes ... angenommen, sondern ... angesichts massiver Finanzprobleme ... als ein gewichtiger Kostenfaktor (erscheint), über dessen Wirksamkeit und ... effizienten Einsatz Rechenschaft verlangt wird“(Merchel, 1998b, S. 11).
Ökonomisch besetzte Begriffe wie „Kundenorientierung“, „Qualitätsmanagement“, „Marketing“ und viele andere mehr sind auch in sozialwirtschaftlichen oder Nonprofit-Organisationen salonfähig geworden. Kaum ein Akteur ist noch unangenehm berührt, wenn seine Tätigkeit als soziale Dienstleistung bezeichnet wird.
Ungeachtet der Probleme, die Qualität von Dienstleistungen im Allgemeinen und sozialer Dienstleistungen im Besonderen zu messen, ist die Forderung nach einem Qualitäts- und Wirksamkeitsdialog deshalb nicht nur sozialpolitisch, sondern auch fachlich legitim. Die Einrichtungen und Fachkräfte der sozialen, pädagogischen und therapeutisch-pflegerischen Berufe können sich nicht unter fragwürdigem Bezug auf die Exklusivität des eigenen Handlungsfeldes solchen Professionalisierungsaufgaben entziehen – selbst, wenn man sie bei wieder gefüllten öffentlichen Kassen "in Ruhe" ließe.
Die Propagandisten des Qualitätsmanagements versprechen, Strategien und Instrumente bereitzustellen, Qualität professioneller als in der Vergangenheit bewirtschaften zu können. Ob sich die daran geknüpften Erwartungen erfüllen, hängt indessen davon ab, wie verständig die – in der Regel gar nicht so neuen – Werkzeuge und Denkansätze benutzt werden. Die Management-Historie ist gespickt mit verheißungsvollen Ansätzen, die je nach fachlicher Mode von noch prätentiöseren Konzepten abgelöst wurden.
Orientierungs- und Entscheidungshilfen zu bieten, ist Hauptanliegen dieses Buches. Es wendet sich angesichts einer Flut von Veröffentlichungen, die nicht selten im Kontext der Selbstvermarktung neuer Expertengruppen stehen, an eine kritische Leserschaft, die sich punktuell oder umfassend mit den theoretischen Grundlagen und/oder mit den in der Praxis vorherrschenden Konzepten und Instrumenten des Qualitätsmanagements beschäftigen will oder muss.
Dabei wurde hoffentlich erfolgreich versucht, in der Diktion nicht allzu "expertokratisch" zu sein, sondern Zusammenhänge so zu erläutern, dass auch "Nichteingeweihte" das Buch als Ganzes oder in Teilen verstehen und für ihre Zwecke nutzen können.
Peter Gerull
Hessisch Oldendorf, im Januar 2007
Anmerkungen zur Gliederung und Benutzung des Handbuchs
Der erste Teil des Buches hat synoptischen Charakter. Ausgehend von einer Erörterung wesentlicher Kontextfaktoren (Kap. 1.), werden in Übersichtskapiteln die spezifischen Grundlagen des Qualitätsmanagements und Schnittmengen zur Organisationsforschung (Kap. 2.) dargestellt. Dabei wird deutlich, dass Qualitätsmanagement kein distinktes Phänomen ist, sondern sich zentrale Anliegen auch unter organisationspsychologischen und -soziologischen Labels abhandeln lassen.
Nach einer Erörterung der Besonderheiten sozialer Dienstleistungen und ihres Managements (Kap. 3.) bildet eine systematische Beschreibung von über vierzig im deutschsprachigen Raum verwendeten Qualitätsmanagementansätzen und so genannten Kontextkonzepten den Hauptteil des Buches (Kap. 4.1 bis 4.5). Unter Berücksichtigung vorliegender Analysen und Erfahrungsberichte wird dabei auch eine Beurteilung der meisten Modelle und Verfahren im Hinblick auf verschiedene Kriterien gewagt. Um die Suche nach Primär- und/oder Sekundärliteratur zu bestimmten Qualitätssystemen und Kontextkonzepten zu erleichtern, sind den ensprechenden Kapiteln eigene Quellenverzeichnisse und Literaturempfehlungen (Fettdruck) beigefügt.
Es schließt sich eine Kurzdarstellung der prominentesten Werkzeuge aus dem Methodenarsenal der Qualitätsmanager vorwiegend ingenieur- und wirtschaftswissenschaftlicher Provenienz an, bevor die in sozialen Handlungsfeldern vorherrschenden Praktiken und Instrumente näher beschrieben, zum Teil auch kritisch gewürdigt werden (Kap. 4.6).
Danach stehen einige grundsätzliche Fragen der Implementierung im Mittelpunkt der Betrachtung. Angesichts der Vielfalt von Ausgangsbedingungen und Kontextfaktoren, unter denen sich soziale Organisationen mit Qualitätsmanagement beschäftigen, wird zwar auf konkrete "rezeptologische" Empfehlungen verzichtet, jedoch werden vermeidbare Fehler exemplarisch erörtert (Kap. 4.7).
Das nächste Kapitel (4.8) ist der Kontroverse "Zertifizierung oder Selbstbewertung" von Qualitätskonzepten gewidmet. Trotz versuchter Ausgewogenheit in der Darstellung und Hinweis auf die grundsätzliche Vereinbarkeit beider Ansätze wird dabei Verfahren der Selbstevaluation und strukturierten Selbstbewertung der Vorrang in sozialen Handlungsfeldern eingeräumt.
In einem Resümee und Ausblick werden die besonderen Anforderungen an ein Qualitätsmanagement sozialer Dienstleistungen sowie dessen mutmaßlicher zukünftiger Stellenwert erörtert (Kap. 5.). Erwartet wird eine zunehmende Absorption QM-typischer Fragestellungen und bewährter Methoden durch die Praxis bei sinkendem Aufmerksamkeitswert der QM-Rhetorik.
Ein umfangreiches Glossar (Kap. 6.), ein nach ausgewählten thematischen Schwerpunkten und sozialen Arbeitsfeldern gegliedertes Literaturverzeichnis (Kap. 7.) sowie eine Bibliographie zum Qualitätsmanagement in sozialwirtschaftlichen Organisationen (Schwerpunkt: Soziale Arbeit) mit allen Quellenangaben und den Ergebnissen einer aktualisierten Literaturrecherche in Fachzeitschriften und Verlagskatalogen vervollständigen das Werk (Kap. 8.).
Die insgesamt 18 Übersichtstafeln und 19 Abbildungen des Buches – letztere weit überwiegend anderen Publikationen entlehnt – sind abschließend aufgelistet (Kap. 9.).
Verwendete Fachbegriffe, die nicht im laufenden Text bzw. in Fußnoten erläutert sind, finden sich mit großer Wahrscheinlichkeit im Glossar.
1. Zum sozioökonomischen und fachlichen Kontext der Qualitätsdebatte
1.1 Zur Aktualität und Herkunft des Qualitätsdiskurses im Humandienstleistungsbereich
Neben dem Dauerbrenner-Thema der öffentlichen Finanznot und der aus dem Ruder gelaufenen Kosten ist im Humandienstleistungsbereich seit Anfang der Neunzigerjahre kaum ein Diskussionsgegenstand so prominent geworden wie Qualität und deren möglichst effektive und effiziente Steuerung durch Qualitätsmanagement. Die damit angeschnittenen Fragen haben angesichts veränderter Rechtsgrundlagen und verschärfter Wettbewerbssituation für viele sozialwirtschaftliche Organisationen[1] existentielle Bedeutung erlangt.
Konzentrierten sich gesetzgeberische Reformaktivitäten zunächst auf den Gesundheitsbereich, gerieten nach und nach auch andere soziale Arbeitsfelder in den Sog dieser Entwicklungen. So sind die meisten Einrichtungen und Dienste inzwischen explizit verpflichtet – wenn auch in unterschiedlicher Diktion[2] und Regelungstiefe – zu Maßnahmen
- der Qualitätsentwicklung und - bewertung (SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe),
- der Qualitätssicherung (SGB V – Gesetzliche Krankenversicherung),
- des Qualitätsmanagements (SGB XI – Soziale Pflegeversicherung) und
- der Qualitätsüberprüfung (SGB III – Arbeitsförderung).
Als exemplarisch für ein stark bundesgesetzlich normiertes Vorgehen kann das Pflege-Qualitätssicherungsgesetz (PQsG, Deutscher Bundestag, 2001) gelten, das die Träger von Pflegeeinrichtungen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung verpflichtet und dazu neben einem umfassenden internen Qualitätsmanagement auch die Teilnahme an externen Prüfverfahren vorschreibt. Am wenigsten normiert ist dagegen der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Dort gibt es lediglich auf Landesebene konkretere Vorgaben, die jedoch stärker auf Selbstbewertung und Dialog zwischen öffentlichen und freien Trägern abheben, als z. B. eine externe Prüfung oder Zertifizierung vorzusehen.
Weitere Beispiele für neue Anforderungen in diesem Kontext sind zu führende Wirksamkeitsdialoge (Landesjugendplan Nordrhein-Westfalen, vgl. Projektgruppe WANJA, 2000; Liebig, 2005) und vorzulegende jährliche Qualitätsberichte (Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz 1999; Fiene, Kirchner & Ollenschläger, 2001).
Wenngleich diese Entwicklung maßgeblich durch die Gesundheitsstrukturreform von 1989 und die Veröffentlichungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt, 1993, 1994, 1995) beeinflusst wurde, so stellen diese ihrerseits eher Wirkungen als Ursachen in einem komplexen Bedingungsgefüge dar, in dem u. a. der Kostendruck der produzierenden Wirtschaft und die Finanzschwäche der öffentlichen Hand eine zentrale Rolle spielen.
Systematisch lässt sich dieses Bedingungsgefüge differenzieren in
- gesellschaftliche,
- volkswirtschaftliche,
- sozialpolitische,
- betriebswirtschaftliche sowie
- fachliche und berufspolitische Faktoren.
Zu den gesellschaftlichen Gründen zählen ein Wandel der Erwartungen an die Erträge des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsystems und eine zunehmende Sensibilität der Verbraucher, Klienten, Bürger und anderer "KundInnen" gegenüber Qualitätsfragen. Dies sind in erster Linie Fragen nach Güte und Gebrauchswert von Produkten und Dienstleistungen, häufig veranlasst durch wahrgenommene Mängel, Verdrossenheit über vorgefundene Zustände oder medienwirksam aufbereitete nationale Misserfolge (Stichwort "PISA-Studie").
Gewachsen z. B.
- ist das Bedürfnis nach individuell zugeschnittenen und kundenfreundlich erbrachten Dienstleistungen auf Seiten selbstbewusster BürgerInnen,
- ist der Stellenwert von Mitbestimmung und Selbstverwirklichung im Beruf auf Seiten demokratiebewusster MitarbeiterInnen,
- sind Erwartungen an eine möglichst hochwertige Gegenleistung bei zunehmender finanzieller Selbstbeteiligung auf Seiten anspruchsbewusster LeistungsempfängerInnen,
- ist nicht zuletzt die Abhängigkeit überforderter KonsumentInnen von – vermeintlich – objektiven Rationalitätskriterien zur Entscheidungsfindung in einer unübersichtlichen Informations- und Warenwelt.
Zu den volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Gründen gehören vor allem:
- die zur Beseitigung nichttarifärer Handelshemmnisse entwickelten internationalen Qualitäts-sicherungs-Standards, die zunehmend auch im Dienstleistungsbereich Verbreitung finden (Stichwort "ISO 9001"),
- die wachstumsbedingte Krise der öffentlichen Haushalte, stagnierende Sozialbudgets und der einsetzende Umbau ("aktivierender Staat") bzw. Abbau ("Verschlankung") sozialstaatlicher Leistungen nach Maßgabe zunehmend neoliberaler Wirtschaftspolitik, davon ausgehend, dass der Sozialstaat bisheriger Prägung zu teuer, verhältnismäßig ineffektiv und global mit erheblichen Wettbewerbsnachteilen verknüpft sei (Stichwort "Agenda 2010"),
- die forciert betriebene Reorganisation der öffentlichen Verwaltungen nach Maßgabe betriebswirtschaftlicher Prinzipien (Stichwort "Neue Steuerungsmodelle"),
- die Stärkung der Position von Sozialleistungsträgern gegenüber den leistungserbringenden Einrichtungen durch die Einführung leistungsbezogener Finanzierungssysteme und Ziel-vereinbarungen (Stichwort "Kontraktmanagement"),
- die sich verschärfende Konkurrenz zwischen freigemeinnützigen und privat-gewerblichen Anbietern sozialer Dienstleistungen durch Öffnung des Marktes im Zuge des europäischen Einigungsprozesses (Stichwort "Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit").
Mitverantwortlich für den Boom des Qualitätsthemas waren insbesondere auch betriebswirtschaftliche Gründe:
- die Notwendigkeit der Kostensenkung durch Maßnahmen frühzeitiger Fehlererkennung und
-vermeidung, Reduzierung von organisationsinternen Reibungsverlusten sowie von Ausschuss, Nacharbeiten und Reklamationen,
- die aus Japan importierte Erkenntnis der Bedeutung "verschlankter" Organisation, "beherrschter" Geschäftsprozesse, "kontinuierlicher" Verbesserung und verwandter Managementprinzipien für eine kunden- und zugleich erfolgsorientierte Unternehmenspolitik,
- die in bestimmten Branchen üblich gewordenen Kundenforderungen nach zertifizierter Qualitätsfähigkeit von Geschäftspartnern und deren regelmäßiger Überprüfung durch akkreditierte Stellen,
- die leichtere Abwehr von Produkthaftungsansprüchen durch Nachweis systematischer Maßnahmen zur Qualitätssicherung, analog die Senkung des Strafrechts- und Haftungsrisikos durch Organisationsverschulden und Behandlungsfehler (vgl. Böckels, 2002).
Wenngleich somit die wesentliche Dynamik des aktuellen Qualitätsthemas durch Impulse ausgelöst wurde, die nicht aus den sozialen Berufen selbst stammen, sondern auf primär wirtschaftlichen und gesetzgeberischen Druck zurückgehen, ist doch die Behandlung von Qualitätsfragen jenseits aller Konjunkturen, sozialrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten und Moden immer schon Bestandteil professioneller Arbeit gewesen (Gerull, 1999, S. 13). Insofern müssen als viertes Einflussbündel auch fachliche und berufspolitische Gründe genannt werden, insbesondere:
- die einer kritischen Öffentlichkeit gegenüber, aber auch an die Akteure selbst gerichtete, verbesserte Legitimierung als Profession, deren Tätigkeit Laienhandeln überlegen ist und einen individuellen wie gesellschaftlichen Nutzen stiftet – den es im Zuge eines Qualitätsmanagements klarer zu beschreiben und nachzuweisen gilt (vgl. Engelhardt, 1999; König, 2000).
Sommerfeld & Haller (2003, S. 65) sprechen von der Ablösung des Konzepts des "Vertrauens" durch das Konzept der "Accountability". Wendt (1999, S. 12) versteht darunter eine aktive Rechenschaftslegung, durch die ein Unternehmen gegenüber Partnern, Kunden und Öffentlichkeit die Werte ausweist, die es erzeugt oder erhält; darüber hinaus wird die Funktion der Selbstbestätigung und Explizierung des Wertes eigenen Tuns betont (a.a.O., S. 13).
- die durch systematisches Qualitätsmanagement erhofften Möglichkeiten, Akteure in einem durch Unsicherheit, Rollenkonflikte und "Technologiedefizit"(Luhmann & Schorr, 1982) charakterisierten Handlungsfeld zu unterstützen (Stichwort "Personalentwicklung"), indem z. B. mehr Klarheit über zielführende Arbeitsabläufe (Stichwort "Prozessmanagement"), mehr Rückmeldung über das eigene Tun (Stichwort "Selbst-/Evaluation"), allgemein mehr Aufmerksamkeit für die Passung von Mensch und Organisation obwaltet (Stichwort "Organisationsentwicklung"), ohne die Besonderheiten Sozialer Arbeit aus dem Blick zu verlieren (vgl. Engelhardt, 1999).
- der wachsende Widerstand gegen eine "Kolonialisierung"(Sommerfeld & Haller, 2003, S. 84) der Sozialen Arbeit durch betriebswirtschaftliche Managementkonzepte, die sich einer technisch-formalisierenden Begrifflichkeit und Methodik bedienen und die sozialen Fachsprachen mit erheblichen Auswirkungen auf die kognitiven Strukturen der Akteure zu überwuchern drohen (vgl. Merchel, 2000; König, 2000).
- eine verstärkte (Rück-)Besinnung auf genuin sozialwissenschaftliche Beiträge (z. B. Selbstevaluation, Supervision) zur Bearbeitung der Qualitätsfrage, namentlich zur Professionalisierung der Organisationsformen sozialer Dienstleistungen und zur Kompetenzsteigerung ihrer Akteure (vgl. B. Müller, 2000; v. Spiegel, 2002; Spreyermann, 1996).
Mit der ausdrücklichen Betonung der Qualitätskategorie richtet sich die Managementanforderung nicht mehr nur auf die "Hardware" sozialer Einrichtungen und Dienste, sondern ebenso auf die "Software", auf das sozialpädagogische, pflegerische, therapeutische, beratende Handeln. Das eigentlich Neue der aktuellen Qualitätsdiskussion zeigt sich danach vor allem in fünf Punkten (vgl. Merchel, 2001b, S. 26f):
1. der Einbeziehung nicht nur strukturqualitativer Aspekte (z. B. in Entgeltverhandlungen) – früher zumeist mit fachlichen Standards (z. B. Fachpersonalquote) gleichgesetzt –, sondern ausdrücklich auch prozess- und ergebnisbezogener Kriterien;
2. der Forderung nach stärkerer Konkretisierung und Plausibilität der Standards und Konzepte, nicht zuletzt im Sinne einer Beschreibung des aktuellen state of the art, um fachliche Fehlervarianz zu reduzieren;
3. der Integration strukturierter und kontinuierlicher Verfahren der Qualitätsbewertung in den Leistungsprozess;
4. der stärkeren Berücksichtigung des einrichtungsübergreifenden Kontextes im Sinne von Infrastrukturqualität;
5. der Verbindung fachlicher und sozialpolitischer Aspekte des Qualitätsthemas – in der Sozial- und Jugendhilfe durch die Verkoppelung der drei Vereinbarungsarten über Leistung, Qualität/Prüfung und Entgelt/Vergütung ausgestaltet.
Von der Qualitätsdiskussion werden mehrheitlich Impulse erhofft, die Professionalisierung der Hilfesysteme zum Nutzen der "VerbraucherInnen" voranzubringen (z. B. Späth, 1999; Merchel, 2000b). Allerdings dürften die Erwartungen der verschiedenen Interessengruppen nicht alle miteinander zu vereinbaren sein (Gerull (Hrsg.), 2000, S. 1:6f), was den diskursiven Charakter des Qualitätskonstrukts im Sozialbereich unterstreicht:
- Kostenträger wollen Ausgabenbegrenzung und Planungssicherheit,
- LeistungsempfängerInnen suchen bedürfnisgerechte und qualifizierte Unterstützung,
- die Öffentlichkeit erwartet zielgenaue und wirksame Aufgabenerledigung,
- Einrichtungsträger sind an Image und Auslastung ihrer Angebote interessiert,
- Fachdisziplinen an Leistungserbringung nach dem "Stand der Kunst" und
- MitarbeiterInnen an guten Arbeitsbedingungen.
Erwartungen an die Qualitätsdiskussion
seitens der öffentlichen Kostenträger:
- mehr Markt- und Nachfrageorientierung, Wettbewerb und Aktivierung
- mehr Planungssicherheit und Transparenz durch verbindliche Leistungsvereinbarungen
- bessere Vergleichbarkeit der Leistungsangebote durch einheitliche Qualitätsstandards
- Sicherung des Wunsch- und Wahlrechts unter Wahrung der Prinzipien von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
seitens der leistungserbringenden Einrichtungen und Dienste:
- Erfüllung gesetzlicher Anforderungen unter Wahrung der Gestaltungs- und Organisationsfreiheit
- erfolgreiche Positionierung im Markt und Imageverbesserung
- effizientere und effektivere Verwendung der verfügbaren Ressourcen
- Professionalisierung durch Qualifizierung von Organisation und Personal
seitens der Adressat(inn)en:
- besserer Schutz vor unqualifizierten Interventionen seitens der Leistungsanbieter
- mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Leistungsgeschehens
- mehr Kundenorientierung und Beteiligung
- Sicherung des Wunsch- und Wahlrechts
seitens der Öffentlichkeit:
- mehr Sozialqualität im Sinne von demokratischer Korrektheit und Transparenz
- Verbesserung der sozialen Infrastruktur
- wirksamere Beiträge zur Bewältigung und Vorbeugung sozialer Probleme
- zweckmäßigere Verwendung von Steuermitteln und ein Ende der Beitragsspirale
1.2 Exkurs: Der Qualitätsdiskurs in der sozialwissenschaftlichen und psychologischen Fachliteratur
Die beschriebenen Veränderungen der relevanten Umweltbedingungen für sozialwirtschaftliche Organisationen sind nicht auf nationale Kontexte beschränkt, sondern haben zumindest für die Industrieländer inter- bzw. transnationale Dimensionen erreicht (Köpp & Neumann, 2002, S. 1). Die gemeinhin unter der Bezeichnung Qualitätsdebatte oder Qualitätsdiskussion erörterten Fragestellungen – in den USA auch als quality movement charakterisiert (vgl. Cole & Scott, 2000) – sind zu einem zentralen Thema des zeitgenössischen Modernisierungsdiskurses[3] geworden. Dessen Erscheinungsformen unterscheiden sich kaum: "Immer geht es um Fragen der Messung, Standardisierung und Kontrolle, um Effektivität und Effizienz sowie vor allem um Management"(Köpp & Neumann, 2002, S. 11).
Welche Herausforderung die deutsche Qualitätsdebatte für die leistungserbringenden sozialen Einrichtungen und Dienste, ihre Träger, Interessenverbände und professionellen Kooperationspartner in Politik und Forschung bedeutete, lässt sich ermessen, wenn man sich die Entwicklung einschlägiger Fachpublikationen bibliometrisch vor Augen führt.
Zu einem großen Teil von berufsmäßigen Profiteuren der Debatte (FachautorInnen, FortbildnerInnen, UnternehmensberaterInnen, FunktionärInnen, ReferentInnen u. a.) und Leitungskräften mit mehr oder minder großer Affinität zum Managerialismus[4] verfasst, bringt die schiere Zahl von Buch- und Zeitschriftenbeiträgen, Positionspapieren und Erfahrungsberichten gut zum Ausdruck, welche materiellen und immateriellen Ressourcen in das Thema investiert wurden und immer noch werden.
Im Vordergrund vieler Veröffentlichungen stehen sozialrechtliche Regelungen, deren mögliche Folgen und betriebswirtschaftliche Anforderungen für Einrichtungen und Dienste diskutiert und/oder durch praktische Empfehlungen und Handlungsanleitungen ergänzt werden, während grundlagentheoretische Beiträge eher selten anzutreffen sind (vgl. Köpp & Neumann, 2002, S. 4).
Ohne inhaltlich und/oder arbeitsfeldspezifisch zu differenzieren und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, verdeutlicht umseitige Abbildung den quantitativen Literatur-Output am Beispiel der Sozialen Arbeit und ihrer Grenzbereiche.
Qualitätsmanagement wird explizit bereits seit Längerem in Lehrbüchern der Sozialwirtschaft bzw. des Sozialmanagements (z. B. Arnold & Maelicke, 1998; Badelt, 1997; Hauser, Neubarth, Obermair, 1997; Merchel, 2001b) und in zahlreichen Monographien (z. B. Knorr & Halfar, 2000; Maelicke, 1996; Müller-Kohlenberg & Münstermann, 2000; Peterander & Speck, 1999; Schubert & Zink, 2001) behandelt, wenn auch überwiegend in Form theoretisch unverbundener Einzeldarstellungen, Erfahrungsberichte und Kongressbeiträge – was angesichts der Tatsache, dass Qualitätsmanagement kein einheitliches oder standardisiertes Phänomen darstellt (Pollitt, 2000, S. 68), nicht verwundern kann. Die Anzahl arbeitsfeldspezifischer Musteranleitungen und Lehrmaterialien, Hand- und Werkbücher geht darüber noch hinaus und macht einen beträchtlichen Teil der im Diagramm erfassten Beiträge aus.
Für den Bereich der Sozialwissenschaften lässt sich somit konstatieren, dass sich ein breiter, mit Modellen, Verfahrensvorschlägen und Konzepten angereicherter Publikationsmarkt entwickelt hat (vgl. Köpp & Neumann, 2002, S. 3ff.), dessen quantitativer Höhepunkt allerdings überschritten zu sein scheint (s. Abb. 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1
Quelle: eigene Recherchen
Ganz anders stellen sich die Verhältnisse im Bereich der Psychologie dar. Zu den laut Diagrammtitel einbezogenen Grenzbereichen gehören zwar auch psychologische Beiträge aus der Kinder- und Jugendhilfe, Jugendpsychiatrie und Heilpädagogik. Aus dem Bereich der Erziehungsberatung wurde z. B. bereits 1998 ein zweibändiges Werk zum Qualitätsmanagement vorgelegt, das zahlreiche Aspekte der Diskussion thematisiert (Dietzfelbinger & Haid-Loh, 1998). Klinisch tätige Psychologen waren ohnehin relativ früh von deren Auswirkungen im Gesundheitswesen tangiert und meldeten sich zu Wort (Schwarz, 2000).
Im Verhältnis zur Gesamtzahl der einschlägigen Publikationen muss jedoch festgestellt werden: Das Qualitätsthema scheint auf breiter Front noch nicht in der Psychologie angekommen zu sein!
Dieser Eindruck bestätigt sich besonders augenfällig in jener Teildisziplin, die sich mit "Zusammenhängen des Erlebens und Verhaltens bzw. Handelns des Menschen mit Struktur-, Prozess- und Zielcharakteristika von Organisationen" befasst (Schuler, 2004, S. 10) – die Organisationspsychologie. Ein Qualitätsmanagement im Sinne umfassender qualitätsbezogener Kontextsteuerung (vgl. Schiepek & Bauer, 1998, S. 27) in einer Organisation ist – so sollte man meinen – genuiner Forschungsgegenstand einer zeitgemäßen Organisationspsychologie, die zunehmend auch den Einfluss von Makrovariablen auf Person, Gruppe und Organisationsverhalten in den Blick nimmt (Weinert, 1998, S. 61 ff.).
Bei Durchsicht aktueller Lehrbücher der Wirtschafts-, Arbeits- und Organisationspsychologie (z. B. Frieling & Sonntag, 1999; Gebert & Rosenstiel, 2002; Hoyos & Frey, 1999; Kirchler, 2003; Rosenstiel, 2000; Schuler, 2004; Ulich, 2001; Weinert, 1998; Wiswede, 2000) fällt indes der geringe Anteil auf, der diesem Thema gewidmet ist.
Der Qualitätsbegriff als Index-Kategorie kommt nur in zusammengesetzten Termini vor wie "Qualität der Arbeit/des Lebens/des Arbeitslebens"(z. B. Weinert, S. 6, 57, 194 ff., 400 ff.; Schuler, S. 48, 161, 563f, 594; Ulich, S. 51),"Qualitätsaudit"(z. B. Frieling & Sonntag, S. 65) oder "Qualitätszirkel"(z. B. Rosenstiel, S. 102 ff., 208, 280; Frieling & Sonntag, S. 178, 435; Wiswede, S. 192; Weinert, S. 8, 20, 58, 182, 398 ff., 493, 496; Schuler, S. 389, 402, 405, 446 ff., 563).
Qualitätsmanagement wird bei Wiswede, Kirchler, Frieling & Sonntag, Rosenstiel sowie Gebert & Rosenstiel gar nicht und bei Weinert nur in Verbindung mit der Entwicklung der Organisationsstruktur (a.a.O., S. 644f) und der Organisationsstrategie/-philosophie des Total Quality Management kurz erwähnt (a.a.O., S. 678f), ebenso bei Ulich (a.a.O., S. 359), während der Begriff bei Schuler immerhin elfmal auftaucht und im Rahmen der Diagnose von Qualität auf knapp vier Seiten exemplarisch erörtert wird (Büssing, in Schuler, a.a.O., S. 591 ff.).
Eine Ausnahme bildet das Kapitel "Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement" von Schultz-Gambard, Lauche & Hron in Hoyos & Frey (1999), das sich unter den erwähnten Lehrbüchern als einziges systematisch mit dem Thema befasst und dessen psychologische Implikationen ansatzweise diskutiert (a.a.O., S. 94 ff.). Auch diese AutorInnen konstatieren jedoch: "Die Psychologie hat ... TQM (s. Kap. 2.1, P. G.) nicht als wichtigen Forschungsgegenstand erkannt ..."(a.a.O., S. 94).
Recherchen im aktuellen Fachwortverzeichnis der American Psychological Association (APA) und in mehreren amerikanischen Hand- und Lehrbüchern der Industrie- und Organisationspsychologie ergeben ein ähnliches Bild.
In der jüngsten Auflage des Thesaurus of Psychological Index Terms (Walker, 2001) ist unter quality management oder quality assurance Fehlanzeige zu vermelden; lediglich quality circles, quality control, quality of care, quality of education, quality of life, quality of services und quality of work life kommen im Index vor.
Hellriegel, Slocum & Woodman (1995), Aamodt (1996), Muchinsky (2000) und DuBrin (2002) verwenden den Begriff des quality management gar nicht bzw. nur in Verbindung mit Total Quality Management (z. B. DuBrin, S. 295f). Bei Hellriegel et al. wird TQM als Stichwort relativ häufig erwähnt und als eines von mehreren "organizational issues for the 1990s"(a.a.O., S.11f) auf gut einer Seite gewürdigt. Sogar die ISO 9000 findet als vor allem in Europa angewandtes Qualitätssicherungs-System bei den Autoren Beachtung (a.a.O., S. 211f). Ansonsten wird Qualität nur als quality of work life (Hellriegel et al., a.a.O., S. 659, 695; Aamodt, a.a.O., S. 270 ff.; Muchinsky, a.a.O., S. 6f, 453f), quality circles (Hellriegel et al., a.a.O., S. 701; Aaamodt, a.a.O., S. 445), und quality-enhancement strategy (Muchinsky, a.a.O., S. 173) thematisiert.
Dass die randständige Position des Qualitätsthemas in Lehrbüchern der Psychologie kein Charakteristikum dieser – naturgemäß nicht immer topaktuellen – Publikationsform ist, bestätigt sich bei Durchsicht namhafter psychologischer Datenbanken und Bibliotheksregister, auch unter Einschluss internationaler Zeitschriftenbeiträge (PSYNDEXplus, PsycInfo u. a.).
Andererseits:
So wenig Qualität im Sinne des Bemühens um Fachlichkeit und Nutzenstiftung eine Erfindung des Qualitätsmanagements ist, so unstreitig dürfte sein, dass die Güte z. B. von unternehmerischen Problemlöse-, Führungs- und Entscheidungsprozessen sowie Strategien des Managements, durch geeignete Maßnahmen und Vorkehrungen solche Qualität zu optimieren, implizit schon lange – spätestens seit der humanistischen Neuorientierung der Disziplin in den Siebzigerjahren (vgl. Greif, 2004, S. 48) – im Zentrum organisationspsychologischen Interesses stehen. Stellvertretend seien hier nur die Bereiche der Personalauswahl und -entwicklung genannt, in denen es letztlich um qualitative Verbesserungen zugunsten von Organisationszielen und beteiligten Menschen ging und geht.
"Der Gefahr entgegenzutreten, dass Menschen allein als Produktionsfaktoren betrachtet werden, dass individuelle Interessen grundsätzlich der wirtschaftlichen und technischen Rationalität geopfert werden, bleibt … im Berufsleben eine ubiquitäre Aufgabe"(Schuler, 2004, S. 12).
1.3 Zur Professionalisierung sozialer Berufe
Arbeit wird zum Beruf durch zunehmende Qualifizierung und Spezialisierung; ein Beruf wandelt sich zur Profession, wenn diese Prozesse eine spezielle Ausprägung erreicht haben. Der folgende Merkmalskatalog verdeutlicht dies (Depner/Trube, 2001, S. 230):
- Professionen haben ein öffentliches Mandat zur Realisierung von gesamtgesellschaftlich als wichtig anerkannten Wert- und Zielvorstellungen, zeichnen sich also durch eine kollektive Dienstleistungsorientierung aus.
- Charakteristisch für Professionen ist ihr öffentlich anerkanntes Expertentum mit wissenschaftlich fundierter Praxis auf der Basis spezialisierten Wissens und Könnens.
- Professionen verfügen über ein Monopol zur Berufsausübung, sofern es gelingt, die Gesellschaft von der eigenen Nützlichkeit zu überzeugen.
- Professionen haben im Unterschied zu Berufen eine weitgehende Autonomie bei der Problemdefinition und der Berufsausübung sowohl gegenüber Klienten oder Nutzern als auch gegenüber anderen gesellschaftlichen Institutionen.
- Professionen verfügen über berufsständische Organisationen, die für die Vereinheitlichung und Kontrolle von Standards für Zugang, Ausbildung und Berufsausübung, für die Entwicklung und Wahrung eines spezifischen Wertecodex sowie für die sozioökonomische Interessenvertretung ihrer Angehörigen verantwortlich sind.
Bemessen an diesen Kriterien, kann vielen Berufen in sozialen Handlungsfeldern nur eine unvollständige oder relative Professionalisierung attestiert werden (a.a.O., S. 231).
Soziale Arbeit z. B. wird als eine „bescheidene Profession“(Schütze, nach Müller, 1997c, S. 73) ohne spezialisiertes Wissensmonopol bezeichnet; dafür sei sie jedoch Spezialistin in der Bewältigung von Ungewissheit und „gemischten Gefühlen“ in einem auf „Koproduktion“ angelegten Aufgabenfeld .
Die relative Professionalisierung sozialer Berufe sollte nach Depner/Trube (a.a.O.) jedoch nicht dadurch überwunden werden, dass etwa dem Professionalisierungsprozess der Ärzte und Anwälte ungeprüft nachgeeifert werde. Die Parzellierung und Spezialisierung fördere zwar die innere Homogenität eines Berufes und damit dessen Professionalisierung. Psychosoziale Probleme seien aber komplexer Natur und ließen sich nicht so parzellieren, dass sie mit dem Angebots- bzw. Hilfespektrum der Profession übereinstimmten.
Mit den heutzutage vorherrschenden chronisch-degenerativen Erkrankungen und den damit unweigerlich verstärkt auftretenden psychosozialen Problemen werde dieser Widerspruch ja auch in der Medizin augenfällig. Ärzte hätten die entscheidenden Schübe zur Professionalisierung ihres Berufs in Zeiten der Dominanz infektiöser Erkrankungen errungen, von deren wirksamer Bekämpfung mit ärztlichen Mitteln sie die Gesellschaft seinerzeit zu überzeugen vermochten. Die seitdem wachsende Kluft zwischen den Leistungsangeboten der Medizin und den Leistungserwartungen der Gesellschaft im Hinblick auf die Lösung dieser Probleme gefährde die Außenlegitimität des Berufsstandes und damit auch seinen Status als Profession (a.a.O., S. 232).
Als Essentials einer eigenständigen Professionalisierung sozialer Berufe werden von Depner/Trube betrachtet (a.a.O., S. 233):
- eine identitätsstiftende Interdisziplinarität, ein Selbstverständnis als typisches Querschnittsfach mit ausgeprägter Anwendungsorientierung,
- die Entwicklung innerberuflicher Standards im Sinne von systematischem, wissenschaftlich begründetem Handlungswissen,
- eine verbesserte Legitimierung nach außen durch Nachweis der erbrachten Leistungen,
- die Herausbildung einer eigenen beruflichen Ethik.
Auch für Olk (1994, S. 28) ist das Strukturmuster professionalisierten sozialen Handelns im Unterschied zu wirtschaftlichem und bürokratischem Handeln ähnlich gekennzeichnet, nämlich durch zwei wesentliche Merkmale: zum einen durch die Anwendung wissenschaftlich generierten Wissens auf lebenspraktische Handlungsprobleme sowie andererseits durch die Verpflichtung auf ein Dienstideal (professionelle Ethik).
1.4 Zum Stellenwert der Fachlichkeit
Der Begriff der Fachlichkeit wird häufig synonym mit "Professionalität" verwendet und grenzt berufsförmiges, auf Ausbildung basierendes, methodisches Handeln von laienhaftem Handeln (z. B. im Rahmen von Selbsthilfe und Ehrenamt) ab (Galiläer, 2005, S. 141). Pragmatisch unterschieden werden drei Ebenen von Fachlichkeit (a.a.O.):
- fachliche Standards (z. B. hinsichtlich Ausstattung, Verfahrensweisen),
- Handlungsmaximen/normative Leitvorstellungen (z. B. Lebensweltorientierung),
- Anwendung von Methoden (z. B. Case Management, kollegiale Beratung).
Verbesserte Fachlichkeit im Sinne einer Qualifizierung der Akteure im sozialen Dienstleistungsbereich wird seit den Siebzigerjahren als qualitätssichernder Garant angesehen (Engel/Flösser/Gensink, 1996, S. 49f). Dabei vollzog sich in der Auffassung von Fachlichkeit eine bedeutende Veränderung:
„Berufspolitische Ambitionen in Verbindung mit einem szientistischen Handlungsverständnis mündeten in die Figur der Expertin/des Experten, die eine rationale, fachlich begründete Problembearbeitung gewährleisten sollte. Der Erneuerungsdruck durch die Kritik der mit dem Aufkommen der Neuen Sozialen Bewegungen der 70er und 80er Jahre entstehenden Selbsthilfeinitiativen hatte in der Folge großen Einfluss auf die Bestimmung von ‘guter’ Sozialer Arbeit. Vehement beanstandet wurden insbesondere expertokratische Problemlösungen, ein entmündigender Zugriff auf die Autonomie der Lebenspraxis der Subjekte und die Parzellierung der Problemlagen. Als Reaktion folgte mit dem ‘Abschied vom Experten’ (Olk, 1986) eine stärkere Zuwendung zu einer kompetenztheoretischen Fundierung der Sozialen Arbeit, die in der Programmatik einer ‘Neuen Fachlichkeit’ (Müller u. a., 1982, 1984) ihr vorläufiges Ende fand“(a.a.O.).
Auch in der aktuellen Qualitätsdebatte spielt der Rekurs auf die Fachlichkeit eine wichtige Rolle.
„Als fachlich kann hier zunächst dasjenige Verhalten gelten, das die spezifische Sachlogik eines Gegenstandsbereiches mithilfe von spezifischen Wissensbeständen erfasst und hieraus bestimmte Handlungskonsequenzen im Hinblick auf bestimmte langfristige Ziele zieht, die als erstrebenswert gelten. Fachlichkeit stellt ein für eine Profession standardisiertes Wissen mit entsprechender Handlungskompetenz und scheinbar daraus evident folgenden praktischen Konsequenzen dar, jenseits von individuellen Werteinstellungen"(Maaser, 2002, S. 137).
Diese Evidenz wird allerdings als trügerisch bezeichnet (a.a.O.).
"Der Fachlichkeit selbst inhärieren nicht automatisch homogene, prinzipiell erstrebenswerte Ziele. Die normativen Voraussetzungen und damit verklammerten Handlungskonzepte sind durchaus unterschiedlich, teilweise diametral entgegengesetzt“(a.a.O.).
Fachlichkeit wird somit als zwar notwendiger, jedoch nicht hinreichender Bestandteil von Qualität betrachtet (a.a.O., S. 138). Diese entscheidet sich nach Maaser (a.a.O., S. 140) an dem „extrafunktionalen, ethisch begründeten Qualitätskriterium“, ob Fachlichkeit primär in den Dienst einer „nachhaltigen, selbständigen Lebensführung“ der Klienten oder einer nur formal-funktionalen Inklusion und Integration gestellt werde.
Am Beispiel des „creaming-the-poors“-Effekts wird nachzuweisen versucht, dass die neuen Steuerungsformen des Sozialstaats (veränderte Finanzierung, Ergebnisorientierung, Wettbewerb, Kontraktmanagement u. a.) eine ethisch höchst fragwürdige Dynamik zur Selektion jener Adressaten auslösen, die für die Selbsterhaltung der Wohlfahrtsorganisationen interessant erscheinen (a.a.O., S. 139ff.). Eine selektive Auswahl der Programmteilnehmer bei Arbeitsförderungsmaßnahmen erhöht z. B. die Erfolgsquote in der Integrationsbilanz.
Auch Depner/Trube (2001, S. 234) befürchten deshalb, dass unter den neuen Marktbedingungen ein unbegrenzter Wettbewerb zwischen den sozialen Dienstleistern zu einer Art „Schmutzkonkurrenz“ verkommen kann.
Die Qualität sozialer Dienstleistungen angemessen zu diskutieren, setzt folglich sowohl in professionstheoretischer Hinsicht als auch unter Fachlichkeitsgesichtspunkten eine Einbeziehung der ethischen Dimension voraus.
1.5 Zu ethischen Aspekten des Qualitätsthemas
Dass die Qualität sozialer Dienstleistungen auch normative und damit ethisch zu reflektierende Voraussetzungen und Implikationen besitzt, wird in der Regel als Konsens angesehen (Maaser, 2002, S. 135). Dabei wird zumeist an interpersonale Aspekte des Geschehens, an Beziehungsqualität und Koproduktionscharakter sozialer Dienstleistungen gedacht. Normative Vorstellungen und Standards erweisen sich jedoch auch darin, wie eine Gesellschaft soziale Dienstleistungen organisiert.
So betont Maaser (a.a.O., S. 135ff.), dass sich im Gefolge des sozialstaatlichen Legitimationsdiskurses (Kritik am „Versorgungsstaat“, Missbrauchsdebatte, Mitnahmeeffekte[5] ) ein neues Verständnis von Wohlfahrtskultur herausbilde, das als sozialethische Verlagerung von der Gerechtigkeits- auf die Barmherzigkeitsperspektive bezeichnet werden könne. Die Zurücknahme von selbstverständlich gewordenen Rechten und die stärkere Individualisierung gesellschaftlicher Risiken werden als ethisch zu reflektierende Veränderungen auf der strukturqualitativen Makroebene betrachtet.
Eingefordert wird ein Beitrag der Fachlichkeit sozialer Berufe, insofern diese konkretisieren könnten, welche Mindestrealisierungsbedingungen für gesellschaftliche Grundgüter wie Rechte, Freiheiten und Chancen ein Individuum benötigt, um ein nachhaltig selbständiges Leben zu führen (a.a.O., S. 138f). In der sozialethischen Reflexion solcher normativen Dimensionen des Berufsalltags wird ein Beitrag gesehen, soziale Problemlagen nicht als individualisierte, moralische Schuldprobleme des Klienten wahrzunehmen und ggf. als Versagen der professionell Helfenden zu deuten (a.a.O., S. 141).
Andere Autoren problematisieren Aspekte der Dienstleistungsorientierung und Qualitätsbestimmung im Sozialbereich und weisen auf entscheidende Unterschiede zu anderen Handlungsfeldern hin.
So hält etwa B. Müller (1996c) für die Anwendbarkeit von Marktmodellen auf das Soziale den ursprünglichen Charakter des Marktes als Ort des Austauschs für entscheidend: dass Partner im Bewusstsein gegenseitiger Abhängigkeit etwas voneinander wollen, sich jedoch nicht bedingungslos verpflichtet sind und nicht gegenseitig ihren Willen aufzwingen können, sich aber an bestimmte Spielregeln halten müssen (a.a.O., S. 76). Eine solche Dienstleistungsethik als Ethik fairer Zweckbündnisse wird sozialen Handlungsfeldern zwar als grundsätzlich angemessen betrachtet, jedoch nicht als hinreichend, weil sie immer funktionalen Charakter habe, also von einem Zweck-Mittel-Verhältnis her gedacht sei (a.a.O., S. 78). Darüber hinaus wird auch eine Ethik der Fürsorge und eine politische Ethik für notwendig gehalten, um dem Charakter sozialer Handlungsfelder gerecht zu werden (a.a.O., S. 77f).
Auch Depner/Trube (2001, S. 233ff.) betonen die Notwendigkeit extrafunktionaler Qualitätskriterien und verbinden damit die Frage nach einer universalistischen Ethik des Sozialen, damit Soziale Arbeit nicht zum willfährigen Handwerkszeug gesellschaftlicher Selektionsprozesse verkomme (a.a.O., S. 237).
Heiner (1996a, S. 28f) weist auf einen maßgeblichen Unterschied zwischen Humandienstleistungen und Güterproduktion hin:
„Die Qualität von Humandienstleistungen hängt entscheidend davon ab, welche Vorstellung eine Gesellschaft und dabei auch die zuständigen Berufe davon haben, wie man mit Menschen umgehen sollte, was man ihnen zumuten darf und was man ihnen schuldet. Diese ethische und normative Dimension des Qualitätsbegriffes ist für Humandienstleistungen zentral, während es bei der Produktion von Gütern nur um das Ethos der Zuverlässigkeit geht.“
1.6 Zur Ethik des Marktes
Das Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesen lässt sich – zumindest weit überwiegend – jenem Bereich des Wohlfahrtsdreiecks aus Markt, Staat und Gesellschaft[6] zuweisen, der gemeinhin als „intermediär“ bezeichnet wird (Hochstrasser, 1997, S. 7ff.). Er ist dadurch charakterisiert, dass er nicht eindeutig einem der drei Pole zugeordnet werden kann, diese aber in ihn hineinwirken.
Vor allem seitens des Marktes drängt die zugehörige Ideologie in den intermediären Bereich: Er soll zunehmend marktähnlich funktionieren, ungeachtet dessen, dass die „Kunden“ und „Produktionsbedingungen“ personaler Dienstleistungen sich erheblich vom Wirtschaftsmarkt unterscheiden und ein spezifisches Verständnis von Qualität erfordern.
Dem Marktdiktat mit seiner „Logik und Praxis des rücksichtslosen Profits“(Hochstrasser, a.a.O., S. 17) gilt es deshalb, die politisierte Kategorie der „Sozialqualität“ gegenüberzustellen . Dies schließt eine „maßvolle und bedachte Ökonomisierung“(Hauser u. a., 1997, S. III) und ein Lernen von der Wirtschaft ohne Berührungsängste, z. B. im Hinblick auf ein besseres Marketing nicht aus (Hütte, 1998, S. 120). Im Gegenteil: Die „Rückführung (hier: der Sozialpädagogik, P. G.) aus den subventionierten Kunstgärten in die ökonomischen Lebenswirklichkeiten“ wird als nicht zu unterschätzender Qualitätsbeitrag bewertet (a.a.O., S. 121).
Hütte (a.a.O., S. 118) vertritt aus der Perspektive der Jugendhilfe allerdings zugleich die These, dass eine konsequente Deregulierung höhere Rationalisierungseffekte einbringen würde als die derzeit stattfindende "pseudoökonomische Verregelung" der Sozialen Arbeit.
Die Frage lautet daher nicht "Markt: ja oder nein?" sondern "Wie viel Markt?“
Eindeutig Stellung hierzu bezieht Speck (2002):
„Natürlich kann das Marktprinzip auch Kostenreduzierungen bewirken; aber dies geschieht nicht eo ipso und nicht in jedem Falle ohne gravierende soziale Folgen. Es ist undenkbar, erreichen zu wollen, dass es durch Auslese oder Wettbewerb auf dem ‘Sozialmarkt’ nur hochqualitative Einrichtungen gibt. Sollen die - aus welchen Gründen auch immer - qualitativ weniger begünstigten Einrichtungen ‘schöpferisch zerstört’ werden? Betroffen wären davon immer Menschen!“(a.a.O., S. I.7:5f). „Die gegenwärtige Überhitzung des wirtschaftlichen Wettbewerbs forciert den Eigennutz, auch der verschiedenen Korporationen. Das Soziale droht dabei zu einem Epi-Phänomen zu degenerieren.“
Das Wirtschaftssystem wird von Speck als ein eigenes, selbstreferenziell konstituiertes System betrachtet, das sich am eigenen Wachstum orientiere und zu dessen Aufgabe es nicht gehöre, sich an der Lösung anderer Probleme, zum Beispiel sozialer, zu beteiligen . Moralisches Handeln sei für die Wirtschaft nicht nur entbehrlich, sondern geradezu dysfunktional (Luhmann, nach Speck, 1999b, S. 21). Die fortschreitende Ökonomisierung teile die Gesellschaft immer deutlicher in "Gewinner“ und "Verlierer“(Speck, 2002, S. 6ff.), belegbar durch
- vermehrte Kinderarmut,
- selektive Tendenzen in der Bildungspolitik,
- Kosten-Nutzen-Mentalität in der Gesellschaft,
- Reduktion der Sozialhilfe auf das Notwendige (Unbedingt-Notwendige?),
- soziale Segregationstendenzen in der Gesellschaft .
Speck (2000, S. 32) fordert, dass die Qualität sozialer Dienste primär von der Orientierung an der Lebensqualität des hilfebedürftigen Menschen her bestimmt bleiben müsse; der Wert der Wirtschaftlichkeit und des Nutzens lasse sich nur als Teilwert legitimieren. „Persönliche Verantwortung für den anderen ist von keiner noch so kontrollierten Organisiertheit und von keinem noch so versierten Managementapparat überholbar“(a.a.O., S. 33).
Depner/Trube (2001) sehen einen Entwicklungstrend vom Wohlfahrtsstaat zum Wettbewerbs- bzw. zum „aktivierenden“ Sozialstaat.
Kurzgefasst lautet ihre Analyse (a.a.O., S. 217f): Globalisierung und internationaler Wettbewerb führen auf der nationalen Ebene zunehmend zur Marginalisierung der quasi „konkurrenzuntüchtigen“ Personen, deren typische Problemlagen allerdings zumeist individualisierend diagnostiziert werden. Sie sind deswegen Adressaten der Sozialen Arbeit (und nicht der Sozialpolitik), der jedoch immer weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, da für den Nationalstaat aufgrund von internationalisierten Geld- und Güterströmen zunehmend Steuerabschöpfungsmöglichkeiten verloren gehen. Aufgrund dessen entwickelt sich zumeist zusätzlich noch ein Trend zur Senkung von Sozialabgaben, um in der weltweiten Standortkonkurrenz dem flexiblen Kapital die „besseren“ Konditionen anzubieten. Dies verknappt wiederum die Geldmittel für soziale Leistungen, so dass die praktische Sozialarbeit unter noch größeren Effizienzdruck kommt. Sie hat nachzuweisen, dass sie die Modernisierungsopfer doch noch durch „qualitativ hochwertige“ Interventionen aktivieren kann, um sie möglichst unabhängig von konsumtiven staatlichen Transferleistungen zu machen.
Der Rückzug aus aktiver Sozialstaatlichkeit und die Hoffnung der Protagonisten einer („europäischen“) Zivilgesellschaft und des („amerikanischen“) Kommunitarismus, dass Bürger sich selbstbestimmt in einer demokratischen Wohlfahrtsgesellschaft[7] (Keupp, 2000, S. 41) organisieren, statt sich vom Versorgungsstaat alimentieren zu lassen, verschleiert nach Depner/Trube allerdings , wem diese Entwicklung letztlich nütze und schade:
Sie „schadet dem klassischen Klientel der Sozialen Arbeit, und von der Zivilgesellschaft profitieren die, denen es bereits jetzt schon materiell gut geht, die in ihrem sozialen Status und in ihrer personalen Identität nicht beschädigt sind und die die weiteren Modernisierungsschübe unserer Gesellschaft nicht nur nicht fürchten müssen, sondern denen sich hier neue Handlungsspielräume eröffnen“(a.a.O., S. 224).
1.7 Struktur des deutschen Sozialsystems und Rolle freier Träger
Die Bundesrepublik Deutschland ist nach ihrer Verfassung, dem Grundgesetz, ein demokratischer und sozialer Bundesstaat (Art. 20 Abs. 1 GG). Auch die verfassungsmäßige Ordnung der sechzehn Bundesländer muss den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen (Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG). Der Sozialstaatsgrundsatz legitimiert den Gesetzgeber, leistend und gestaltend tätig zu werden, indem er sich um soziale Gerechtigkeit bemüht und die Sicherheit der BürgerInnen zu gewährleisten sucht.
Allerdings ist trotz bundesgesetzlicher Regelungen die inhaltliche Konkretisierung sozialer Dienstleistungen keineswegs einheitlich vorgegeben, sondern eine Angelegenheit sozialpolitischer Aushandlungsprozesse zwischen Bund, Ländern und Gemeinden unter Beteiligung freigemeinnütziger Wohlfahrtsverbände. Im Rahmen der bundesweit geltenden Normen, die im Sozialgesetzbuch I ausformuliert sind, verfügen namentlich die Kommunen über eigene Gestaltungsspielräume, z. B. was Menge und Qualitätsstandards von Leistungen, pluralistische Trägerlandschaft und Angebote von Diensten und Einrichtungen anbelangt (Backhaus-Maul, 1998, S. 26).
Dem Sozialstaatspostulat verpflichtet sind jedoch nicht allein der Bund und seine Verwaltungseinheiten; vielmehr verwirklichen sich entsprechende Grundsätze auch im solidarischen und sozialen Verhalten der BürgerInnen, in individueller und kollektiver Selbsthilfe sowie durch mitmenschlichen Beistand in Notsituationen (Wienand, 1999, S. 10). Ungeachtet dieser notwendigen "privaten Fürsorge", die in ihren unterschiedlichen Ausgestaltungen zum "Sozialkapital" einer Gesellschaft beiträgt (J. Müller, 2002), beruht das bundesdeutsche Netz der sozialen Sicherung im Wesentlichen auf den drei Säulen der
- Sozialversicherung (nach einer neueren Systematisierung auch als soziale Vorsorge bezeichnet, Schulin & Igl, 2002) als einer weitgehend beitragsfinanzierten Solidargemeinschaft zur Absicherung des Lebensstandards gegen Risiken infolge von Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Unfall, Berufs- und Erwerbsunfähigkeit, Erreichen der Altersgrenze oder Arbeitslosigkeit;
- Versorgung (auch als soziale Entschädigung bezeichnet, Schulin & Igl, 2002) als einer aus allgemeinen Steuermitteln finanzierten Absicherung des Lebensstandards bestimmter Personengruppen – z. B. Beamte, Soldaten und Zivildienstleistende – sowie zum begrenzten Ausgleich von Schäden, für die das Gemeinwesen gesteigerte Verantwortung trägt, z. B. Kriegsopfer, Opfer von Gewalttaten und Impfgeschädigte;
- öffentlichen Fürsorge (bzw. soziale Förderung und Sozialhilfe, Schulin & Igl, 2002) als einer aus überwiegend kommunalen Steuermitteln finanzierten und gegenüber anderen staatlichen Sozialleistungen und familiärem Unterhalt nachrangigen Hilfe bei individueller Bedürftigkeit. Die entsprechenden Leistungen lassen sich differenzieren in ein
1. besonderes Hilfe- und Fördersystem (Ausbildungs- und Berufsförderung, Kinder- und Erziehungsgeld, Unterhaltsvorschuss, Wohngeld, Kinder- und Jugendhilfe) und ein
2. allgemeines Hilfe- und Fördersystem (Sozialhilfe zur Sicherung des Existenzminimums und zur Hilfe und Förderung in besonderen Bedarfslagen wie Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, vgl. Wienand, 1999, S. 13).
Leitziele dieses sozialen Sicherungssystems sind größtmögliche Gerechtigkeit, Solidarität, Bürgernähe, organisatorische Vielfalt (keine Einheitsversicherung), Effektivität und Effizienz. Sozialpolitischer Kristallisationspunkt für die Frage nach den richtigen Strukturen ist das Subsidiaritätsprinzip. Mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts bedeutet dies, "dass in erster Linie die kleinere Gemeinschaft wirken soll und mit staatlichen Mitteln erst dann einzugreifen ist, wenn es unausweichlich wird." Kann der Einzelne sich nicht selbst helfen, sollen also zuerst die Familie, die Nachbarschaft, die Selbsthilfegruppe, die freie Wohlfahrtspflege, die Gemeinde und zuletzt die staatliche Institution helfend einspringen (a.a.O., S. 10f).
"Vor allem im Verhältnis von öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege ist die Subsidiarität staatlichen, insbesondere kommunalen Handelns ein zentrales Thema. Die Träger der freien Wohlfahrtspflege machen für ihre soziale Arbeit einen bedingten Vorrang geltend, der auch in Grundnormen des Sozialrechts seinen Niederschlag gefunden hat, zumal freie Träger vielfach als Pioniere neu auftretende soziale Notlagen aufgreifen und in innovativer Weise überwinden helfen
Die Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips wurde bei der Revision des Vertrages der Europäischen Union in Maastricht besonders unterstrichen und als übergreifendes politisches Prinzip für die Abgrenzung von Gemeinschaftszuständigkeit und Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten anerkannt. Aus dem Subsidiaritätsprinzip wird auch der Vorrang nationaler Sozialpolitik abgeleitet ..."(a.a.O., S. 11).
Von einer grundsätzlichen Bedrohung des Subsidiaritätsprinzips als Folge des europäischen Einigungsprozesses kann somit zwar keine Rede sein; vielmehr sieht der Entwurf für einen "Vertrag über eine Verfassung für Europa" eine konsequente Anwendung und Absicherung dieses Verfassungsprinzips ausdrücklich vor (Calliess, 2004, S. 24)[8]. Im Zuge eines Trends zu neoliberaler Wirtschaftspraxis und Gesetzgebung sehen sich jedoch die Verbände, Dienste und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege, organisiert in den Spitzenverbänden
- der Arbeiterwohlfahrt,
- des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland,
- des Deutschen Caritasverbandes,
- des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (seit 1990 "Der Paritätische"),
- des Deutschen Roten Kreuzes und
- der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland
verstärkter Konkurrenz durch selbstorganisierte Gruppen und privat-gewerbliche Träger gegenüber. Fehlentwicklungen zu bürokratisierten Großorganisationen und die immer weniger tragende weltanschauliche Bindungsfähigkeit in dem "an Kleinstaaterei erinnernde[n] Wohlfahrtsverbandswesen"(Boeßenecker, 2001, S. 108) trugen hierzu entscheidend bei.
Inwiefern die weiterhin bestehende nationalstaatliche Privilegierung frei-gemeinnütziger Unternehmen in Deutschland – die sich vor allem in der Freistellung von diversen Steuerpflichten und in steuerlichen Anreizen für Dritte äußert, den frei-gemeinnützigen Trägern Geld-, Sach- und Zeitspenden zukommen zu lassen – mit europäischem Wettbewerbsrecht vereinbar ist (z. B. dem Verbot von Beihilfen), ist derzeit noch unsicher und Gegenstand juristischer Gutachten (Schruth, 2003).
Die Monopolkommission der Bundesregierung (12. Hauptgutachten, zit. nach Wetzler, 2003, S. 15f) verwies jedoch bereits 1998 darauf, dass die Stellung der freien Wohlfahrtspflege im sozialen Versorgungssystem eine Kartellbildung und die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege (BAG FW) ein staatlich unterstütztes Kartell sei, in dem die Koordination der Leistungen abseits der wettbewerblichen Ordnung in einem weitgehend gegen die Konkurrenz abgeschotteten System stattfinde. Die Steuerbefreiung im Zusammenhang mit dem Gemeinnützigkeitsstatus wird in diesem Gutachten als Diskriminierung privat-gewerblicher Anbieter betrachtet.
Das "alte korporatistische Arrangement"(Teuber et al. (2000, S. 10) zwischen Staat und Sozial-verbänden erweist sich zunehmend als Auslaufmodell (Boeßenecker, 2004, S. 32).
1.8 Rechtsgrundlagen und Zuständigkeiten im Überblick
In Deutschland steht die Inanspruchnahme sozialer Dienstleistungen in enger Beziehung zu detaillierten rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Deutsche Bundestag begann 1976 damit, das in eine Vielzahl unterschiedlicher Gesetze und Leistungsträger gegliederte System der sozialen Sicherung in einem Gesamtwerk zu kodifizieren: dem Sozialgesetzbuch. Die folgende Übersicht enthält alle bislang darin eingeordneten Sachgebiete sowie weitere, noch nicht kodifizierte, Gesetze (Quelle: eigene Internet-Recherchen).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.9 Zur Ökonomisierung des Sozialen
Im internationalen Vergleich gilt das deutsche Sozialleistungssystem, seit Gründung der Bundesrepublik als umfassendes und lückenloses Netzwerk geknüpft, als "weder ausgeufert noch herausragend"(Alber, 1998, S. 225), aber auch als relativ unmodern, weil perspektivisch vergangenheits- statt zukunftsorientiert (Schmid, o. J., S. 20f). Die desolate Situation der öffentlichen Haushalte – und hier im Besonderen die der kommunalen[9] – ist unmittelbar verknüpft mit der Strapazierung dieses Netzes durch Wirtschaftskrise, hohe Arbeitslosigkeit und demographische Entwicklung. Die Zusammenhänge mit der aktuellen Debatte über die Grenzen des Sozial- und Wohlfahrtsstaates und dessen notwendiger Modernisierung sind evident.
Dass im Kontext der öffentlichen Haushaltssituation auch die Qualität der mit zunehmend verknappten Mitteln finanzierten Sozialleistungen auf den Prüfstand geriet, entbehrt insofern nicht der sachlichen Logik: Wenn schon nicht mehr alles Wünschbare geleistet werden kann/soll, gilt es, die Mittel dort einzusetzen, wo sie sozialpolitisch treffgenau denen zugute kommen, die ihrer am Nötigsten bedürfen (allokative Effizienz) und im Sinne inhaltlicher Zielerreichung (Effektivität) den größten Nutzen stiften (Trube u. a., 2001, S. 229).
Die dafür notwendigen Entscheidungen bedürfen möglichst rationaler, transparenter und verbindlicher Qualitätskriterien, um fachlich wie politisch legitimiert werden zu können, "... vor allem auch deshalb, weil in allen Sozialgesetzen die Verpflichtung zur Leistungserbringung an die reale Bedürftigkeit und nicht an die Finanzierbarkeit gekoppelt ist"(Teuber et al., 2000, S. 10).
Darüber hinaus werden dem lange Zeit ungehindert expandierenden Sozialleistungssystem Ineffizienzen und erhebliche Rationalisierungsmöglichkeiten unterstellt (z. B. Schoch, 2000, S. 1), die zu beseitigen bzw. zu erschließen professionellere Formen des Managements, insbesondere des Qualitätsmanagements beitragen sollen. Sozialrechtliche Änderungen der letzten Jahre stehen eindeutig in diesem Zusammenhang.
Will man die Entwicklung nachzeichnen, die sich unter dem Stichwort "Ökonomisierung des Sozialen" zusammenfassen lässt, fallen mindestens zwei Begriffe ins Auge: Lean Management und Marktwirtschaft.
Das Konzept des Lean Management stammt aus der japanischen Erfolgswirtschaft der Achtzigerjahre. "Lean" steht symbolisch für alle Maßnahmen, die darauf abzielen, Überflüssiges aus der Betriebsführung zu entfernen und durch "Verschlankung" des Einsatzes von Personal, Sachmitteln, Produktionsflächen, Entwicklungszeiten und anderen Kostenfaktoren wirtschaftlicher zu arbeiten.
Wesentliche Merkmale dieses Konzepts sind:
- Reduktion von Hierarchieebenen/Abflachung von Hierarchien,
- Abbau von „nicht-produktivem“ Personal, Priorität der Wertschöpfung,
- Verlagerung von Autonomie auf kleine Einheiten, Teamarbeit,
- Übertragung von Selbstverantwortlichkeit und Selbstkontrolle im Rahmen von Zielvereinbarungen,
- differenziertes Controlling- und Berichtssystem als Steuerungsinstrument,
- hohe Kunden- und Marktorientierung,
- kontinuierlicher Verbesserungsprozess im Sinne kleiner, beherrschter Schritte.
Ein weiteres Prinzip ist die strikte Orientierung an Qualität als strategischem Erfolgsfaktor im Sinne von erfüllten Kundenerwartungen und möglichst weitgehender Fehlervermeidung. "Schlank“ daran ist, dass Fehler durch sorgfältige Analyse des Leistungsprozesses möglichst erst gar nicht entstehen oder zumindest frühzeitig behoben werden sollen, ausgehend von der Erkenntnis, dass die Folgen eines Fehlers umso kostspieliger sind, je später er entdeckt wird. Statt wie früher erst am Ende diejenigen Produkte auszusondern, die fehlerhaft sind, gilt es nunmehr, bereits während des Leistungsprozesses Vorsorge zu treffen, dass möglichst einwandfreie Produkte entstehen.
Waren für die Verbreitung des Lean Management in der Betriebswirtschaft vor allem die industriellen Erfolge dieses Produktions- und Betriebsführungssystems verantwortlich, so zeichnet sich seit Längerem auch auf der Ebene ganzer Volkswirtschaften ab, dass ein Umdenken im Gange ist. Während die – zumeist sozialdemokratisch geprägten –- Wohlfahrtsstaaten an die Grenzen ihres Wachstums stießen, verkündeten in den USA und Großbritannien so genannte "Monetaristen“ im Gefolge Milton Friedmans eine neue Wirtschaftspolitik, die an die klassische Theorie von der Selbstregulierung einer Wirtschaft anknüpft und dem Staat nur ein sehr begrenztes Eingriffsrecht in die wirtschaftlichen Abläufe zugesteht. Diese Wirtschaftspolitik wurde in Anlehnung an ihre bedeutendsten politischen Protagonisten alsbald unter den Bezeichnungen "Reagonomics“ und "Thatcherism“ bekannt und propagiert eine am Modell der freien Marktwirtschaft orientierte Sozialpolitik.
Es wird von den Vertretern dieses so genannten neoklassischen oder neoliberalen Denkens angenommen, dass der Sozialstaat bisheriger Prägung teuer und dabei verhältnismäßig ineffektiv sei. Von der Einführung marktwirtschaftlicher Elemente wie Privatisierung, Deregulierung und Wettbewerb auf Seiten der Anbieter verspricht man sich mehr Effizienz und Qualität.
Diese Sichtweise, die auf der Übertragung marktökonomisch durchaus erfolgreicher Prinzipien auf menschliches Verhalten im Allgemeinen beruht, ist stark inspiriert vom klassischen Liberalismus und Rationalismus, also von Weltanschauungen, die auf die individuelle Freiheit vernunftorientierter Bürger setzen. Die ausufernde Euro-Bürokratie und verkrustete Strukturen des Wohlfahrtsstaates haben mit einigungsbedingter Verspätung inzwischen auch in Deutschland die politische Großwetterlage in diesem neoliberalen Sinne bestimmt (s. "Agenda 2010"), allerdings auch heftige Kritik an einer zu weit gehenden Ökonomisierung des Sozialen hervorgerufen.
Nach Schmidt-Grunert (1997, S. 113) besteht ein offensichtlicher Zusammenhang zwischen der seinerzeitigen Expansion des sozialen Sektors und dem Wachstum von Armut und Verelendung in der Gesellschaft. Die zunehmend geforderte Rolle als Ausfallbürge für ein Versagen von Wirtschaft und Politik ist auch für Prölß (1999, S. 106) der Grund für den beschleunigten Professionalisierungsschub der sozialen Berufe seit den Siebziger Jahren.
Die im Gefolge der öffentlichen Haushaltskrise inzwischen betriebene staatliche Sparpolitik hält Schmidt-Grunert deshalb mitnichten einem überproportionalen Wachstum des sozialen Bereichs, "funktionalem Dilettantismus“ oder Verschwendung geschuldet, sondern diese wird als Ausdruck eines politischen Willens bewertet, staatliche Leistungen abzubauen (a.a.O., S. 109ff.). Während in der Tradition der Sozialen Arbeit stets die Auffassung vertreten worden sei, dass der soziale Sektor seiner Kompensationsaufgabe nur gerecht werden könne, wenn er nicht den Zwängen der freien Marktwirtschaft unterworfen sei, werde die Ökonomie nunmehr mit Hoffnungen belegt, "aus weniger mehr“ zu machen (a.a.O., S. 115).
Dass die Ökonomie jedoch ein falscher Hoffnungsträger sei, wird an drei Einwänden erläutert (a.a.O., S.117ff.):
1. Das Wachstum des sozialen Sektors korrespondiere mit florierendem Wirtschaftswachstum; Methoden, welche für das Ansteigen gesellschaftlicher Armut verantwortlich seien, könnten nicht gleichermaßen erfolgreich in deren Bekämpfung sein.
2. Ungeachtet möglicher Rationalisierungseffekte durch verschlankte Sozialbürokratie sei eine Sparstrategie im Sozialbereich etwas anderes als das, was in der Ökonomie unter Wirtschaftlichkeit verstanden werde. Während dort nämlich das Rentabilitätsprinzip gelte, sei es der Sozialen Arbeit bislang wesensfremd, Gewinne machen zu sollen oder zu können.
3. Staatliche Ausgaben für den sozialen Sektor müssten als Konsumtionskosten betrachtet werden, die zur Funktionalität des gesellschaftlichen Zusammenhangs notwendig aufzubringen seien.
Ohne die Diskussion an dieser Stelle zu vertiefen, drängt sich der Eindruck auf, als entspreche die Befrachtung der Ökonomie mit überzogenen Heilserwartungen mehr dem menschlichen Bedürfnis nach eindeutigen "Auswegen“ aus der Krise als gründlicher sozialpolitischer und sozioökonomischer Analyse. Hinzu kommt, dass die Krise der einen gesellschaftlichen Gruppierung stets auch mit Chancen für andere verbunden ist. Partikularinteressen kommen ins Spiel, die es noch schwerer machen, zwischen glaubwürdigem Bemühen um sachgerechte Lösungen und kurzsichtigem Gruppenegoismus zu differenzieren.
„Krisenbeschreibungen und -beschwörungen gehören ... zu den Grundfigurationen der modernen Gesellschaftstheorie, die ja auch (fast) immer Theorie der Gesellschaftsreform sein will. Die – selbstverständlich – wissenschaftliche Analyse der Krise geht einher mit einem Lösungsangebot, dem Aufzeigen eines Ausweges, dem Versprechen einer umfassenden Bewältigung und damit auch Beendigung der Krise. Die Einlösung des Versprechens ist freilich mit einem entscheidenden Akteurwechsel verbunden: Damit es zur (Er-)Lösung kommt, ist die strenge, ‘orthodoxe’, ‘methodische’ Befolgung des von den einen (der Avantgarde) gewiesenen Weges seitens der jeweils ‘anderen’ ... unbedingt notwendig; diese dürfen bzw. müssen dazu allerdings meist erst noch befähigt, sprich: erzogen werden“(Volz, 2000, S. 169).
Vieles spricht dafür, dass sich die Geschichte derartiger gesellschaftlicher Grundfigurationen auch gegenwärtig wiederholt. Ein markantes Beispiel hierfür liefert auch die angestrebte Modernisierung der öffentlichen Verwaltung.
1.10 Zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung
Anfang der Neunzigerjahre begann das betriebswirtschaftliche Modell des Unternehmens die traditionelle Sichtweise öffentlicher Verwaltungen und ihrer Organisationsformen abzulösen. Das Neue Steuerungsmodell (NSM), namentlich propagiert von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt), der Innovationsagentur des Deutschen Städte- und Gemeindetages (B. Müller, 1996b, S. 8), begann seinen programmatischen Siegeszug durch die deutschen Amtsstuben.
Das zentrale Motiv der Diskussionen um die Umstrukturierung der öffentlichen Verwaltungen "von der Behörde zum Dienstleistungsunternehmen" war bzw. ist die Hoffnung, die Handlungsfähigkeit des kommunalen Systems angesichts stagnierender oder rückläufiger Finanzmittel zu erhalten. Die Kritik richtete sich dabei insbesondere gegen die zentralen Organisationsstrukturen der Verwaltung, die großen Macht- und Entscheidungsbefugnisse der Querschnittsämter, die Orientierung am Input, ein veraltetes Finanzmanagementsystem und schwach ausgebildete Leistungsanreize im Vergütungssystem des öffentlichen Dienstes (Struck, 1995, S. 285).
Den Kommunalverwaltungen wurde eine Strategie-, Management-, Attraktivitäts- und Legitimitätslücke attestiert. Defizite wurden in der Zielorientierung, der effektiven Steuerung, der Motivierung von Mitarbeiter(inne)n und der Rechtfertigung der Leistungen gegenüber den Bürgern ausgemacht (vgl. KGSt, 1993).
Als charakteristisch für die traditionelle Steuerung öffentlicher Verwaltungen gilt die Inputorientierung. Dabei wurde/wird der Verwaltung seitens der Politik ein Input in Form von Sach-, Finanz- und Personalmitteln zur Verfügung gestellt, ohne dass hinreichend deutlich war/ist, welche Leistungen im Einzelnen damit erbracht werden sollen. Demgegenüber betont das Konzept der Outputsteuerung, dass der gesamte Prozess von Planung, Durchführung und Kontrolle des Verwaltungshandelns strikt an den beabsichtigten und tatsächlichen Ergebnissen des Handelns ausgerichtet werden soll (Jordan/Reisman, 1998, S. 60).
Die beschriebenen Probleme sollten durch Anleihen beim Konzept des Lean Management (s. Kap. 1.9) gelöst werden. Die wichtigsten Elemente dieses "Neuen Steuerungsmodells“ (auch als "New Public Management“ diskutiert) sind (vgl. Struck, 1995; Kühn, 1995; Jordan/Reisman, 1998; Dahme et al., 2004):
- die Übertragung betriebswirtschaftlicher Managementtechniken auf dafür geeignete Teile der Kommunalverwaltung (Konzernmodell: Leitbild Dienstleistungsunternehmen),
- ein verändertes Verhältnis von Politik und Verwaltung (hier Zuständigkeit für strategische Planung und Kontrolle längerfristiger Richtungsentscheidungen, dort operative Umsetzung und Controlling der politischen Leitwerte, Steuerung mittels Kontraktmanagement),
- die grundlegende Orientierung am Output der Verwaltung, d. h. ihren in Produktbeschreibungen zu definierenden Leistungen und den zuzuordnenden Kosten (Budgetierung als Teil des Kontraktmanagements zur Absteckung des Ressourcenrahmens, innerhalb dessen flexibler als bisher agiert werden kann),
- die Zusammenführung von Leistungs- und Budgetverantwortung auf der Basis der Selbststeuerung von Ämtern und Diensten sowie eine veränderte Darstellungsform kommunaler Haushalte (dezentrale Ressourcenverantwortung, Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens statt der bisherigen Kameralistik),
- die Einführung eines systematischen Controllings (strategisches und operatives, zentrales und dezentrales Steuerungsinstrument durch rechtzeitige Informationsbeschaffung und -verarbeitung, z. B. über Kennzahlen),
- das Postulat der Orientierung an den Bedürfnissen der Abnehmer der kommunalen Dienstleistungen (Kundenorientierung),
- die systematische Einführung von Markt- und Wettbewerbselementen in die Verwaltungsorganisation (Personalmanagement, Qualitätsmanagement, Benchmarking),
- die angestrebte Trennung von Gewährleistungs- und Durchführungsverantwortung[1] mit der konsequenten Beauftragung Dritter durch die Verwaltung (Contracting out).
Diese Reformziele und -maßnahmen stellen aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht weniger ein neues Konzept, sondern eher ein ideales Gegenbild zu den tatsächlichen oder vermuteten Defiziten der herkömmlichen Verwaltungs- und Steuerungspraxis dar (Jann, 1998, S. 72). Dennoch wurde am Ansatz der KGSt bzw. an den befürchteten und eingetretenen Auswirkungen der sozialwirtschaftlichen Modernisierung vielfach Kritik geübt (z. B. Dahme et al., 2004; zusammenfassend Galiläer, 2005, S. 116ff.).
Unter anderem werden die Selektivität des Dienstleistungsangebots ("Rosinenpickerei") bei privat-gewerblichen Trägern, die Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse, eine Gefährdung gewachsener Partnerschaften zwischen öffentlichen und freien Trägern sowie allgemein eine Verbetriebswirtschaftlichung der Sozialen Arbeit und die Missbrauchsmöglichkeit von Instrumenten und Kennzahlen thematisiert.
Andere Autoren betonen dagegen die Chancen, verkrustete Strukturen und Besitzstandsdynamik des deutschen Wohlfahrtsverbändekorporatismus aufzubrechen und Angebotsformen kritisch zu revidieren (z. B. Boeßenecker, 2004).
Das ursprüngliche Vorbild des NSM, die Verwaltungsmodernisierung der niederländischen Stadt Tilburg ("Tilburger Modell“), gilt inzwischen im eigenen Land hinsichtlich der erhofften Einsparpotenziale als gescheitert; auch in Deutschland greift zunehmende Ernüchterung um sich (Boeßenecker, 2001, S. 104). So verweist zwar Reichard (2001, S. 21) auf gelegentliche Kostensenkungseffekte, beschleunigte Verfahren, Ausweitung von Öffnungszeiten und weitere Dienstleistungsverbesserungen, benennt jedoch auch negative Auswirkungen (z. B. das Auseinanderdriften von Fachbereichen, schleichenden Demokratieverlust, Vernachlässigung von Gemeinwohlaspekten) und resümiert ebenfalls: "Insgesamt ist die Wirkungsbilanz eher ernüchternd"(a.a.O.).
Angesichts des von vielen Autoren konstatierten "Reformstaus" bei der Umsetzung des NSM und der bisherigen Schwerpunktsetzung im Bereich des Finanzmanagements (vgl. Reichard, a.a.O., S. 20) werden Erinnerungen an frühere Bestrebungen wach, die Qualität der Sozialadministration zu verbessern.
Auch der in den Siebziger- und Achtzigerjahren unternommene Versuch einer "Neuordnung der sozialen Dienste“ im Zuge der kommunalen Gebietsreformen erfolgte in gut gemeinter Absicht ohne durchschlagenden Erfolg. Trotz zum Teil drastischer Veränderungen innerhalb des organisatorischen Gefüges blieben die beabsichtigten Effekte einer innovatorischen Praxis aus. Die seinerzeit stattgefundenen Verwaltungsreformen können jedoch als eine notwendige Voraussetzung für modernisierte Soziale Arbeit angesehen werden, wie sie im Zuge der Neuen Steuerungsmodelle nun vor allem über ein verbessertes Personalmanagement erreicht werden soll (Flösser/Otto, 1992, S. 10ff.).
Hinsichtlich des Tempos, in dem die Eckpunkte einer Sozialreform "von unten"(Berner & Leisering, 2003) umgesetzt werden, lassen sich gewaltige Unterschiede zwischen Kommunen und Regionen konstatieren. "Städte unternehmen in der Regel mehr als Landkreise und Delegationsgemeinden, alte Bundesländer mehr als neue und südliche mehr als nördliche"(a.a.O., Internetversion S. 13).
Diese – auf die Einführung neuer Wissenssysteme in der kommunalen Sozialhilfeverwaltung bezogene – Formulierung kann mutatis mutandis auch auf den Umsetzungsstand von Qualitätsmanagement in der öffentlichen Jugend- und Sozialhilfe gewendet werden (Gerull, 2005). Freie Träger sind in dieser Hinsicht öffentlichen Trägern um Längen voraus. (Die Zweckmäßigkeit und nachhaltig positive Wirkung entsprechender Maßnahmen ist damit allerdings noch nicht präjudiziert!)
2. Qualitätsmanagement als interdisziplinäres Konzept
2.1 Qualitätsspezifische Grundlagen im Überblick
2.1.1 Kurze Geschichte der Qualität und ihres Managements
Die Beschäftigung mit Qualität ist uralt. Gesetzlich vorgeschriebene Anforderungen an Bauwerke etwa sind schon aus babylonischen Zeiten überliefert (Codex Hammurabi); im Mittelalter spielte der Qualitätsgedanke in den Regeln und Normen der Zünfte eine zentrale Rolle (Seghezzi, 1996, S. 5). Amtliche Beschauzeichen bestätigten die Güte geprüfter Produkte, Meisterzeichen identifizierten den Hersteller. Aus ihnen entwickelten sich mit zunehmender Industrialisierung die Fabrik- und Qualitätsmarken (Wolters, Albrecht & Schwabe, 1995, S. 5).
Die Herkunftskennzeichnung für Produkte, wie sie ein britisches Gesetz von 1887 aus protektionistischen Gründen vorschrieb, wandelte sich als "Made in Germany" vom Brandmal zum ausgesprochenen Qualitätsbegriff. Da die internationale Konkurrenz aufholte, verlor dieses ungewollt zum Gütesiegel gewordene Zeichen später einen erheblichen Teil seiner Wirkung. Es bedurfte neuer Methoden und Etikettierungen, um Qualität als kaufentscheidungsrelevantes Produktmerkmal zu entwickeln und nachzuweisen.
KundInnen wollen von einem Produkt in erster Linie einen Nutzen haben; sie wünschen sich jedoch auch einen angemessenen Preis und eine gute Verfügbarkeit in benötigter Menge, indem es z. B. zum gewünschten Zeitpunkt auf einfache Art beschafft werden kann (Seghezzi, 1994, S. 11). Um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, müssen Anbieter von Produkten die Qualität, Kosten und Lieferbereitschaft bezüglich Menge und Termin optimal gestalten. In diesem unternehmerischen Spannungsviereck (Seghezzi, 2003, S. 20) aus Qualität, Geld, Quantität und Zeit sind die einzelnen Faktoren ständig gegeneinander abzuwägen, um den besten Erfolg zu erzielen.
Bis Anfang des 20. Jahrhunderts lag die innerbetriebliche Verantwortung hierfür in einer Hand. Mit Einführung der industriellen Arbeitsteilung, wie sie vor allem mit dem Namen des Amerikaners Frederick W. Taylor und dem von ihm begründeten scientific management ("Taylorismus") verbunden ist, wurde diese Verantwortung aufgespalten.
"Überspitzt ausgedrückt wurde die Arbeitsvorbereitung für die Kosten, die Fertigung für die Zeiten und die Qualitätskontrolle für die Qualität verantwortlich gemacht. Dadurch entwickelte sich in den Fertigungsabteilungen eine Art ‘Schmugglermentalität’. Es kam nicht mehr darauf an, fehlerfreie Produkte zu fertigen, sondern ‘durch die Kontrolle zu kommen’. Gleichzeitig führte dies zu einer Vielzahl von Qualitätsprüfern. In vielen Betrieben waren mehr als 10% der Belegschaft in der Qualitätsprüfung beschäftigt"(Seghezzi, 1996, S. 5). Entsprach ein fertiges Produkt nicht den Anforderungen, wurde es aussortiert oder nachbearbeitet.
Spätestens seit den Sechzigerjahren steht nicht mehr diese Endkontrolle des Produkts im Mittelpunkt der Qualitätskontrolle. Solche Prüfungen erhöhen nämlich nicht die Qualität, sondern dienen nur zur Trennung von "gut" und "schlecht"(Daumenlang & Palm, 1997, S. 356). Da Fehler sich umso kostspieliger auswirken, je später sie im Produktionsprozess auftreten oder auffallen, sind Endkontrollen letztlich teurer als Fehler vermeidende Maßnahmen (Wolters et al., 1995, S. 16). Aufgrund dieser Erkenntnis geriet zunehmend die vorbeugende Gestaltung und ständige Verbesserung der betrieblichen Prozesse ins Blickfeld, um möglichst gar keine Qualitätsfehler entstehen zu lassen und Qualität optimal zu bewirtschaften. Dabei veränderten sich auch die Rollen der MitarbeiterInnen, des Managements und der KundInnen, deren Einbeziehung in die Leistungserstellung zunehmend umfassender geriet.
Ein solches Qualitätsmanagement – lange Zeit unter Bezeichnungen wie Qualitätskontrolle oder Qualitätssicherung firmierend – entstand in der Praxis auf pragmatische Art (Seghezzi, 1994, S. 11); seine Umsetzung in theoretische Konzepte und die Gestaltung als eigene Disziplin im Rahmen der Unternehmensführung entwickelten sich erst viel später. In Europa wurde Qualität zwar traditionell groß geschrieben, jedoch nicht im eigentlichen Sinne systematisch bewirtschaftet wie die übrigen Faktoren des unternehmerischen Spannungsvierecks im Rahmen von Logistik, Materialwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen (a.a.O., S. 12). Es verwundert daher nicht, dass diese Entwicklung sich in Ländern vollzog, die keine lange Tradition mit hoher Produktqualität haben, nämlich in Japan und in den USA (a.a.O., S. 2).
Eine Rolle für die seither nicht mehr nachlassende Aktualität des Qualitätsthemas in der Wirtschaft spielt die empirisch gesicherte Erkenntnis, dass zwischen der Qualität von Produkten bzw. Dienstleistungen und dem wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen ein positiver Zusammenhang besteht; Qualität ist ein entscheidender Erfolgsfaktor (Eversheim, 1997, S. 4 ff.). Dementsprechend wird der Frage zunehmende Bedeutung beigemessen: Wie kann eine Organisation/ein Projekt/ein Prozess/ein Produkt oder – um die Terminologie der internationalen Normungsbehörde ISO aufzugreifen – eine Einheit so gesteuert werden, dass Qualität systematisch optimiert wird und keine "Glückssache" ist (Gerull (Hrsg.), 2000, S. 1:9). Qualitätsmanagement ist jener Teil der Gesamtführungsaufgabe, der dieser Frage gewidmet ist und Antworten in Form von Konzepten und Werkzeugen zu geben verspricht, die sich u. a. in den Bereichen Marketing, Organisation und Psychologie bewährt haben; Qualitätsmanagement "erfindet" das Qualitätsthema nicht neu, sondern "bringt es auf den Punkt"(Bretzke, 1995, S. 424).
Mit zunehmender Globalisierung der Märkte wurde es wichtig, einheitliche Anforderungen an Qualitätssysteme zu formulieren, die weltweit Akzeptanz finden (Seghezzi, 1996, S. 204). Diese Entwicklung wurde durch die hohen Qualitätsforderungen im militärischen Bereich und in der Luft- und Raumfahrt nachhaltig beeinflusst. Die aus den Forderungen der militärischen Beschaffungsstellen entstandenen Systeme bildeten den Ursprung der späteren DIN EN ISO 9000-Normenfamilie (s. Kap. 4.4.1.1).
Mit der Normenreihe ISO 9000 ff. wurden erstmals Unternehmensführungssysteme in Normen aufgenommen, während diese sich zuvor auf Maße, technische Eigenschaften und ähnliche Sachverhalte beschränkten (Seghezzi, 1996, S. 205). Inzwischen sind eine Vielzahl von branchenübergreifenden oder branchenspezifischen, mehr oder minder umfassenden, originären oder adaptierten Systemen und Verfahren auf dem Markt, die mit oder ohne Möglichkeit zur Zertifizierung, intern oder extern ausgerichtet, mit diagnostischer oder Prozesse auslösender Fokussierung, in Selbstführung oder mit externer Begleitung implementiert werden können. Sie werden in diesem Buch systematisiert und teilweise ausführlicher erörtert.
2.1.2 Qualität
Qualitätsmanagement setzt eine Vorstellung von Qualität voraus, auch wenn diese nicht immer explizit formuliert sein muss. Es ist deshalb zweckmäßig, zunächst solche Vorstellungen zu untersuchen.
Qualität kann allgemein definiert werden als die Beschaffenheit eines Produkts, einer Dienstleistung, eines Unternehmens oder einer anderen Einheit (s. u.), gemessen an den Bedürfnissen der Anspruchsgruppen (Seghezzi, 1996, S. 17). Damit sind alle an dem Produkt interessierten bzw. davon betroffenen Personen (auch stakeholder genannt) gemeint, vor allem die KundInnen.
Qualität lässt sich aber nicht nur neutral als Beschaffenheit einer Einheit im Hinblick auf gestellte Anforderungen definieren, sondern wird häufig auch wertend als Güte im Sinne von Zweckerfüllung verstanden. Einem solchen Verständnis von Qualität folgend, kann man unterschiedliche Anspruchsklassen bilden, wie etwa die Sterne-Kategorisierung im Hotelbereich. Dabei wird festgelegt, welche Eigenschaften jeweils zu erfüllen sind, um einer bestimmten Qualitätsklasse oder -stufe zugeordnet werden zu können. Beschaffenheit und Anspruchsklasse sind Kernbegriffe modernen Qualitätsmanagements (Zollondz, 2002, S. 145).
Definitionen von Qualität – eine Auswahl
- Qualität ist die Beschaffenheit (eines Produkts), gemessen an den Bedürfnissen der Anspruchsgruppen (Seghezzi, 1996).
- Qualität ist die Relation zwischen einem Ist-Zustand und einer Soll-Forderung (Daumenlang & Palm, 1997).
- Qualität ist die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen eines Produkts oder einer Tätigkeit, die sich auf deren Eignung zur Erfüllung gegebener Erfordernisse beziehen (DIN 55 350).
- Qualität ist der Übereinstimmungsgrad zwischen versprochener und erbrachter Leistung (versch.).
- Qualität: Beschaffenheit, Güte oder Wert einer Sache oder Dienstleistung (Kommerell, 2000).
- Qualität ist realisierte Beschaffenheit einer Einheit bezüglich Qualitätsforderung an diese (Geiger, 1998).
- Qualität: Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale (An)forderungen erfüllt (ISO 9000:2000).
Von allen Versuchen, den Qualitätsbegriff so allgemein wie möglich zu bestimmen, ist die konzept- und branchenneutrale Definition der ISO 9000:2000 die einzige international normierte; sie entspricht inhaltlich voll derjenigen von Geiger (siehe Kasten), ist sprachlich allerdings so abstrakt formuliert, dass die ISO, die internationale Normungsbehörde, es für nötig hielt, der Definition zwei Anmerkungen hinzuzufügen:
- Qualität: Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale (An)forderungen erfüllt (ISO 9000:2000)
Anmerkung 1:
Die Benennung "Qualität" kann zusammen mit Adjektiven wie schlecht, gut oder ausgezeichnet verwendet werden.
Anmerkung 2:
"Inhärent" bedeutet im Gegensatz zu "zugeordnet" "einer Einheit innewohnend", insbesondere als ständiges Merkmal.
Mit Einheit ist dabei der Bezugspunkt für die Qualitätsbetrachtung gemeint, also das, was einzeln beschrieben und betrachtet werden kann: das Ergebnis einer Tätigkeit, diese Tätigkeit selbst, eine Person, ein System oder eine Kombination daraus (Geiger, 1998, zit. nach Zollondz, 2002, S. 155).
Von Bedeutung ist diese Definition nicht allein deshalb, weil sie international abgestimmt ist und damit als Grundlage verschiedenster Qualitätsmanagement-Konzepte dienen kann, sondern auch, weil sie die Brücke von einer nur produktbezogenen Qualitätsbetrachtung zum umfassenden Qualitätsverständnis des Total Quality Management schlägt (s. Kap. 4.4.1.2). Da Einheiten beliebig gewählt und kombiniert werden können, sind alle denkbaren zusätzlichen Einheiten möglich (Zollondz, 2002, S. 158). Während die "inhärenten" Merkmale der Einheit für die Qualität des Angebotsprodukts (z. B. Pflege bei Dekubitus) direkt maßgeblich sind, also unmittelbaren Qualitätsbezug aufweisen (z. B. die fachlich einwandfreie einzelne Pflegehandlung), lassen sich einem Vorschlag von Geiger entsprechend "zugeordnete" Einheiten mit mittelbarem Qualitätsbezug (z. B. die Freundlichkeit der Krankenschwester) sowie ohne direkten Qualitätsbezug zum Angebotsprodukt (z. B. das Image des Krankenhauses) unterscheiden (Zollondz, 2002, S. 158; Beispiele P. G.).
Der erweiterte Qualitätsbegriff im TQM wäre somit wie folgt zu definieren:
- "Im TQM ist Qualität die realisierte Beschaffenheit von Einheiten mit unmittelbarem, mittelbarem und keinem direkten Qualitätsbezug bezüglich Qualitätsforderung und anderer Forderungen an diese Einheit"(Zollondz, a.a.O.).
2.1.3 Qualitätsmodelle
Modelle sind "analoge Realitätsausschnitte"(Schlottke, 1998, S. 543f) zum Zwecke der Veranschaulichung oder Ableitung damit zusammenhängender Fragestellungen (Drever & Fröhlich, 1968, S. 152). Diesem Zweck dienen auch Qualitätsmodelle. Sie setzen zumeist einen Begriff von Qualität voraus, ohne ihn immer zu explizieren. Zollondz (2002, S. 163ff.; 2001, S. 589ff.) beschreibt eine Auswahl allgemeiner und spezieller Qualitätsmodelle, die nachstehend in Grundzügen aufgeführt, kurz kommentiert und um Bemerkungen zu weiteren Modellen ergänzt werden:
- Qualitätskreis-Modell von Masing (1990, nach Zollondz, 2002, S. 164ff.):
Dieses Modell war Gegenstand der inzwischen nicht mehr gültigen Empfehlungsnorm ISO 9004:1994. Ausgehend von den Kundenforderungen, sind den Phasen der Planung, Realisierung und Nutzung von Produkten verschiedene Unternehmensfunktionen wie Marktforschung, Beschaffung, Fertigung, Prüfung usw. zugeordnet. In jeder Phase müssen die Verantwortlichen qualitätssichernde Maßnahmen treffen. Als logische Folge der Qualitätsarbeit aller Beteiligten ergibt sich das Qualitätsprodukt. Das Modell lässt sich ohne weiteres auf standardisierbare Dienstleistungen übertragen, stößt aber bei interaktiven Leistungsprozessen rasch an Grenzen.
- Qualitätsregelkreis-Modell von Pfeifer (1996, nach Zollondz, 2002, S. 167ff.):
Es handelt sich um eine auf Qualität bezogene Anwendung des kybernetischen Modells mit den Elementen Regelgröße (hier: Qualität), Störgröße (z. B. ungeplante Einwirkungen), Stellgröße (z. B. durchgeführte Maßnahme), Sollgröße (hier: Qualitätsforderung), Regelstrecke (z. B. Prozess) und Regler (z. B. Qualitätstechnik). Das Modell ist stark von ingenieurwissenschaftlichem Denken geprägt und stößt seines technischen Charakters wegen im Sozialbereich auf Vorbehalte.
- Qualitäts-Termin-Kosten-Kreis von Geiger (1998, nach Zollondz, 2002, S. 170ff.):
Das Modell geht über die Qualitätsbezogenheit des Qualitätskreises (s. o.) hinaus und beschreibt das Zusammenwirken der Aspekte Zeit, Qualität und Kosten. Dem Modell wird ein universeller Charakter im Managementdenken zugeschrieben, weil es die Parallelität der jeweiligen Tätigkeiten betont. Daraus lässt sich ableiten, dass ein Qualitätsmanagement nicht – wie z. B. eine Vertriebsabteilung – einer eigenen Aufbauorganisation bedarf, sondern eine integrale Funktion darstellt. Die Grundgedanken des Modells finden sich bereits in dem in Kap. 2.1.1 erwähnten unternehmerischen Spannungsviereck wieder und spielen vor allem im Konzept des Integrierten Qualitätsmanagements (Seghezzi, 1994, 1996, 2003) eine zentrale Rolle (s. Kap. 4.4.1.5). Im sozialen Dienstleistungsbereich ist es erst vereinzelt aufgegriffen worden, obwohl es grundsätzlich geeignet erscheint.
- Wertschöpfungsanalyse von Weth (nach Zollondz, 2002, S. 173ff.):
Wertschöpfung entsteht aus der Differenz zwischen dem Wert eines Produkts vor und nach der Verarbeitung. Dabei spielt Verschwendung eine entscheidende Rolle. Die Wertschöpfungsanalyse prüft, welchen Beitrag die jeweiligen Prozesselemente zur Wertschöpfung beitragen. Das Modell wurde von Weth auf das Qualitätsmanagement übertragen. Die Relevanz für soziale Dienstleistungen ist fraglich.
- Partialanalytisches Qualitätsmodell von Garvin (1984, nach Zollondz, 2001, S. 589f):
Das für die Diskussion der Dienstleistungsqualität sehr einflussreich gewordene Modell differenziert nach folgenden Qualitätsansätzen: absolute (transcendent) Qualität, Qualität des Produkts (product-based), Qualität für den Kunden (user-based), Qualität der Herstellung (manufacturing-based) und Qualität als Wert (value-based). Im Sozialbereich werden analoge Bezugsgrößen u. a. als sozialtechnologischer, expertokratischer und adressatenorientierter Qualitätsansatz diskutiert (Piel, 1996). Keiner wird allein der Komplexität sozialer Dienstleistungen gerecht.
- Dienstleistungsqualitätsmodell von Donabedian (1966, nach Zollondz, 2002, S. 147ff.):
Das ursprünglich auf medizinische Pflegeleistungen bezogene Qualitätsmodell unterscheidet drei Dimensionen: Strukturqualität (structure), Prozessqualität (process) und Ergebnisqualität (outcome). Structure umfasst vor allem die zur Dienstleistungserstellung notwendigen fachlichen, personellen und sächlichen Ressourcen; process bezeichnet die Gesamtheit der Aktivitäten im Verlauf der Dienstleistungserbringung; outcome steht für eine Änderung des Patientenzustandes, sofern diese sich auf die erbrachte Leistung zurückführen lässt (Meyer & Westerbarkey, 1995, S. 86). Das Modell wurde, ausgehend vom Pflegebereich, in weiten Teilen der deutschen Sozialarbeit übernommen, obwohl es die Rolle der AdressatInnen nicht explizit berücksichtigt (s. Kap. 3.3.2).
- Dienstleistungsqualitätsmodell von Grönroos (1984, nach Zollondz, 2002, S. 174ff.):
Das kundenorientierte Qualitätsmodell geht von einem abwägenden Beurteilungsprozess beim Nachfrager (Kunde, Adressat usw.) aus, in welchem dieser seine Erwartungen an das Dienstleistungsergebnis (Soll-Wert) mit der tatsächlichen Leistung (Ist-Wert) vergleicht (Meyer & Westerbarkey, 1995, S. 86). Unterschieden wird eine eher objektiv zu bestimmende technische Qualität ("Was" erhält der Nachfrager?) und eine eher subjektiv wahrgenommene funktionale Qualität ("Wie" wird dem Nachfrager die technische Qualität dargeboten?); für das Gesamtqualitätsurteil bzw. die Zufriedenheit des Kunden wird die funktionale Qualität für bedeutsamer gehalten. Der Ansatz dürfte im Sozialbereich als zu "konsumeristisch" auf Vorbehalte stoßen.
- Dienstleistungsqualitätsmodell von Meyer & Mattmüller (1987, nach Zollondz, 2002, S. 176ff.):
Das Modell erweitert das Qualitätsmodell von Donabedian und verbindet es mit dem zuvor beschriebenen kundenorientierten Ansatz von Grönroos. Unterschieden werden die Dimensionen der Potenzialqualität des Anbieters und des Nachfragers, der Prozess- und Ergebnisqualität. Bei der Potenzialqualität des Anbieters wird zwischen dem Spezifizierungspotenzial (individuelle und spezifizierte Problemlösungen) und dem Kontaktpotenzial differenziert; die Potenzialqualität des Nachfragers wird in Integrations- und Interaktivitätspotenziale unterteilt (Einbringungsbereitschaft und Auswirkungen von Kundenkontakten untereinander, s. Kap. 3.3.3). Das Modell wird im Sozialbereich trotz seiner Vorteile gegenüber dem Donabedian- Modell kaum verwendet.
- Dienstleistungsqualitätsmodell von Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985, nach Zollondz, 2002, S. 178ff.):
Dieses, in der deutschen Fachliteratur breit rezipierte, Modell der Servicequalität wurde im Rahmen empirischer Studien entwickelt und benennt fünf Gruppen von Merkmalen, welche die Qualität von Dienstleistungen bestimmen: Annehmlichkeiten des tangiblen Umfeldes, Verlässlichkeit der Leistungsausführung, Reagibilität bei Problemen, Leistungskompetenz und Einfühlungsvermögen. Messinstrument für diese Merkmale ist ein spezieller Fragebogen ("ServQual", Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1992). Im Sozialbereich stößt eine direkte Übertragung des Modells an Grenzen, für die auch das "Hilfe-Kontrolle-Dilemma" verantwortlich ist (vgl. Meinhold & Matul, 2003, S. 41f).
Zollondz (2002, S. 183) resümiert, dass keines dieser Qualitätsmodelle völlig befriedigen könne, vor allem im Hinblick auf soziale Dienstleistungen. In der sozialen, pädagogischen und pflegerischen Praxis hat sich dessen ungeachtet das Modell von Donabedian als geläufigstes Gliederungssystem (z. B. für Leistungsbeschreibungen) durchgesetzt. Vereinzelt wird auch das Modell von Meyer & Mattmüller verwendet (Lemme & Ochs, 1998; Gerull, 2004) oder unter Einbeziehung zusätzlicher bzw. anders benannter Dimensionen (Heiner, 1996; von Spiegel, 1994; Trube et al., 2001) zu einem eklektischen Qualitätsmodell sozialer Dienstleistungen integriert (Gerull, 2004, Kap. 1.4.6.3).
Ein von Zollondz (2001, 2002) nicht berücksichtigtes Qualitätsmodell, das nach Nerdinger (1994, S. 206ff.) einen völlig neuen Gedanken in die Diskussion einbringt, stammt von Klaus (1991), der Qualität als Epiphänomen der Interaktion zwischen Dienstleister und Bedientem im Sinne einer gemeinsam geteilten Erfahrung der Zielerfüllung versteht. Diese Qualität könne nicht direkt gestaltet und kontrolliert werden, wohl aber Elemente der "Konfiguration"(Klaus, a.a.O., S. 259).
Wie Klaus (a.a.O., S. 261f) empirisch bestätigen konnte, entsteht "gute" Bedienungsqualität aus dem kumulativen Zusammentreffen von drei Aspekten: Kongruenz der wechselseitig aufeinander bezogenen Verhaltensweisen der Interaktionspartner (z. B. Beachtung von Umgangsnormen), Grad an sachlicher Aufgabenerfüllung, der erzielt und von den Interaktionspartnern wahrgenommen wird (Erreichen des Sachzwecks der Interaktion) und Grad an emotionaler Zufriedenheit, der von den Interaktionspartnern empfunden wird (z. B. Gefühl der Einbeziehung).
Von den in diesem Kapitel kurz dargestellten Qualitätsmodellen scheinen jene von Klaus und Meyer-Mattmüller am besten geeignet, den Charakteristika sozialer Dienstleistungen gerecht zu werden. Anstatt Qualität einseitig aus der Zufriedenheit der "Bedienten" abzuleiten – unter dem Stichwort Konsumerismus ein auch in Psychotherapie und Sozialarbeit viel diskutiertes Thema (z. B. Piel, 1996; Fourali, 1999) –, oder sie "expertokratisch" definieren zu lassen, wird Qualität bei Klaus als Merkmal einer gemeinsam geteilten Erfahrung beider Interaktionspartner betrachtet, während Meyer & Mattmüller den notwendigen Eigenbeitrag der "KundInnen" über die Potenzialqualität der Nachfrager thematisieren.
Nerdinger (1994, S. 206) kritisiert allerdings am Ansatz von Klaus, dass eine so verstandene Qualität der empirischen Erfassung nicht zugänglich sei und schlägt ergänzend das Konzept des Dienstleistungsklimas vor, das die Organisation mit den Bedienten über die Wahrnehmungen und das Erleben der Organisation durch die Dienstleister verknüpft (a.a.O., S. 219). In dieser Triade kommt der Organisation die Aufgabe zu, u. a. durch umweltpsychologische Gestaltung des Erlebens von Raum und Zeit ein unterstützendes Dienstleistungsklima zu fördern, in dem das dienstleistende Organisationsmitglied durch geeignete "instrumentelle" und "sozio-emotionale" Handlungen gemeinsam mit dem Bedienten eine Leistung erstellt, die als qualitätsvoll erlebt werden kann.
2.1.4 Qualitätsmanagement (QM)
Der Management-Begriff wird in zahllosen Wortverbindungen verwendet, um die planvolle Bewältigung spezieller Aufgaben oder Problemfelder zu kennzeichnen (Greif, 1998c, S. 515). Je nach Zielbereich entstehen so Umwelt-, Kosten-, Wissens-, Arbeitsschutz- und andere Managementsysteme, die es im aktuellen Ansatz des "Integrierten Managementsystems"(vgl. Initiative Qualitätssicherung NRW, o. J.) wieder zusammenzuführen gilt.
Während Management auf zielgerichtete, koordinierte, kontrollierte und effiziente Tätigkeiten fokussiert, werden spontane, ungeplante oder chaotische Strukturierungen organisationaler Prozesse eher unter Selbstorganisation subsumiert (vgl. Greif, a.a.O.).
Qualitätsmanagement heißt, funktionsbereichsübergreifend Qualität zu planen, zu steuern und zu überwachen. Die ISO 9000:2000 definiert Qualitätsmanagement sinngemäß als "aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zum Leiten und Lenken einer Organisation bezüglich Qualität."
Definitionen von Qualitätsmanagement (QM) – eine Auswahl
- QM ist Teil der Gesamtführungsaufgabe eines Unternehmens zur Entwicklung und Gewährleistung von Qualität (N. N.).
- QM ist die Gesamtheit der Aktivitäten zur Erreichung und Förderung der Qualität von Leistungen (Hollerith, 1994).
- QM ist die Gesamtheit der qualitätsbezogenen Tätigkeiten und Zielsetzungen in einer Organisation (Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V.).
- QM wird verstanden als das Herstellen günstiger Struktur-, Rahmen und Prozessbedingungen, unter denen sich Systeme selbst steuern, organisieren und entwickeln können (Schiepek & Bauer, 1998).
- QM ist Kontextsteuerung zur Optimierung der Leistungspotenziale, -prozesse und -ergebnisse einer Organisation (Gerull, 2004).
- QM: aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zum Leiten und Lenken einer Organisation bezüglich Qualität (ISO 9000:2000).
Basis des QM ist das Prozessmanagement. Damit ist ein Führungskonzept gemeint, in dem Hierarchie und Bereiche nicht mehr streng gegen- und untereinander abgegrenzt sind, sondern "bereichs- und funktionsübergreifend ganzheitlich synergetisch zusammenwirkend einen Kundennutzen erzeugen"(Zollondz, 2002, S. 200).
Ein Prozess ist nach ISO 9000:2000 ein Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Tätigkeiten, der Eingaben in Ergebnisse umwandelt (a.a.O., S. 205). Ziel der Prozessorientierung ist es, die integrationshemmende Funktionsoptimierung durch die integrationsförderliche Flussoptimierung abzulösen. Nur so könne eine Schnittstellenreduzierung erfolgen und der künstlichen Zersplitterung des Unternehmens entgegengewirkt werden (a.a.O., S. 208).
Trotz seines integralen, querschnitthaften Charakters wird das operative Qualitätsmanagement in vielen betriebswirtschaftlich orientierten Darstellungen in Teilfunktionen gegliedert:
- Qualitätsplanung,
- Qualitätslenkung (-regelung, -steuerung),
- Qualitätssicherung (-prüfung, -kontrolle) und
- Qualitätsförderung (-verbesserung), bisweilen ergänzt um die
- Qualitätsdarlegung oder Qualitätsdokumentation
(vgl. Arnold, 1998; Seghezzi, 1994, 1996). Dabei wird jedoch betont, dass es sich um miteinander zusammenhängende, in einem kontinuierlichen Rückkopplungsprozess wiederholt zu durchlaufende Stadien handele ("Qualitätskreis").
Die Qualitätsplanung bezweckt, die Produkte und Herstellungsprozesse bedarfsgerecht und mit geringem Fehlerrisiko zu gestalten; dazu wird häufig zunächst der Soll-Zustand eines Produkts/einer Dienstleistung ermittelt und als Bündel von Qualitätszielen formuliert, für deren Erreichung geeignete Umsetzungsstrategien entwickelt werden.
Mit Qualitätslenkung wird versucht, die Leistungen so zu erbringen, dass sie mit den Anforderungen (Spezifikationen, im Dienstleistungsbereich zumeist Standards genannt) konform sind; wirksame Mittel sind neben Vorbeugung, Überwachung und Korrektur des Ist-Zustandes z. B. Maßnahmen zur Qualifizierung der MitarbeiterInnen, zur Integration des QM in die betriebliche Organisationsstruktur und zum Aufbau geeigneter Informations- und Kommunikationsformen.
Trotzdem gibt es im Leistungsprozess Stellen erhöhter Fehleranfälligkeit, zu deren Begrenzung Qualitätssicherung im engeren Sinne eines aktiven Risikomanagements beitragen soll; dazu sind in der Regel Überwachungsmaßnahmen zur Ermittlung von Soll/Ist-Abweichungen erforderlich, aus denen wiederum Maßnahmen im Rahmen der Qualitätsplanung oder -lenkung abzuleiten sind.
Qualitätssicherung wurde im deutschen Sprachraum lange Zeit mit Qualitätsmanagement gleichgesetzt, ist aber nach aktueller Auffassung nur ein instrumenteller Teil desselben.
Definitionen von Qualitätssicherung – eine Auswahl
- Qualitätssicherung: systematische Maßnahmen und Vorkehrungen zur Beherrschung arbeitsteilig organisierter Herstellungsprozesse für ein Produkt (versch.)
- Qualitätssicherung: Summe aller organisierten verbindlichen Vorkehrungen, Dienstleistungen so zu erbringen, wie sie als fachlich richtig erkannt und anderen versprochen wurden (Tornow, 1999).
- Qualitätssicherung: Alle geplanten und systematischen Tätigkeiten, die innerhalb des QM-Systems verwirklicht sind, und die wie erforderlich dargelegt werden, um angemessenes Vertrauen zu schaffen, dass eine Einheit die Qualitätsforderung erfüllen wird (ISO 9000:1994).
- Qualitätssicherung und methodisches Arbeiten sind weitgehend identische Prozeduren (von Spiegel, 1997).
- Interne Qualitätssicherung: Anweisungen zur Herstellung der innerbetrieblichen Voraussetzungen für die Förderung und Sicherung von Qualität (Schild, 1996).
- Externe Qualitätssicherung: Beurteilung und Kontrolle der Produkt- oder Dienstleistungsqualität und ihrer Entstehungsvoraussetzungen durch den Abnehmer oder durch befugte Stellen (Schild, 1996).
Qualitätsförderung hat die Aufgabe, eine Unternehmenskultur der kontinuierlichen Verbesserung zu schaffen und zu pflegen.
Bei der Qualitätsdarlegung schließlich geht es um die Abbildung des betrieblichen QM für Zwecke der Innen- und Außendarstellung, zumeist in Form eines Qualitäts(management)-Handbuchs, spezieller Qualitätsaufzeichnungen und statistischer Kennzahlen.
Im Bereich sozialer Dienstleistungen werden die Teilfunktionen eines QM zumeist nicht so differenziert und in anderen Begriffen verwendet. Allein aufgrund der eingeschränkten Möglichkeit, Leistungsprozesse zu standardisieren und nach präziser Planung und Lenkung normkonform umzusetzen, wird z. B. im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) der Terminus der Qualitätssicherung wegen seiner technischen Assoziationen vermieden. Vielmehr ist hier wie auch anderenorts die Rede von Qualitätsentwicklung und – im Zusammenhang mit Fragen der Fremd- oder Selbstüberprüfung – von Qualitätsbewertung.
2.1.5 QM-Modelle
Wie schon bezüglich des Begriffs der Qualität und der darin zum Ausdruck kommenden Vorstellungen, so existieren auch hinsichtlich des Managements von Qualität mehr oder minder systematische Versuche, dessen zweckmäßige Elemente zu konzeptualisieren. Trotz der Verschiedenheit dieser Ansätze konstatiert Zollondz (2002), dass alle QM-Modelle eine Reihe von Voraussetzungen als gemeinsamen Nenner aufweisen.
Dieses "Conditio-Sine-Qua-Non-Modell"(a.a.O., S. 189f) enthält folgende sechs Elemente, denen bestimmte Anforderungen zugeordnet werden können:
1. Prozesse
Kern-, Führungs- und Supportprozesse sind zu identifizieren und ihre Qualitätsfähigkeit ist zu bestimmen.
2. Management
Es muss u. a. die Qualitätspolitik und die daraus abgeleiteten Qualitätsziele formulieren. Das Management ist in das QM einzubinden und hat es uneingeschränkt vorzuleben.
3. Ressourcen
Materielle und immaterielle Ressourcen sind vom Management bereitzustellen.
4. Mitarbeiter
MitarbeiterInnen sind zu qualifizieren, Qualitätsbewusstsein und mitunternehmerisches Denken sind zu fördern.
5. Kunden
Aus deren Erwartungen sind Qualitätsforderungen abzuleiten.
6. Verbesserungen
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist integraler Bestandteil des QM-Systems; Ziel ist es, Verschwendung zu beseitigen.
Jedes QM hat sich mit diesen sechs Elementen als zentralen Erfolgsfaktoren auseinanderzusetzen. Diese Auffassung gilt sowohl für die branchenunabhängigen Modelle als auch für branchenspezifische Adaptationen, Verkürzungen und Eigenentwicklungen.
Zollondz (2002, S. 222ff.) differenziert QM-Modelle in allgemeine Kernmodelle, Branchenmodelle und Kontextkonzepte. Die prominentesten Konzepte werden in diesem Buch näher beschrieben und beurteilt, allerdings unter einer anderen Systematik (s. Kap. 4.4). An dieser Stelle soll ein erster Überblick nach der Zuordnung von Zollondz erfolgen, ausgenommen die Kategorie der Kontextkonzepte.
Allgemeine Kernmodelle des QM
- QM vom Elektrizitätstypus (Seghezzi, 1996, S. 200):
Es handelt sich nicht um ein explizit formuliertes QM-Modell, sondern eher um einen charakteristischen Handlungstypus von Organisationen, mit der Qualitätsfrage umzugehen: "Steht Elektrizität (= Qualität, P. G.) zur Verfügung, fällt dies niemandem auf. Fällt sie dagegen aus, so geht die Beleuchtung aus, die Heizung oder Lüftung steht still ... Gute Elektrizitätswerke haben ein System, um solche Pannen in kürzester Zeit zu beheben"(a.a.O.).
- QM vom Kulturtypus (Seghezzi, 1996, S. 200f):
Dieses Konzept lässt sich durch vier Merkmale charakterisieren, die den eigenen Anspruch der Organisation verkörpern: gute fachliche Qualifikation der Führungskräfte und Mitarbeiter, qualitätsorientierte Unternehmenskultur, Unterstützung durch die oberste Leitung und gute technische Ausstattung. Obwohl oftmals ohne transparente Qualitätsplanung oder explizites QM-System, werden in solchen Organisationen Leistungen von hoher Qualität erbracht.
- Kontinuierliches Verbesserungsmanagement (KVM, Zollondz, S. 225ff.):
Der Ansatz wird sowohl als eigenständiges Managementkonzept (z. B. Kaizen) oder als in QM eingebettetes Instrument praktiziert. Die internationale Normung zum QM hat weder den – umfassenderen – Begriff des Kaizen , noch die bekannte Bezeichnung "kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)" aufgenommen, sondern sich für "Qualitätsverbesserung" entschieden. Diese ist nach ISO 9000:2000 jener "Teil des Qualitätsmanagements, der auf die Erhöhung der Fähigkeit zur Erfüllung der Qualitäts(an)forderungen gerichtet ist"(zit. nach Zollondz, S. 230).
- QM-Systeme (hier: ISO 9000:2000-Normenreihe, Zollondz, S. 242ff.):
Alle Aufgaben, Strukturen, Organisationselemente und Maßnahmen, die zur Bewirtschaftung von Qualität eingesetzt werden, bilden ein Qualitäts(management)system. Dieses ist also ein qualitätsbezogenes, die Erfüllung von Qualitätsanforderungen betreffendes Managementsystem (a.a.O., S. 251). Entgegen einem häufigen Missverständnis gibt es keine genormten QM-Systeme, sondern nur Normen zum QM, auf deren Grundlage dann ein je spezifisches QM-System der Organisation aufzubauen ist (a.a.O., S. 245). ISO 9001:2000 ist ein solches QM-System zur externen Darlegung (auch als Darlegungs-, Nachweis- oder Forderungsnorm bezeichnet).
ISO 9000:2000 ist die Begriffsnorm, d. h. darin sind die Grundlagen und Begriffe definiert. ISO 9004:2000 (auch als Leitfaden, Empfehlungs- oder Leistungsnorm bezeichnet) schließt die Darlegungsnorm 9001 ein, bezieht sich aber nicht nur auf die Produktqualität, sondern auf die relevanten Prozesse der Organisation insgesamt. Während die ISO 9001:2000 auf den Kunden fokussiert, hat die ISO 9004:2000 alle Stakeholder im Blick und ist somit ein Modell für Verbesserungen in Richtung TQM (s. u.).
Neben den potenziellen Vorteilen für die Kunden, deren Kaufrisiko durch ein nach ISO 9001:2000 zertifiziertes QM-System gemindert werden soll, werden mit der Anwendung von QM-Systemen auch potenzielle Vorteile für den Lieferanten angestrebt: Schaffung von Vertrauen zwischen ihm und den Kunden, Verbesserung der betrieblichen Abläufe und ihrer Dokumentation, Schaffung von Vertrauen der Organisation in die eigenen Geschäftsprozesse, Entlastungsmöglichkeit im Produkthaftungsfall.
- TQM-Modelle (Zollondz, S. 261ff.):
Ein QM-Modell, das im Begriff ist, sich zu einer übergeordneten Unternehmensstrategie zu entwickeln, stellt das Total Quality Management (TQM) dar. Es wird in verschiedenen Ausgestaltungen praktiziert. Als besonders wichtige Elemente von TQM gelten (a.a.O., S. 265): Kundenorientierung, partnerschaftliche Kunden-Lieferanten-Beziehungen, Integration und Partizipation der Mitarbeiter aller Hierarchieebenen, Gruppenarbeit und Mitwirkung unterstützende Arbeitsbedingungen, Qualitätsorientierung, Qualifizierung der Mitarbeiter, Anerkennung guter Leistungen, Berücksichtigung von Humanität und sozialen Komponenten, ständiger Verbesserungsprozess, Wertschöpfungskonzentration und Abbau nicht kundenrelevanter Tätigkeiten, Anwendung moderner Methoden und Techniken des QM, Betonung Fehler vermeidender Maßnahmen, top-down-Ansatz mit missionarischer Einbringung der obersten Leitung, partizipatives und zugleich straffes Management.
Die bekanntesten TQM-Modelle sind: Deming Application Prize, Malcolm Baldrige National Quality Award, EFQM-Modell als Basis des European Quality Award, Ludwig-Erhard-Preis.
- Integratives/integriertes QM (Zollondz, S. 296ff.):
Es handelt sich um die Umsetzung des anspruchsvollen Modells von K. Bleicher (St. Galler Management Konzept) durch Zink (Integratives QM) und Seghezzi (Integriertes QM) . Beiden Modellen wird nur begrenzte Fachresonanz attestiert (a.a.O., S. 305f).
- Integrierte Managementsysteme (IMS, Zollondz, S. 306ff.):
IMS berücksichtigen, dass Organisationen sich neben qualitätsbezogenen Forderungen auch noch mit anderen Anforderungen zu befassen haben: z. B. Umwelt, Arbeitsschutz, Anlagensicherheit, Notfall, Hygiene. Idee ist, die Integration der verschiedenen Managementsysteme voranzutreiben, statt sie isoliert aufzubauen.
Branchenbezogene QM-Regelwerke (Zollondz, S. 311ff.)
Sie setzen entweder die Forderungen der ISO 9001:2000 voraus und erweitern sie um branchenspezifische Aspekte (z. B. in der Automobilbranche: Norm QS-9000) oder sie haben eigenständigen Charakter mit und ohne Bezug auf die ISO 9000-Familie oder andere Referenzsysteme (z. B. KTQ: Kooperation für Transparenz und Qualität im Krankenhaus).
2.1.6 Qualitätstechniken und -instrumente
Qualitätstechniken (auch als Werkzeuge oder tools bezeichnet) verkörpern die genuin praktisch-methodische Seite des QM auf der operativen Ebene. Qualität entsteht aus dem Einsatz von "Technik" und "Geisteshaltung"(Kamiske, zit. nach Zollondz, 2002, S. 318).
K. Frey (1997, S. 14) bezeichnet den Ansatz des Total Quality Management seiner fehlenden Theorie oder Systematik wegen als "Ansammlung von über 200 Werkzeugen".
Viele dieser Werkzeuge gehören zum traditionellen Rüstzeug von z. B. FortbildnerInnen, UnternehmensberaterInnen, GruppentherapeutInnen und LehrerInnen und wurden lediglich für Zwecke des QM instrumentalisiert. Sie kennzeichnen einerseits bestimmte Organisationsformen und soziale Settings für Lernprozesse (z. B. Open Space), andererseits vor allem Formen der Strukturierung (z. B. Mind Mapping), Visualisierung (z. B. Histogramm), Medienunterstützung (z. B. Präsentationstechnik), Problembearbeitung (z. B. Ursache-Wirkungs-Diagramm), Ideengenerierung (z. B. Brainstorming), Datenverdichtung, -auswertung und -dokumentation (vgl. Gerull (Hrsg.), 2000, S. 3:2ff.).
Zu den Qualitätstechniken im engeren Sinne zählt Zollondz (2001, S. 1006):
- Quality Function Deployment (QFD),
- Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA),
- Statistische Prozessregelung (SPR),
- seven tools of quality (Q7),
- new seven tools for quality control (M7),
- seven tools der statistischen Versuchsplanung (DoE: design of experiments).
Als Qualitätstechniken im weiteren Sinne bezeichnet Zollondz (a.a.O.) die als D7 bekannt gewordenen tools für Dienstleister (in Klammern: primärer Einsatzzweck):
- Vignettentechnik (Design/Entwicklung/Prävention/Ermittlung der Qualitätsmerkmale),
- Service-Blueprinting (Prozessdarstellung),
- Sequentielle Ereignis-Methode (Ermittlung der Qualitätsmerkmale),
- ServQual (Qualitätsmessung),
- Beschwerdemanagement (Beschwerden),
- FRAP: Frequenz Relevanz Analyse von Problemen (Analyse),
- Service-FMEA (Prävention und Verbesserung),
sowie die unter K7 firmierenden Kreativitätstechniken (Brainstorming, Brainwriting, Delphi-Methode, morphologischer Kasten, Synektik, Reizwortanalyse, Problemlösungsbaum) und bestimmte Elemente des Produktionssystems und der Arbeitsorganisation: Kaizen, Poka-Yoke, Gruppenarbeit, Qualitätszirkel, Audits und Just-in-time (JIT).
Nur ein Teil der genannten und weiterer Techniken kann im Rahmen dieses Handbuchs beschrieben werden (s. Kap. 4.6). Nähere Ausführungen finden sich u. a. bei Theden & Colsmann (1996), Seghezzi (2003) und Zollondz (2001, 2002).
Von den Qualitätstechniken im engeren und weiteren Sinne abzugrenzen sind jene Werkzeuge, die nicht auf einzelne Fragestellungen zugeschnitten sind, sondern umfangreichere betriebliche Funktionen erfüllen und mehr oder weniger tragende Praktiken des QM darstellen. Sie sollen im Folgenden Qualitäts-Instrumente genannt werden, lassen sich teilweise aber auch problemlos den weiter unten erörterten QM-Kontextkonzepten zuordnen (z. B. Benchmarking):
- Qualitätsleitbild,
- QM-Handbuch,
- Qualitätszirkel,
- Qualitätsbeauftragte,
- Kunden- und Mitarbeiterbefragungen,
- Prozessanalyse (incl. Kundenpfadanalyse),
- Benchmarking,
- Ideen-, Wissens- und Beschwerdemanagement.
Die meisten dieser Instrumente sind Gegenstand ausführlicher Betrachtung in diesem Buch; auf die wenig trennscharfe, aus pragmatischen Gründen dennoch vorgenommene, Unterscheidung von Techniken und Instrumenten wird in Kap. 4.1 noch einmal eingegangen.
2.1.7 Qualitätsmanagement-Kontextkonzepte
Wie Hoerner & Vitinius (1997, S. 14) in einem kritischen Führer durch die Managementtheorien sarkastisch betonen, steht der Nachfrage verunsicherter Manager nach Erfolgsrezepturen ein breitgefächertes Angebot der UnternehmensberaterInnen an Methoden, Konzepten und Strategien gegenüber. Viele davon lassen sich nicht ohne weiteres dem Qualitäts-Label zu-, unter- oder überordnen und bisweilen ist es eine willkürliche Entscheidung, ein Konzept als eigenständigen methodischen Ansatz oder als Element des QM zu betrachten. Um zu verdeutlichen, dass es sich um Verfahren oder Modellvorstellungen handelt, die im Zusammenhang mit der Qualitätsdebatte (wieder) Aktualität erlangt haben, zum Teil aber in einer anderen Wissenschaftstradition stehen und als selbständige Ansätze (ko)existieren können, wird in Anlehnung an Zollondz (2002, S. 316ff.) im Folgenden der Begriff des QM-Kontextkonzepts verwendet.
Dazu können vor allem gezählt werden:
- Lean Management,
- Business Reengineering,
- Evaluation,
- Controlling,
- Balanced Scorecard,
- Benchmarking,
- Organisationsentwicklung (OE), Change Management u. Ä.
- Lernende Organisation,
- Unternehmensphilosophie, Corporate Identity u. Ä.,
- Personalentwicklung (PE),
- Human Resource Management (HRM),
- Partizipation und Empowerment,
- Gruppenarbeit und Qualitätszirkel,
- Arbeitsgestaltung (job design),
- Betriebliches Vorschlagswesen (BVW),
- Beschwerdemanagement,
- Wissensmanagement und Management-Informationssysteme (MIS).
Einige dieser Konzepte (z. B. Benchmarking, MIS) lassen sich auch unter Qualitätstechniken oder Qualitätsinstrumenten subsumieren, andere (z. B. Lernende Organisation, Empowerment) stellen mehr oder minder umfassende Ansätze zur Veränderung ganzer Organisationskulturen dar. Auf die meisten der genannten Konzepte wird in diesem Buch ausführlich eingegangen (s. Kap. 2.3 und 4.4.5).
2.1.8 QM-Implementierungskonzepte
Implementierung meint den Prozess der Umsetzung einer Idee von der Theorie in die Praxis. Im vorliegenden Zusammenhang kann Implementierung definiert werden als Summe aller Maßnahmen, die notwendig sind, um ein QM-System in einer Organisation wirksam werden zu lassen (Zollondz, 2002, S. 325). Weder die ISO-Normen noch TQM-Modelle oder andere QM-Konzepte sind direkt für die Umsetzung gedacht und enthalten oft wenige bis gar keine Hinweise auf Implementierungsfragen. Es verwundert deshalb nicht, dass viele gut gemeinte Systeme an der betrieblichen Wirklichkeit scheitern.
Neben der Bedeutung einer für alle sichtbaren Einbeziehung des Managements und dessen klar formulierter Qualitätspolitik spielen häufig institutionelle Absicherungen des Implementierungsprozesses in Form von Steuerungsorganen (Lenkungskreis o. Ä.), Qualitätskoordinatoren oder -beauftragten, Qualitätszirkeln oder anderen Teamkonzepten eine große Rolle. Einführungspläne mit Prioritäten, Projekten und Zwischenzielen, Schulungsmaßnahmen, Belohnungssysteme und Fortschrittskontrollen in Form von Reviews, Audits und Evaluationen vervollständigen den Implementierungsprozess. Nicht zuletzt ist jedes QM selbstreferenziell einzubetten in einen Kreislauf der kontinuierlichen Verbesserung.
Im Folgenden wird kurz auf einige der bekannteren Implementierungskonzepte eingegangen, um den eher betriebswirtschaftlich orientierten Überblick zu Qualitäts- und QM-Modellen in diesem Kapitel zu vervollständigen.
- Implementierungskonzept von Illi (nach Zollondz, 2002, S. 325ff.):
Illi betont die Notwendigkeit, alle Bereiche des Unternehmens einzuschließen und Insellösungen zu vermeiden. Neben den erforderlichen Rahmenbedingungen personeller, struktureller, technischer und methodischer Art werden zeitlich und inhaltlich aufeinanderfolgende Phasen unterschieden (a.a.O., S. 326f). Hingewiesen wird auf besondere Problemzonen.
- Implementierungskonzept von Malorny (1996, nach Zollondz, 2002, S. 328):
Das Business Excellence Modell gilt als anspruchsvollster und umfassendster Implementierungsansatz; er berücksichtigt in hohem Maße sozialpsychologische Aspekte. Bezugsmodell ist das EFQM-Konzept (s. Kap. 4.4.1.4). Unterschieden werden eine Sensibilisierungs-, Realisierungs-, Stabilisierungs- und Excellence-Phase. Zollondz (a.a.O., S. 330) wirft die Frage auf, ob dem Modell nicht ein zu idealisiertes Menschenbild zugrunde liege.
- Das Berliner TQM-Umsetzungsmodell von Radtke (1999):
Das Berliner Umsetzungsmodell zerlegt TQM in handliche Module und will so eine unternehmensspezifische und pragmatische Implementierung ermöglichen. Arbeitspakete des Startmoduls sind u. a. die Information der Führungskräfte und die umfassende Vermittlung der TQM-Geisteshaltung. Weitere Module sind Führung, Politik und Strategie, Mitarbeiterorientierung, Ressourcen, Prozesse, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Einfluss auf Gesellschaft und Geschäftsergebnisse. Diese, ebenfalls dem EFQM-Modell entsprechenden, Kriterien bilden einen geschlossenen Kreislauf, wobei die Geisteshaltung im Zentrum steht . Den einzelnen Modulen des Bereichs "Mittel und Wege" sind Aufgaben (z. B. Führung: Grundwerte erarbeiten, kommunizieren, vorleben), den Modulen des Ergebnisbereichs sind Indikatoren (z. B. Kundenzufriedenheit: Befragung, Beobachtung, Datenanalyse) zugeordnet.
Fraglich ist, ob sich die Prozesse der Entwicklung, Beschreibung und Einführung von QM-Systemen im Humandienstleistungsbereich so trennen lassen, wie es die Unterscheidung von Phasen und Modulen insinuiert. So wird einerseits betont, dass Implementierung ein schwieriger und langwieriger Vorgang sei, der ein Umdenken aller Organisationsmitglieder und eine Veränderung der Organisationskultur erfordere (Zollondz, 2001, S. 352). Andererseits besteht die Wirkung eines nach Gestaltungsparametern des TQM entwickelten Qualitätsmanagements ja gerade darin, ein entsprechendes Bewusstsein im Unternehmen zu fördern. Bereits im Prozess des betrieblichen Qualitätsdiskurses sind somit Implementierungsaspekte stets präsent und keine Schritte, die es erst nach Abschluss dieses Diskurses zu unternehmen gilt.
Sinngemäß äußert sich Bleicher (1996, zit. nach Zollondz, a.a.O., S. 324):"Die postulierte Unterscheidung von strategischem und operativem Management ist … gefährlich, denn sie widerspricht der Notwendigkeit, dass Strategien im Unternehmensalltag leben müssen."
In den meisten Qualitätskonzepten, die im sozialen Dienstleistungsbereich verwendet werden, wird deutlich, dass dort die Implementierungsfrage offenbar eine sehr viel größere Rolle spielt, als Bleicher (a.a.O.) dies für den gewerblichen Bereich zu konstatieren Anlass sah. Unter den in diesem Buch später als "formale und materiale Branchenkonzepte" etikettierten Ansätzen finden sich zahlreiche, die sich primär als Verfahrensstrategie verstehen oder bei denen sich methodisches Procedere und inhaltliche Fokussierung mehr oder weniger miteinander verschränken. Darin äußert sich die Erkenntnis, dass für Organisationen, in denen zentral personenbezogene Dienstleistungen erbracht werden, die Einbeziehung der sozialpsychologischen Dimension selbstverständlich sein muss. Dass dies grundsätzlich auch für den Profit-Bereich gilt, belegen die elaborierten Implementierungskonzepte etwa von Radtke oder Malorny (s. o.).
Die meisten Handlungsanleitungen und Empfehlungen zum QM in der Sozialen Arbeit thematisieren denn auch die Art und Weise, wie Einrichtungen ein QM-System bei sich einführen sollten (vgl. Kap. 4.7). Im Vordergrund steht aber auch dabei eine Abfolge von Schritten oder Phasen, mit denen die Anforderungen des Systems abzuarbeiten sind. Zumeist wird dazu eine Projektorganisation für erforderlich gehalten, mit der sichergestellt werden soll, dass innerhalb eines überschaubaren zeitlichen und finanziellen Rahmens bestimmte Arbeitsergebnisse vorliegen (Gerull, 2001, S. 27).
2.2 Zur Verortung des Qualitätsmanagements in Wissenschaft und Praxis
Qualitätsmanagement bezieht sich auf die Planung, Steuerung, Kontrolle und Optimierung von Leistungen, die von Betrieben, Unternehmen, Einrichtungen, Diensten und anderen Organisationen erbracht werden. QM ist insofern (auch) Gegenstand der Organisationsforschung.
"Eine Organisation ist ein soziales Gebilde, das bestimmte Ziele verfolgt und formale Regelungen aufweist, mit deren Hilfe die unter die Mitgliedschaftsbedingungen fallenden Aktivitäten der Mitglieder auf diese Ziele ausgerichtet werden sollen"(Kieser & Kubicek, 1992, S. 1).
In vielen Themenfeldern der Organisationsforschung, wie z. B. Strategische Planung, Führung und Motivation, ging die Entwicklung der theoretischen Grundlagen der praktischen Anwendung von Konzepten voraus. Bezüglich der amerikanischen "quality movement" – weitgehend identisch mit TQM – wird eine umgekehrte Richtung konstatiert (Knouse, Smith & Smith, 2001, S. 757). Hier waren es vor allem PraktikerInnen und UnternehmensberaterInnen, welche die Qualitätsbewegung dominierten (Scott & Cole, 2000, S. xxii).
Auch in Europa vollzog sich die Entwicklung eines systematischen Managements zur optimalen Bewirtschaftung von Qualität nicht im Rahmen der akademischen Managementlehre, sondern weitgehend parallel und separat in der industriellen Praxis (vgl. Seghezzi, 1994, Vorwort). Jahrzehntelang übten amerikanische und japanische "Qualitätsgurus" aus dem Industriebereich wie Deming, Juran, Feigenbaum, Crosby, Ishikawa, Imai und andere größten Einfluss auf die Entwicklung aus. Der japanische Deming-Prize und der amerikanische Malcolm Baldrige National Quality Award dienten als Vorbilder für europäische Bemühungen, Unternehmen zur Business Excellence zu führen.
Während QM in der Praxis bereits seit den Achtzigerjahren eine Rolle spielt, werden erst seit Mitte der Neunzigerjahre Beiträge registriert, eine Organisationstheorie des QM zu formulieren (Knouse et al., a.a.O.). Gründe dafür werden einerseits in der ingenieurwissenschaftlichen Provenienz der meisten Qualitätspraktiken vermutet, andererseits in der anfänglichen Skepsis der Organisationstheoretiker, ob es sich bei der Qualitätsbewegung um mehr als eine zeitweilige Modeerscheinung handele (a.a.O.). Ungeachtet der zweifellos auch von einem "faddish element"(Dean & Bowen, 2000, S. 4) und Partikularinteressen der Beratungsbranche durchwirkten Debatte (vgl. Shapiro, 1998; Hoerner & Vitinius, 1997; Knorr, 1999), muss inzwischen allerdings eine bemerkenswerte Langlebigkeit dieser Qualitätsbewegung festgestellt werden, dominiert sie doch angeblich seit einem halben Jahrhundert die Aufmerksamkeit des Managements (Cole & Scott, 2000, S. xxi).
Die empirische Organisationsforschung ist eines der wenigen wirklich interdisziplinären Gebiete (Scholl, 2004, S. 515). Konzepte der Organisation – häufig als Organisationstheorien firmierend – wurden von soziologischer, betriebswirtschaftlicher, psychologischer, politologischer, anthropologischer und ökonomischer Seite entwickelt und rücken jeweils verschiedene Aspekte in den Vordergrund. Diese Konzepte gewinnen ihre Überzeugungskraft aus integrativen Denkfiguren bzw. Metaphern, die das unübersichtliche organisatorische Geschehen ordnen und begreifbar machen sollen: z. B. die Ausbeutungs-, Maschinen-, Bedürfnis-, Problemlösungs-, Politik-, Organismus-, Kultur-, Kosten- und Netzwerkmetapher (a.a.O., S. 520ff.).
Ohne die Analyse an dieser Stelle vertiefen zu wollen, kann eine besondere Nähe des QM zur Kulturmetapher der Organisationsforschung festgestellt werden. Deren Wert liegt vor allem darin, die "Organisationsrealität" auch als Deutungsprodukt der Akteure und damit als Kritik an mechanistischen Forschungskonzeptionen zu analysieren. Dabei wurden qualitative Ansätze und intensive Fallstudien als legitime Forschungsmethoden etabliert und weiterentwickelt (Scholl, 2004, S. 527).
Weinert (1998, S. 69ff.) konstatiert in der Organisationsforschung das Fehlen einer einheitlichen Theorie und Handlungsebene und fordert die Schaffung einer interdisziplinären Organisationswissenschaft. Eine solche ist mittlerweile zwar ausgewiesen im Rahmen universitärer Ausbildungsangebote (z. B. Fakultät der Wirtschafts- und Organisationswissenschaft an der Universität der Bundeswehr München), wird aber eher als Addition aus verschiedenen Teildisziplinen abgehandelt (z. B. als soziologische, wirtschaftswissenschaftliche und angewandte Organisationswissenschaft plus ergänzende Gebiete an der Universität Köln), denn als integratives Rahmenwerk für die Forschungsergebnisse der Einzeldisziplinen (vgl. Weinert, 1998, S. 70).
Dennoch liegt es nahe, QM wissenschaftssystematisch in einer solchen interdisziplinären Organisationswissenschaft zu verorten. Danach gehört QM keiner etablierten akademischen Bezugsdisziplin an, sondern erfährt je nach thematischer Fokussierung und Art der Organisation (z. B. Industrie, Bildungsinstitut, Bank, Arztpraxis) eine unterschiedliche Ausgestaltung (z. B. was den Stellenwert technischer Prozessparameter, standardisierter Handlungsvollzüge oder situativer Ermessensspielräume anbelangt). QM stellt somit die qualitätsbezogene Schnittmenge der tangierten Teildisziplinen dar.
Einen anderen Ansatz wählt Seghezzi (1996, 2003), der die Bewirtschaftung des Unternehmensfaktors Qualität – Qualitätsmanagement – gleichberechtigt mit den Teilkonzepten des Kosten- und Zeitmanagements in ein allgemeines Managementmodell zu integrieren und damit in die Betriebswirtschaftslehre einzubetten versucht. Allerdings wurden seine durchaus überzeugenden Bemühungen in weiten Teilen der wirtschaftswissenschaftlichen Standardliteratur bislang nicht aufgegriffen.
So wird weder in dem weitverbreiteten Lehrbuch von Wöhe (2002), noch bei Bofinger (2003) oder Mankiw (2004) der Begriff des QM überhaupt erwähnt; im Katalog der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen fand sich zumindest bis 2005 kein einziger Hinweis darauf, dass QM inzwischen Eingang in die betriebswirtschaftliche Systematik gefunden hätte.
"Heute bietet man zwar Kurse in Qualitätsmanagement an, meistens aber in Ergänzung und ohne engen Bezug zur bestehenden Betriebswirtschaftslehre"(Seghezzi, 2003, S. 4).
Man mag dieses Phänomen der Nichterwähnung in Lehrbüchern publikationsspezifischen Trägheitsmomenten zurechnen, zumal in aktuellen Vorlesungsverzeichnissen bundesdeutscher Wirtschafts- und Verwaltungsfakultäten durchaus Veranstaltungen dem QM-Thema gewidmet werden. Berücksichtigt man die Geschichte des QM und die inhaltliche Affinität zur Betriebswirtschaftslehre und deren "Hilfswissenschaften"(vgl. Wöhe, 2002), so erscheint eine entsprechende Zuordnung des QM legitim und sinnvoll, auch wenn gerade in Nonprofit-Organisationen die Rolle dieser Hilfswissenschaften – namentlich der Psychologie und Soziologie – darin besteht, den ökonomischen Blickwinkel der Betriebswirtschaft wesentlich, um nicht zu sagen: um das Wesentliche, zu erweitern.
Versuche wie die von J. F. W. Müller (2004), ausgehend von einer vorgeblichen Ablösung herkömmlicher Konzepte wie Organisations- und Personalentwicklung durch Qualitätsmanagement das TQM-Konzept als organisationstheoretischen Oberbegriff zu diskutieren, können dagegen nicht so recht überzeugen. Gerade der Bereich des Human Resource Management widmet sich dezidiert auch solchen Fragen, die im QM bislang chronisch zu kurz gekommen sind, z. B. Personalselektion und -plazierung. Ein proaktives Personalmanagement, das in seiner Ausgestaltung weit über das traditionelle betriebswirtschaftliche Personalwesen hinausgeht, ist konzeptionell ebenso gut geeignet, zentrale Anliegen eines QM aufzunehmen, wie dies umgekehrt der Fall ist. Dies gilt gleichermaßen für die Frage, ob Organisationsentwicklung im Sinne eines ganzheitlichen Veränderungsprozesses die aktuellen QM-Konzepte integrieren kann oder ob QM besser als eine besondere, nämlich auf die Qualität des Angebotsprodukts fokussierende, Form des Change Management aufgefasst wird. Die jeweilige Zu-, Über- oder Unterordnung scheint eher eine Frage des Blickwinkels als der wissenschaftssystematischen Logik zu sein.
QM als organisationstheoretisches "Superkonzept" zu betrachten, an dem alle Betriebsbereiche auszurichten sind und das letztlich mit der Gesamtführungsaufgabe der Organisation identisch wird ("Total" QM), hieße aus betriebswirtschaftlicher Sicht, die anderen Faktoren des unternehmerischen Spannungsvierecks (Seghezzi, 2003, S. 19f) zu vernachlässigen. Damit würde jedoch die historische Bedeutung des Qualitätsdiskurses – genannt seien hier vor allem die Fokussierung auf Kundenbedürfnisse, partizipative ("mitunternehmerische") Organisationsstrukturen, Orientierung am Stakeholder-Value-Prinzip – durch Überdehnung des Konzepts diskreditiert.
Die immer noch stiefmütterliche Behandlung des Themas in prominenten Lehrbüchern der Betriebswirtschaft, Psychologie und Soziologie stellt vielleicht sogar eine Art Widerstand oder Korrektiv der "Etablierten" gegen die rhetorische Aufblähung und Selbstüberschätzung einer "Parvenü"-Disziplin dar, die bei näherer Betrachtung kaum originäre und empirisch alles andere als überzeugend fundierte Beiträge einzubringen hat.
2.3 Qualitätsmanagement und Konzepte der Organisationsforschung
2.3.1 Organisationsdiagnose und -analyse
Die systematische und wissenschaftlich fundierte Zustands- und Prozessbeschreibung von Organisationen kann je nach Zielsetzung und Betrachtungsebene als Organisationsdiagnose oder Organisationsanalyse bezeichnet werden. Während Erstere einen vornehmlich psychologischen Ansatz verkörpert, bei dem das Erleben und Verhalten der Organisationsmitglieder im Vordergrund steht, ist die Organisationsanalyse bislang eine Domäne der Betriebswirtschaft, Organisationssoziologie und Verwaltungswissenschaft und fokussiert auf bedingungsbezogene Aspekte wie Ordnungen und Regeln der Organisation (Büssing, 2004, S. 559). Die Grenzen sind jedoch fließend; speziell für die nordamerikanische Organisationsforschung wird die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Disziplinen als charakteristisch bezeichnet (a.a.O., 2004, S. 561).
Von den wichtigsten Grundkonzepten der Organisationsdiagnose/-analyse (Scholl, 2004, S. 530) werden nachstehend Organisationsstruktur, Organisationskultur und Organisationsklima erörtert. Die Ausführungen werden ergänzt durch ausgewählte empirische Befunde zum Zusammenhang dieser Organisationsvariablen mit dem Erfolg von TQM-Implementierungsprojekten. Damit soll verdeutlicht werden, dass TQM trotz seines Anspruchs, ein integratives Gesamtkonzept der Unternehmensführung zu sein, in der Organisationspraxis vielfach "nur" als eine komplexe Form der Intervention, als ein Aktionsprogramm behandelt wird, dessen Effekte zumindest teilweise von jenen Variablen abhängig ist, die zu fördern TQM sich anheischig macht.
2.3.1.1 Organisationsstruktur
Als Organisationsstruktur bezeichnen Kieser & Kubicek (1992, S. 22) das "System von geltenden Regelungen für die Steuerung von Leistung und Verhalten der Organisationsmitglieder". Bemühungen, primäre Dimensionen für die Synthese verschiedener Strukturvariablen zu bestimmen, konnten bislang nur teilweise empirisch verifiziert werden (Weinert, 1998, S. 608). Ungeachtet der hierfür verantwortlichen methodischen Problematik , erörtert Weinert (a.a.O., S. 611f) folgende Strukturvariablen als die am häufigsten analysierten Organisationsdimensionen:
1. für die Gesamtorganisation:
a) Größe,
b) Konfiguration (steil oder flach),
c) Form (Zentralisiertheit – Dezentralisiertheit; Lokus der Autorität für das Fällen von
Entscheidungen)
2. für die Unter- oder Teilsysteme einer Organisation:
d) Organisationsebene (in der ein/e MitarbeiterIn tätig ist),
e) Hierarchiesystem (Führungskräfte und Untergebene),
f) Kontrollspanne (Anzahl der einem Vorgesetzten untergebenen MitarbeiterInnen),
g) Größe der Unter- oder Teilsysteme.
Tata, Prasad & Thorn (1999) beziehen den Begriff der Organisationsstruktur auf die Art und Weise,
- wie Arbeitsaufgaben formal geteilt, gruppiert und koordiniert werden (a.a.O., S. 442),
- wie Menschen miteinander interagieren,
- wie die Kommunikation fließt und
- Machtbeziehungen definiert sind (a.a.O., S. 441).
Die Organisationsstruktur reflektiert den Autoren zufolge die wertbasierten Entscheidungen des Unternehmens. Solche Werte seien z. B. "Kontrolle" versus "Flexibilität" und korrespondierten mit hierarchisch-zentralisierten bzw. organisch-dezentralen Strukturen (a.a.O., S. 442). Mehrere Studien werden als Beleg dafür angeführt (z. B. Harris & Purdy, 1998; Johannesson & Ritchie, 1997; Crom & France, 1996; Whalen & Rahim, 1994) , dass partizipative und teamorientierte Strukturen – charakterisiert durch Involvement, Empowerment und Verantwortung – die Ergebnisse von TQM verbessern können.
Ungeachtet der Popularität des TQM-Konzepts wird auf Berichte in der Fachliteratur Bezug genommen, wonach nur ein Drittel bis die Hälfte der untersuchten Organisationen signifikante Verbesserungen dadurch erzielt haben (Burdett, 1994; Garvin, 1986; Grant, Shani & Krishnan, 1994). Betont wird, dass dieser Mangel an Erfolg möglicherweise nicht dem Konzept, sondern der zu geringen Beachtung des organisationalen Kontextes zuzuschreiben sei. Da TQM eine veränderte Art des interaktiven Umgangs und Arbeitens in Organisationen bedeute, sei es ein kontextabhängiges Programm, dessen Erfolg zu einem großen Anteil von Faktoren wie Organisationskultur, Marktstruktur, Managementstil und Organisationsstruktur abhänge (Tata et al., 1999, S. 440f).
Tata et al. (a.a.O.) testeten empirisch die Hypothese, dass die Effektivität von TQM-Programmen in Unternehmen mit flexibilitätsorientierten, organischen Strukturen höher sei als in Unternehmen mit kontrollorientierten, mechanistischen Strukturen.
Als UV fungierte die Organisationsstruktur, als AV die über sechs Items ermittelte TQM-Effektivität; als Kontrollvariablen wurden mehrere Qualitätspraktiken erhoben, die sich an den Kriterien des Baldrige Awards – eines amerikanischen Qualitätspreises – ausrichten (z. B. Kundenorientierung, Qualitätsbewusstsein, Personalentwicklung), des Weiteren biographische Variablen, um nur jenen Varianzanteil herauszufiltern, der ggf. der UV zuzurechnen war. Die Stichprobe bestand aus 89 Managern/Supervisoren verschiedener Industriebetriebe.
Die Ergebnisse bestätigten den Zusammenhang zwischen Organisationsstruktur und TQM-Effektivität (Interkorrelation .55); der zusätzlich erklärte Varianzanteil betrug ΔR2 = .11 (a.a.O., S. 447).
Tata et al. (a.a.O., S. 450f) schlussfolgern, dass Unternehmen vor Einführung von TQM-Programmen ihre Organisationsstruktur überprüfen und ggf. verändern sollten, um die Effektivität des Programms zu erhöhen.
2.3.1.2 Organisationskultur
Unter Organisationskultur werden die von den Mitgliedern geteilten Grundannahmen, Werte und Normen in der Organisation verstanden, von denen angenommen wird, dass sie die Gestaltung und Wahrnehmung von Prozeduren, Strategien und Strukturen beeinflussen (Scholl, 2004, S. 538). Organisationskultur äußert sich in verschiedensten Phänomenen und wird vor allem durch qualitative, interpretative Methoden rekonstruiert.
Seitens der Unternehmensberatungsbranche wurden Hoffnungen geweckt, durch geeignete Gestaltung der Organisationskultur einen Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg in der Hand zu haben (a.a.O., S. 526); entsprechend vielfältig sind Bemühungen, durch Maßnahmen des Change Management einen Kulturwandel zu vollziehen. Dabei wird allerdings verkannt, dass die Essenz einer Organisationskultur, zu der auch Rituale, Firmenjargon, die Organisationsgeschichte, Beförderungspraktiken, Sicherheitsstandards u. a. Faktoren gehören, zu einem erheblichen Teil nicht bewusst sind (a.a.O., S. 527)."Organisationskulturen sind zwar Konstrukte, nicht aber konstruierbar"(Türk, 1989, S. 110). Seit Ende der Achtzigerjahre verstärkte Forschung mündete denn auch in der Zurückweisung der (Wunsch-)Vorstellung einer einheitlichen Organisationskultur (Scholl, a.a.O.).
Hamada (2000, S. 296ff.) unterscheidet drei aktuelle Modellvarianten von Organisationskultur, die er durch eine anthropologische Sichtweise ergänzt und im Hinblick auf den Qualitätsdiskurs erörtert:
1. Das Integrationsmodell repräsentiert eine managementzentrierte Perspektive und betrachtet die Qualitätskultur als Teil der Organisationskultur, die es durch Förderung gemeinsamer Werte und Normen vor allem mittels geeigneten Führungsverhaltens zu entwickeln gilt. Es wird ein gesamtorganisationaler Konsens angestrebt, der sich in Bezug auf Qualität als gemeinsame Orientierung artikuliert ("sharing a cognitive view of quality", a.a.O. S. 296). Qualität wird dabei als ein objektivierbares Phänomen verstanden, das zu managen ist (a.a.O., S. 299).
2. Das Differenzierungsmodell betont dagegen die innerorganisatorischen "inconsistencies" und die Möglichkeit, nur innerhalb subkultureller Grenzen Konsens herzustellen. Die Machbarkeit einer qualitätsorientierten Organisationskultur durch das Top Management wird als eingeschränkt betrachtet, weil der gesellschaftliche Kontext starken Einfluss ausübt:
"Current total quality management (TQM) statements fail to argue persuasively why workers should share their ideas with managers if the adoption of innovation and new methods are likely to threaten a worker´s job"(a.a.O., S. 297).
Qualität und Macht werden in dieser soziozentrischen Sichtweise als objektiv gegeben und Qualität als erkämpfbar betrachtet (a.a.O., S. 299).
3. Das Fragmentierungsmodell geht noch über diesen Ansatz hinaus und sieht Ambiguität und Mangel an gemeinsamen Überzeugungen als Wesen der Organisationskultur an, die demzufolge stark durch Unsicherheit und Flüssigkeit charakterisiert wird. Während das Differenzierungsmodell die subkulturellen Grenzen zwischen organisationalen Gruppen betont, verweist das Fragmentierungsmodell auch auf die gruppeninternen Ambivalenzen. Die Bedeutung von Qualität kann danach nur verstanden werden, wenn Position und Geschichte der agierenden Individuen und Gruppen einbezogen werden; Qualität wird als verhandelbar und in ihren Bedeutungen als subjektiv betrachtet (a.a.O., S. 299).
4. Das anthropologische Modell schließlich sieht die Organisation als einen contextualizing process an. Kultur ist dabei eher als "root metaphor" zu verstehen. Danach hat eine Organisation keine Kultur, die es zu verändern gilt, sondern ist eine Kultur im Sinne eines emergenten, kollektiven Prozesses der Sinngebung (meaning configuration, a.a.O., S. 300). In diesem Prozess internalisieren Subjekte eine soziale Grammatik, die es ihnen ermöglicht, Realität als bedeutungsvoll zu erleben. Bezogen auf den Qualitätsdiskurs, führt eine solche Internalisierung dazu, dass Menschen sich bereitwillig dem Qualitäts-Kanon fügen – "commitment to institutionalized ideas (such as quality management)" –, wenn dieser ihrem persönlichen Habitus entspricht; anderenfalls sind Formen der Noncompliance, Sabotage und heimlicher bis offener Widerstand die mögliche Folge (a.a.O., S. 301).
Nerdinger (1994, S. 305ff.) thematisiert in ähnlicher Weise die von Vertretern des Kulturansatzes intendierte Verhaltenskontrolle durch Identifikation und berichtet über entsprechende Maßnahmen von Unternehmen, die jedoch nicht verhinderten, dass sich ein gewisses Widerstandspotenzial seitens der MitarbeiterInnen erhalte. Würden die konkreten strukturellen Bedingungen des Unternehmens dabei ausgeblendet, komme es alsbald zu Widersprüchen zwischen Kulturrhetorik und Praktiken und Regeln des Arbeitsvollzugs; die Folge sei Zynismus.
Der Ansatz von Hamada ist dem sozialkonstruktivistischen Konzept des Sensemaking (Weick, 2000) oder Meaning Making (Dahlberg, Moss & Pence, 1999, s. Kap. 2.4) verwandt und betont stärker als die anderen drei Kulturmodelle die kontextuellen, ganzheitlichen und longitudinalen Aspekte.
Am Beispiel der Entwicklung der japanischen Managementphilosophie illustriert Hamada (a.a.O., S. 302ff.) einen Bedeutungswandel hin zur "ökologischen Exzellenz":
1. conformance to requirements 1950-1960,
2. customer satisfaction 1970-1980,
3. environmentalism 1990-2000.
Hamada (a.a.O., S. 305) weist darauf hin, dass in diesem Zusammenhang neue Begriffe (z. B. kyosei, zu übersetzen als living together) entstanden sind, die eine bestimmte Ideologie transportieren sollen – zero waste, zero emission, flow analysis, sustainable development u. a. – und sich stärker biologischer als ingenieurwissenschaftlicher Analogien bedienen. Abzuwarten bleibe, ob diese neue Managementrhetorik zur ökologischen Qualität von anderen Organisationsmitgliedern geteilt werde.
Über eine Strategie, durch Veränderungen der Organisation auf lange Sicht Veränderungen der Organisationskultur zu bewirken, berichtet Ho (1999). Während traditionelle Strategien für Veränderungsprozesse durch die Schrittfolge
Vision ► Mission ► Verhalten ► Aktion ► Kultur
gekennzeichnet seien, gehe ein neues Paradigma von der Abfolge aus:
Aktion ► Verhalten ► Mission ► Vision ►Kultur (a.a.O., S. 170).
Diese – in erfolgreichen Organisationen häufig anzutreffende – Strategie (Peters & Waterman, 1982, zit. nach Ho, 1999, S. 170) impliziere, dass Aktionen zu Verhaltensänderungen der Beschäftigten führen, weil durch Aktionen Lernprozesse stattfinden. Solche Änderungen könnten z. B. in den Bereichen Wissen, Selbstvertrauen, Flexibilität und Offenheit auftreten und die Organisation insgesamt auf ein dynamischeres und Herausforderungen suchendes Niveau führen. Dies wiederum beeinflusse das Top Management dahingehend, seine Mission und Vision zu definieren und so letztlich eine neue Kultur innerhalb der Organisation zu begründen.
Als bekanntestes Beispiel hierfür wird das japanische Kaizen herangezogen. Die Bedeutung des "close to the scene", des "offenen Büros", des "management by walking around" und der "gläsernen Küche" werden ebenfalls in diesem Zusammenhang betont (a.a.O., S. 170).
Laut Deming (1986) sind 94% aller Qualitätsprobleme durch das Management und das von ihm geschaffene System bedingt (zit. nach Ho, 1999, S. 172). Aus diesem Grunde sei das Commitment des Managements von primärer Bedeutung. Kontinuierliches Lernen in einer lernenden Organisation schaffe hierfür die besten Voraussetzungen.
2.3.1.3 Organisationsklima
Organisationskultur und Organisationsklima sind nicht klar voneinander abzugrenzen und nehmen beide auf Merkmale Bezug, die auf Kommunikation und Kooperation aufbauen (Moran & Volkwein, 1992, zit. nach Büssing, 2004, S. 589). Während Organisationskultur jedoch auf das Besondere und Typische einer Organisation fokussiert, das oft nicht explizit benannt und reflektiert wird (Scholl, 2004, S. 539), ist Organisationsklima als Wahrnehmung wichtiger Facetten einer Organisation durch ihre Mitglieder operational definiert und wird quantitativ durch dimensional vorstrukturierte Fragebögen erfasst (a.a.O.).
Emery, Summers & Surak (1996, S. 485) verstehen Organisationsklima als ein relativ stabiles Charakteristikum von Organisationen, das sich in den Einstellungen und Beschreibungen von Beschäftigten niederschlägt, wie sie die Politik, Praxis und Bedingungen ihrer Arbeitsumgebung erleben . Danach kann ein solches Klima betrachtet werden "as a measure of whether people´s expectations about what it should like to work in an organization are being met"(Schwartz & Davis, 1981, S. 31). Klima wird somit als eine Erscheinungsform von Kultur aufgefasst, wobei Letztere gewöhnlich als ein tiefergehendes, weniger bewusst empfundenes Set von Bedeutungen definiert wird (Reichers & Schneider, 1990, zit. nach Emery et al., 1996, S. 485).
Das in der Fachliteratur berichtete häufige Scheitern von TQM-Programmen (z. B. Erickson, 1992; Fuchsberg, 1992; Kendrick, 1993; Doyle, 1992) – die Rede ist von bis zu zwei Dritteln Misserfolge – wird gewöhnlich Defiziten in folgenden Bereichen zugerechnet (Emery et al., 1996, S. 484f):
- gemeinsame Vision (shared vision),
- Anwendungsplanung (application planning),
- organisationales Commitment,
- Training,
- Belohnungssysteme (reward systems),
- Empowerment,
- interfunktionelle Integration (cross-functional integration).
Ungeachtet der Bedeutung dieser Faktoren für eine Internalisierung des TQM-Konzepts, halten Emery et al. (a.a.O.) es für möglich, dass ihnen eine fundamentale Determinante zugrunde liegt: das Bedürfnis nach einem förderlichen Organisationsklima. Während die Bedeutung einer TQM-typischen Kultur (z. B. Kundenorientierung) vielfach diskutiert worden sei, habe niemand die Effekte präimplementationeller klimatischer Faktoren empirisch untersucht. Bezug nehmend auf Schwartz & Davis (1981) wird betont, dass ein Klima, welches mit den angestrebten Veränderungen inkompatibel ist, ein hohes Maß an Widerstand auslösen und noch so gut geplante Veränderungsprozesse zum Entgleisen bringen könne. Die Literatur zum Change Management belege ebenfalls, dass eine erfolgreiche Implementation von TQM von einem innovationsförderlichen Arbeitsklima abhänge (z. B. Kim, 1989; Senge, 1990; Glover, 1993), welches den notwendigen atmosphärischen Rahmen für Lernprozesse abgebe. Hierfür müssten Beschäftigte jedoch ein Klima des Vertrauens spüren, bevor sie maximales Commitment für TQM entwickeln können (Emery et al., 1996, S. 485f).
Auf diesem Literatur-Review basierend, untersuchten Emery et al. die Hypothesen,
1. dass die Wahrnehmung des Organisationsklimas durch Beschäftigte in Unternehmen mit erfolgreicher TQM-Implementierung günstiger ist als bei nicht erfolgreichen TQM-Implementierern;
2. dass die Wahrnehmung des Organisationsklimas durch Beschäftigte sich während der TQM-Implementierung verbessert.
Anhand einer Sekundäranalyse eines an 15.722 Beschäftigten verschiedener Unternehmen der amerikanischen Luftfahrtindustrie erhobenen Datenpools (1. Messung vor, 2. Messung acht Monate nach Beginn der TQM-Implementierung) wurden 12 von insgesamt 50 Items als relevant für die Fragestellung ausgewählt (co-workers´ level of commitment to success, organization´s respect for the individual, level of interdepartmental cooperation, quality of training and development, company´s usage of employee skills, rewarding of good performance, quality of direct supervision, clarity of company goals and objectives, willingness of employees to reveal problems, upward communication/company´s willingness to listen and take action, fair application of organizational policies, flow of information within the company).
Es zeigten sich im Sinne der Hypothese 1 hochsignifikante Zusammenhänge zwischen der Güteeinschätzung des jeweiligen Klimafaktors durch die Beschäftigten und der Zugehörigkeit zur Gruppe der erfolgreichen bzw. erfolglosen TQM-Implementierer (Chi-Quadrat-Tests, p. < 0.001).
Ebenso bestätigte sich die in Hypothese 2 formulierte Erwartung, wonach sich im Verlaufe des TQM-Prozesses die Einschätzung des Klimas durch die Beschäftigten verbessert (t-Tests für abhängige Stichproben, p < 0.001). In 11 von 12 Items lagen die Klimaeinschätzungen bei den letztlich erfolgreichen TQM-Implementierern jedoch schon vor der Implementierung höher als bei den Erfolglosen (aus statistischen Gründen waren dort auch die Zuwachsraten relativ größer als bei den Erfolgreichen). Dies wird als Hinweis darauf gewertet, dass Organisationen einen bestimmten "Zündpunkt" (flashpoint) besitzen, ab dem TQM-Programme ihre Wirksamkeit entfalten können (a.a.O., S. 493).
Die Ergebnisse stützen nach Ansicht der Autoren die Annahme, dass der Wahrnehmung interner Trainings- und Entwicklungsmaßnahmen durch die Beschäftigten und einem Klima hohen Vertrauens Schlüsselfunktionen für nachhaltiges organisationales Lernen zukommt (a.a.O., S. 489f).
Wenngleich bereits die bloße Implementierung von TQM Klimaverbesserungen zur Folge haben könne, hätten Organisationen mit schlechtem Klima ein hohes Misserfolgsrisiko angesichts der Zeit und Mühen, die mit der Internalisierung von TQM verbunden seien. Vorgeschaltete Maßnahmen zur Klimaverbesserung seien unter Umständen notwendig, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen (a.a.O., S. 493). Hierfür empfehle sich der Einsatz von Klima-Fragebögen, Teamentwicklungsmaßnahmen, Problemlöse-Seminaren und verstärkter interfunktioneller Integration in der Präimplementationsphase (a.a.O., S. 494).
Nerdinger (1994, S. 318) betont im Zusammenhang mit der Herstellung eines "Dienstleistungsklimas", dass hierfür an den Praktiken und der Struktur der Organisation angesetzt werden müsse, um die Arbeit der Dienstleister zu unterstützen. Der Autor hält ein solches Verständnis von Dienstleistungsklima für besser geeignet als die Steuerung von Verhalten über die Manipulation von Symbolen – wie es das Konzept der Dienstleistungs kultur (keine Hervorhebung im Original, P. G.) nahe lege –, um bloßes organisationales "Impression Management" zu überwinden.
2.3.2 Organisationsentwicklung und Change Management
Während der Begriff der Organisations diagnose oder -analyse auf die Beschreibung von Strukturen, Prozessen und Ergebnissen, mithin auf die Erhebung und Darstellung quantitativer und qualitativer Befunde abzielt, stehen bei der Organisations entwicklung Fragen umfassender und bewusst gesteuerter Veränderungen durch methodisch angelegte Interventionen im Vordergrund (vgl. Gebert, 2004, S. 601).
Organisationsentwicklung (OE) ist ein Oberbegriff für geplante Maßnahmen mit dem Ziel verbesserter Anpassung an sich wandelnde Aufgaben und Umweltbedingungen, z. B. rechtlicher, sozialer und technologischer Art. OE ist oft mit einer Neudefinition des Unternehmensleitbildes und administrativer Umstrukturierung verbunden (Flösser & Otto, 1992, S. 9ff.). Es handelt sich zumeist um längerfristig angelegte, oft mehrjährige Veränderungsprozesse, die neben den Personen die sie umgebende Situation zu integrieren versuchen und häufig extern begleitet werden (Greif, 1998, S. 600).
Kennzeichnend für OE ist, dass Veränderungen der ganzen Organisation und nicht nur einzelner Abteilungen oder Gruppen angestrebt werden. Rationalisierungsprojekte, die ausschließlich auf eine Erhöhung der Produktivität abzielen, zählen gemeinhin nicht dazu. Vielmehr soll durch die Konzipierung und Implementation geeigneter Arbeits-, Führungs- und Kooperationsformen ein hohes Maß an Commitment sowie eine hinreichende Effektivität aller Abläufe sichergestellt werden. Darüber hinaus geht es darum, die Lernfähigkeit einer Organisation bzw. ihre Flexibilität und Innovationsbereitschaft zu stärken (Gebert, 2004, S. 601). Nach diesem Verständnis zielt OE sowohl auf mitarbeiterbezogene Ziele (Humanität, Verbesserung der Arbeitssituation, Partizipation), als auch auf organisationsbezogene Wirkungen (Leistungsfähigkeit, Effektivität, vgl. J. F. W. Müller, 2004, S. 80f).
Die im Rahmen der OE durchgeführten Interventionen sind am Modell der Aktionsforschung orientiert und insofern eine spezifische Form des Change Management (Gebert, a.a.O., S. 602), der zielgerichteten Steuerung und Bewältigung von Veränderungen durch Konzepte, Prozesse und Werkzeuge (vgl. Czichos, 1990). Dabei lassen sich die verschiedenen Ansätze grob klassifizieren in einen personalen und strukturalen. Während jener die angestrebten Organisationsveränderungen vor allem über eine Steigerung der sozialen und fachlichen Kompetenz der Akteure zu erreichen versucht (z. B. durch gruppendynamische Trainings und Weiterbildung), bestehen die wesentlichen Strategien des strukturalen Ansatzes in Formen der Arbeitsgestaltung (z. B. job enrichment, Installierung teilautonomer Arbeitsgruppen). Organisationen werden dabei als soziotechnische Systeme betrachtet, in denen technologische, arbeitsorganisatorische und soziale Prozesse vernetzt sind (Gebert, a.a.O.).
Die Grenzen zwischen OE und Personalentwicklung (PE) sind fließend; auch die personalen und strukturalen Ansätze innerhalb der OE sind komplementär zu verstehen, nicht alternativ. Leitungs- und Führungskräften kommt in OE-Prozessen vor allem eine Multiplikationsfunktion zu, "… indem sie – mit neuen Kompetenzen ausgerüstet – durch verbesserte Kommunikations- und Kooperationsstrukturen zu einer aktivierenden Organisationskultur beitragen sollen"(Flösser & Otto, 1992, S. 12).
Greift die Organisation im Rahmen ihres geplanten Entwicklungsprozesses auf externe Berater (change agents) zurück, so vollzieht sich dies zweckmäßigerweise nicht in Analogie zum Arzt-Patienten-Verhältnis, in dem der Experte präzise inhaltliche Empfehlungen ausspricht. Vielmehr wird eine diskursähnliche Kommunikationsstruktur zwischen Beratern und dem zu beratenden System für angemessen gehalten, die sich am Modell der Tat- bzw. Aktionsforschung orientiert und die Expertenrolle eher als Prozessberatung in teilnehmender und moderierender Funktion akzentuiert (Gebert, 2004, S. 603). Allerdings gerät ein derartiges Selbstverständnis häufig in Konflikt mit konkreten Lösungserwartungen der Auftrag gebenden Organisation, so dass zu Beginn des Beratungsverhältnisses eine allseitige Interessenpräzisierung unabdingbar ist.
Im Zusammenhang mit der Gefahr, dass langfristig und partizipativ angelegte Veränderungsprozesse versanden, kristallisierte sich in den Neunzigerjahren eine alternative Veränderungsstrategie des Change Managements heraus, die keinen allmählichen und inkrementellen, sondern einen radikalen und irreversiblen Wandel anstrebt (Business Reengineering). Dieser Ansatz, der zugleich eine völlig andere Rolle des Beraters erfordert, verlässt allerdings den Boden der Aktionsforschung (a.a.O., S. 604).
Unabhängig von der Frage, ob der Veränderungsprozess mit Hilfe externer Beratung eingeleitet werden soll, bedarf es innerorganisatorischer Vorkehrungen, diesen Prozess zu steuern. Paritätisch besetzte Lenkungskomitees unterstreichen in der Regel den auch politischen Charakter einer OE und signalisieren wirkungsvoll die Einbeziehung des Topmanagements. Die auf Kurt Lewin zurückgehende Datenrückkopplung des survey feedback, bei dem Analyseergebnisse über den Status quo der Organisation allen MitarbeiterInnen zugänglich gemacht werden, ist eine verbreitete Methode zur Integration der Betroffenen (Greif, 1998, S. 600), an die sich Teamentwicklungsprozesse und Aktionsplanungen anschließen lassen. Eine zeitlich oder inhaltlich forcierte Partizipation der Belegschaft setzt mitunter allerdings eine Veränderungsdynamik frei, die aus Sicht der Führungsspitze als bedrohlich empfunden werden kann und nicht selten Strategien des Machteinsatzes herausfordert (Gebert, a.a.O., S. 605f).
Die gerade in differenzierten Organisationen notwendige Integration der verschiedenen Subsysteme weist der Kommunikation eine zentrale Rolle im OE-Prozess zu. Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit sollen vielerorts eine an gemeinsamen Grundüberzeugungen orientierte Organisationskultur manifestieren, in der Vertrauen neben einer normativen zunehmend auch zu einer ökonomischen Kategorie avanciert: Vertrauen stellt "Sozialkapital" dar und erleichtert die Ausschöpfung des "Humankapitals"(a.a.O., S. 607).
Grenzen der OE ergeben sich aus der beschränkten Planbarkeit und Steuerbarkeit betrieblicher Wandlungsprozesse in einer zunehmend turbulenten Organisationsumwelt. Häufig werden Effekte der Partizipation überschätzt, da Veränderungen stets nicht nur Verbesserungen, sondern auch Verluste darstellen (z. B. führen "Öffnungsprozesse" wie Dezentralisierung zu einem Verlust an Sicherheit und Ordnung). Vor diesem Hintergrund kommt es darauf an, mit widersprüchlichen Organisationsmustern, Dilemmata und Paradoxien leben zu lernen und diese als wesentliche Managementanforderung zu begreifen (vgl. Grunwald, 2006). Eine wichtige Voraussetzung für solche Lernprozesse wird darin gesehen, valide miteinander zu kommunizieren, um zumindest die vorhandenen Steuerungs-potenziale ausschöpfen zu können (Gebert, a.a.O., S. 615).
Zollondz (2001, S. 323ff.) betont die Relevanz von OE-Ansätzen für die Implementation von QM und führt die weitgehende Abstinenz in Theorie und Praxis des QM auf die Dominanz der Ingenieurinteressen und der ihnen affinen Umsetzungsstrategien zurück. In der Tat ist OE bis heute eine Domäne der Psychologie und Soziologie, während umgekehrt QM vorwiegend in den Fachdisziplinen der Ingenieur-, Arbeits- und Wirtschaftswissenschaften angesiedelt ist.
Der Entwicklungsaspekt von Unternehmen spielt in allen universellen QM-Systemen eine zentrale Rolle. So betont das graphische Modell der ISO 9001:2000 (Deutsches Institut für Normung, 2000) die Einbettung der Strukturelemente Management-Verantwortung, Ressourcen-Management, Prozessmanagement und Bewertung und Analyse in einen Regelkreis aus Kundenanforderungen, ständiger Verbesserung des QM-Systems und Kundenzufriedenheit. Das EFQM-Excellence-Modell (Kirstein, 2000) verdeutlicht den gleichen Sachverhalt durch ein Innovation und Lernen genanntes Systemelement, welches beim Integrierten Qualitätsmanagement nach dem St. Galler Konzept (Seghezzi, 1996) als Unternehmensentwicklung firmiert. Das Konzept des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses schließlich rekurriert explizit auf diesen Aspekt.
Bereits 1989 schlug Maelicke (S. 67ff.) eine Vorgehensweise für ganzheitliche und sozialökologische Organisationsentwicklung in Non-Profit-Organisationen vor, bei der er folgende Aufgaben unterschied:
1. Entwicklung eines Leitbildes, einer Unternehmensphilosophie, einer corporate identity,
2. Zielfindung,
3. Aufgabendefinition,
4. Aufbau- und Ablauforganisation,
5. Führungs- und Mitarbeiterverhalten,
6. Soziale Infrastrukturentwicklung, Vernetzung,
7. Projektmanagement,
8. Sozial-Marketing,
9. Evaluation und Fortschreibung,
10. Förderung der Selbstorganisation.
Bemerkenswert ist dabei, dass dieser Katalog nicht nur die dem oben genannten Verständnis von OE entsprechenden Interventionen aufnimmt, sondern sich darüber hinaus wie ein Aufgabenmodell der kunden-, mitarbeiter- und gesellschaftsorientierten Unternehmensführung schlechthin liest, sieht man einmal von der vernachlässigten Ressourcen-Kategorie ab.
Ein späteres Resümee teilweise vorwegnehmend, soll das Beispiel verdeutlichen, dass QM – sei es als Partialkonzept innerhalb der Unternehmensführung oder als integratives Gesamtkonzept für alle Managementbereiche im Sinne des TQM verstanden –, von seiner Fokussierung auf Qualität und der Verbreitung einschlägig verwendbarer Instrumente abgesehen, keine wesentlich neuen Impulse in die Organisationsforschung einbringt, sondern Ansätze eklektisch in qualitätsspezifischer Weise konfi-guriert.
2.3.3 Personalentwicklung und Human Resource Management
Personalentwicklung (PE) wird als Oberbegriff für ein breites, schwer abgrenzbares Spektrum von Maßnahmen zur Analyse, Planung, Förderung und Evaluation des personellen Potenzials einer Organisation verstanden (Greif, 1998b, S. 623). In einer Zeit beschleunigten technologischen und ökonomischen Wandels soll PE berufliche Handlungskompetenzen erweitern bzw. verbessern und zur Qualifikationsanpassung an gegenwärtige und zukünftige Anforderungen beitragen. Insofern stellt PE eine strategische Komponente des Human Resource Management dar (Cascio, 1992), dem als übergeordnetem Begriff auch diverse Schlüsseltechniken eines QM-Systems zugeordnet werden können (Ichniowski & Shaw, 2000, S. 364). Holling & Liepmann (2004, S. 349) betonen, dass insbesondere Veränderungen des Wissens sowie kognitive und interpersonale Kompetenzen Gegenstand der gegenwärtigen PE sind.
Die Entwicklung des betriebswirtschaftlichen Personalwesens zum aktiven Personalmanagement als integrativem Bestandteil eines gesamtorganisatorischen Unternehmensführungsmodells kennzeichnet den Ansatz des Human Resource Management, zu dessen Handlungsfeldern Personalführung, -motivation, -beschaffung und -entwicklung gezählt werden (J. F. W. Müller, 2004, S. 128ff.).
Zur PE gehören vor allem betriebliche Weiterbildung im Sinne von Anpassungsqualifikation – während die Ausbildung als Erstqualifikation eine Domäne pädagogischer Disziplinen ist (a.a.O.) – , Trainee- und Feedback-Programme, Supervision, Coaching und Formen der Beratung, aber auch Maßnahmen der Arbeitsgestaltung, Einführung, Einsatz- und Karriereplanung der MitarbeiterInnen. Von PE abgegrenzt werden von den meisten AutorInnen Prozesse ungeplanten Lernens und beruflicher Sozialisation sowie Ansätze, die darauf abheben, Ziele durch Personalselektion, technologische oder organisationsstrukturelle Veränderungen zu erreichen (Staufenbiel, 1999, S. 510). Stehen die gesamte Organisation oder größere Einheiten im Blickpunkt, spricht man zumeist von Organisationsentwicklung (OE, s. o.).
Wenngleich in der Praxis häufig punktuell und nicht im Rahmen einer abgestimmten Konzeption betrieben, gehören unter systematischen Gesichtspunkten folgende Phasen unabdingbar zu einer PE dazu (Staufenbiel, 1999; Holling & Liepmann, 2004):
1. Bedarfsanalyse:
- Organisationsanalyse (u. a. Festlegung der Grobziele, Prüfung der Indikation und alternativer Maßnahmen);
- Analyse des Soll-Zustandes (u. a. Analyse der Aufgaben- und Qualifi-kationsanforderungen, individuelle Laufbahnberatungen);
- Analyse des Ist-Zustandes (u. a. Eignungsdiagnostik, Leistungsbeurteilung, Assessment Center, 360°-Feedback);
- Soll-Ist-Vergleich und ggf. Interventionsplanung;
2. Interventionen (u. a. Durchführung von Maßnahmen, s. u.; Gestaltung der Kontextbedingungen);
3. Evaluation (u. a. Festlegung von Erfolgskriterien, Versuchsplanung und Datenauswertung).
Methoden der Personalentwicklung (Holling & Liepmann, 2004, S. 359)
- traditionelle Unterrichtsformen (Frontalunterricht, Vortrag) mit oder ohne Einbezug von Gruppendiskussionen und/oder Übungsaufgaben in Form von Einzel- oder Kleingruppenarbeit,
- individuelle Aneignung von Wissen und Fertigkeiten (z. B. Studium von Fachliteratur),
- computergestütztes Training (mit unterschiedlicher Interaktivität – vorwiegend für die Vermittlung von Wissensinhalten und kognitiven Fertigkeiten eingesetzt),
- Vier-Stufen-Methode (Vorbereitung, Vorführung, Ausführung und Abschluss – vorwiegend zum Erwerb einfacher Tätigkeiten eingesetzt),
- Cognitive Apprenticeship (interaktive Lernmethode zwischen Experten und Novizen – vorwiegend zum Erwerb kognitiver Strategien eingesetzt),
- Lernen anhand heuristischer Regeln (spezielle Methode des selbstgesteuerten Lernens – vorwiegend für den Erwerb allgemeiner Problemlösestrategien eingesetzt),
- Fallstudien, Rollen- und Planspiele (Simulationsverfahren zur Ausarbeitung realitätsnaher Lösungsvorschläge, Einstellungs- und Verhaltensänderung),
- Sensitivitätstraining (gruppendynamisches Verfahren zur Förderung sensiblerer Selbst- und Fremdwahrnehmung),
- Verhaltensmodellierung (mit den Komponenten Modellierung, Behaltensprozess, Verhaltenswiederholung, Feedback und Trainingstransfer – hochwirksame Methode zum Erlernen neuer Verhaltensweisen),
- Coaching und Mentoring (aufgabenbezogene bzw. generelle Kompetenzentwicklung auf der Basis persönlicher Unterstützung durch Coach bzw. Mentor).
Angesichts der abnehmenden Halbwertzeit von Wissensinhalten kommt dem Lernen des Lernens und kognitiven Heuristiken oder anderen generellen Strategien der Personalentwicklung immer größere Bedeutung zu. Dabei besteht jedoch in der entsprechenden Grundlagenliteratur mittlerweile Einmütigkeit darüber, dass das Erlernen effektiver Problemlösestrategien nur domänenspezifisch, d. h. anhand bestehender Wissensbestände auf einem bestimmten Gebiet erfolgen kann (a.a.O., S. 354). Inhaltsleere Trockenübungen zur Vermittlung bestimmter Strategien oder Techniken zur Problemlösung sind demzufolge relativ nutzlos.
Betont werden muss auch, dass es sich bei den so genannten Schlüsselkompetenzen, deren Entwicklung zahlreiche PE-Veranstaltungen explizit gewidmet sind, um populärwissenschaftlich umbenannte generelle Persönlichkeitsmerkmale handelt, die zu verändern im Rahmen zeitlich beschränkter Fördersettings für relativ aussichtslos gehalten wird (a.a.O., S. 352f). Personen, die nur über Minimalausprägungen dieser Merkmale verfügen, sind möglicherweise mit Selektions- und Plazierungsinterventionen besser bedient.
Metaanalysen zur Evaluation von PE-Maßnahmen belegen im Übrigen eine relativ hohe Wirksamkeit, namentlich von Trainings- und Anleitungsmaßnahmen. Effektive und nachhaltige PE bedarf jedoch einer Einbettung in ein umfassendes Personalmanagement, um sicherzustellen, dass erworbene Kompetenzen auch im beruflichen Alltag abgerufen werden können.
Die Affinität von PE-Konzepten zum Qualitätsmanagement ist außerordentlich stark und wird auch in der produzierenden Erwerbswirtschaft anerkannt:
"Je weiter sich … das Produkt der Arbeit vom Rohstoff entfernt, je höher also sein Veredelungsgrad ist, desto ausschließlicher bestimmt die Güte der Arbeit die Güte des Resultats. In einem rohstoffarmen, hochindustrialisierten Land wie Deutschland … wird Qualitätsmanagement folglich immer Personalmanagement sein. Die Qualifikation des einzelnen ist es, die hier in hohem Maße über den Erfolg des Gesamten bestimmt"(Ehrhart, o. J., S. 4).
Personalentwicklung bzw. Human Resource Management als übergeordneter Begriff, der auch Maßnahmen wie Selektion und Plazierung umfasst (s. o.), gehört damit zu den Kernbereichen eines QM, zumal in sozialwirtschaftlichen Organisationen.
2.3.4 Mitarbeiterbeteiligung und Empowerment
Das Konzept der Mitarbeiterbeteiligung ist in der Organisationsforschung wie kaum ein anderes mit normativen, moralischen und ideologischen Ansprüchen belastet (Antoni, 1999, S. 569). Programmatisch als Kriterium humaner Arbeit gefordert und rechtlich verbrieft im Rahmen des Betriebsverfassungs- und Mitbestimmungsgesetzes, wurde Mitarbeiterbeteiligung auch als eines der "Geheimnisse" japanischen Wirtschaftserfolgs entdeckt und als Mittel zur Erhöhung unternehmerischer Wertschöpfung propagiert (a.a.O.).
Im organisationspsychologischen Kontext wird das Konzept vor allem unter den Begriffen Delegation und Partizipation untersucht. Delegation wird in der Regel als Übertragung von Zuständigkeiten, Leistungen, Befugnissen und Entscheidungskompetenzen verstanden; Partizipation meint die Teilhabe, Teilnahme oder Beteiligung an Problemlösungs- und Entscheidungsprozessen. Partizipation impliziert nach diesem Verständnis eine Einfluss- bzw. Machtteilung, während Delegation eine einseitige Einflussnahme und Machtausübung vorsieht (Leana, 1987). Die Begriffe sind häufig nicht klar voneinander abzugrenzen, z. B. dann, wenn Entscheidungsbefugnisse an eine Gruppe delegiert werden. Bezugspunkt der Delegation ist dann die Gruppe, Subjekt der Partizipation das Gruppenmitglied (Antoni, 1999, S. 571).
Zur Veranschaulichung eines Kontinuums von Mitwirkungsmöglichkeiten bezieht sich Antoni (a.a.O., S. 570) auf eine Abstufung von Dachler & Wilpert (1978):
-keine Mitsprachemöglichkeiten,
-Informationsrechte,
-Vorschlagsrechte,
-Mitbestimmungsrechte,
-Vetorechte,
-völlige Autonomie.
Wenngleich die empirischen Befunde zu den Auswirkungen von Entscheidungsdelegation und autonomieorientierter Arbeitsgestaltung keineswegs einheitlich sind, zieht Antoni (a.a.O., S. 574) z u den Effekten und Wirkungsmechanismen von Mitarbeiterbeteiligung das folgende positive Fazit:
"... höhere Arbeitsleistung und Mitarbeiterzufriedenheit ... sind insbesondere bei komplexen Arbeitsaufgaben zu erwarten, wenn sich die Mitarbeiter an der Entwicklung der Bearbeitungsstrategien beteiligen und eigene Informationen einbringen können. Dies wird mit einem verbesserten vertikalen Informationsfluss, einer besseren Ausnutzung, Integration und letztlich einer Weiterentwicklung von Wissen sowie einem größeren Problem- bzw. Arbeitsverständnis seitens der Mitarbeiter erklärt ... Die Einbindung von Mitarbeitern in Planungsprozesse erleichtert die Entwicklung aufgabenangemessener Bearbeitungsstrategien und Handlungsschemata. Diese ermöglichen es den Mitarbeitern, auf unerwartete Störungen oder eine Veränderung der Rahmenbedingungen frühzeitig (antizipativ) und adäquat zu reagieren und gegegebenfalls alternative Bearbeitungswege zu entwickeln und einzuschlagen, ohne ständig Rücksprache mit dem Vorgesetzten nehmen zu müssen. Damit sind auch wesentliche Voraussetzungen für die effektive Delegation von Aufgaben mit Planungs-, Entscheidungs- und Kontrollkompetenzen gegeben."
Wie Scholl (2004, S. 546) betont, sind die Vorteile partizipativer Entscheidungen für die Beteiligten und die Organisation seit Langem bekannt, so dass es zunächst verwunderlich erscheint, warum diese Vorteile immer wieder neu entdeckt werden müssen und in der Praxis so oft vernachlässigt werden. Im Hinblick auf die erforderlichen Veränderungen von Machtstrukturen in Organisationen kann man allerdings vermuten, dass die Propagierung solch anspruchsvoller Konzepte oft nur ein zeitgeistiges Lippenbekenntnis ist und Führungskräfte nicht wirklich an einer Teilung ihrer Macht interessiert sind. Auf dem Verordnungswege und im Rahmen eines technizistischen Verständnisses von Führung lassen sich jedenfalls entsprechende Veränderungen der Organisationskultur nicht bewerkstelligen; vielmehr scheint es sinnvoll, Konzepte der Mitarbeiterbeteiligung auch partizipativ zu entwickeln und umzusetzen (Antoni, 1999, S. 581).
Auf Grenzen der Partizipation, was die Kompensierung potenziell mit Organisationsveränderungen einhergehender Verluste anbetrifft, wurde bereits beim Stichwort "Organisationsentwicklung" hingewiesen.
Welch entscheidende Rolle die Mitarbeiterbeteiligung für die erfolgreiche Umsetzung von QM-Systemen spielt, verdeutlicht ein Kommentar von Zollondz (2002). Mit Bezug auf die Kybernetik und ihre Unterscheidung von wohl-definierten (trivialen) und schlecht-definierten (nicht-trivialen) Systemen wird betont (S. 351ff.), dass Menschen schlecht-definierte Systeme seien. QM sei nun vermeintlich das ideale Werkzeug, die [aus diesem Grunde, P. G.] zahllosen Fehlerquellen zu eliminieren. Mittels TQM wohl-definierte, rational reagierende Systeme zu schaffen und nichts dem Zufall überlassen zu wollen, wird jedoch nicht für erstrebenswert gehalten. Zwar würden viele Organisationen genau dies intendieren, müssten aber nach der Zertifizierung merken, dass nicht alles "wie geschmiert" laufe, weil die Menschen nicht mitspielten. MitarbeiterInnen wollten nämlich nicht wohl-definiert sein, sondern herausgefordert werden, sie wollten selbst mitdefinieren, mitentscheiden, mitverantworten.
Mit dieser Bemerkung zu den Grenzen vorgegebener, standardisierter Handlungsabläufe im Rahmen des QM ist eine Brücke zu einem Konzept geschlagen, das sich in Profit- und Nonprofit-Organisationen gleichermaßen großer Aktualität erfreut: Empowerment.
Mit dem Begriff des Empowerment wird allgemein die Er- oder Bemächtigung bzw. Befähigung von Menschen bezeichnet. Es handelt sich einerseits um ein Konzept zur Beschreibung psychologischer Konstrukte (z. B. Gefühle und Einstellungen gegenüber einer Organisation oder Rolle), andererseits um ein Set von Maßnahmen, diese Gefühle und Einstellungen zu fördern (vgl. Wall, Cordery & Clegg, 2002, S. 147). Durch Einführung solcher Maßnahmen (z. B. job enrichment, Teamarbeit, TQM-Projekte) sollen Partizipation, Verantwortungsübernahme und Selbstbefähigung als wichtige humane Ressourcen erschlossen werden, um letztlich im Interesse optimierter Systemfunktionalität Ergebnisse und Zufriedenheit zu verbessern.
Wenn auch der Begriff selbst relativ neu ist, so sind wesentliche Bestandteile des Empowerment-Konzepts "alte Bekannte" der Organisationspsychologie und Betriebssoziologie (z. B. Quality of Work Life -Bewegung in den USA, Forschungen zur Arbeitszufriedenheit und zum Transparenzerleben, Mitarbeiterbeteiligung, s. o.). Nerdinger (1994, S. 271f) versteht darunter im Kern die Übertragung des herkömmlichen arbeitspsychologischen Konzepts des Handlungsspielraums auf die Situation von Dienstleistern. Dem nunmehr stark popularisierten Ansatz wird im Wirtschaftsbereich ein großes Potenzial unterstellt, mitunternehmerisches Denken und Handeln auf allen betrieblichen Ebenen zu entwickeln und damit den Herausforderungen einer sich ständig wandelnden Organisationsumwelt zu begegnen.
Auch im Sozialbereich wurde das Empowerment-Konzept von der professionellen Kultur wohlwollend aufgenommen,
- um Selbstkontrolle kranker Menschen und Unabhängigkeit von professionellen Versorgern zu fördern (Hellerich & White, 2003, S. 36),
- um burning out von SozialarbeiterInnen vorzubeugen (Flösser & Otto, 1992, S. 13; bezogen auf Transparenz und Mitwirkung an der organisationellen Entscheidungsbildung),
- um Potenziale der Selbstorganisation und des gemeinschaftlichen Handelns zu fördern (Stark, 1996, S. 159),
- um bürgergesellschaftliche Antworten auf neue soziale und demokratische Fragen zu liefern (Keupp, 1998),
- um Qualitätsmanagement in den Einrichtungen und Diensten lebendig umzusetzen (Bobzien, Stark & Straus, 1996, S. 24).
Kritik am Ansatz des Empowerments wird zum einen aus Sicht der Praxis geübt (Hellerich & White, 2003, S. 37), die auf zahlreiche Umsetzungsprobleme und Widersprüchlichkeiten hinweist, darunter auch im Zusammenhang mit dem Compliance genannten Sachverhalt, bei dem sich der Anspruch auf Selbstbefähigung an moderner professioneller Rationalität stoße (hier: Befolgung ärztlicher Anweisungen). Zum anderen wird Kritik am methodischen Individualismus des Empowerment-Konzepts geübt, in dem sich ein Wandel in den Strategien der Macht und Mächtigen widerspiegele (a.a.O., S. 37).
Unter Bezug auf Foucault (1976), der vom Wandel einer repressiven zu einer produktiven Machtstrategie spricht, konstatieren Hellerich & White (S. 38):"Die Machtsuchenden werden durch Empowerment-Strategien kontrolliert, die ihre machtbetonten Bestrebungen in die gesellschaftlich akzeptablen Formen der Selbstverwirklichung und steigender Arbeitsproduktivität kanalisieren." Am Beispiel der Psychiatrie-Selbsthilfebewegung wird zu zeigen versucht, wie stattdessen ein postmodernes Verständnis von Empowerment als Modell einer selbstbestimmten Subjektivität und sozialen Ökologie der Beziehungen funktionieren könnte (a.a.O., S. 40f).
Wall et al. (2002) weisen in einer theoretischen Untersuchung nach, dass die universalistische Annahme einer Leistungssteigerung durch Empowerment nicht zutrifft und die Effektivität von Empowerment-Maßnahmen kontextabhängig und kontingent zum Ausmaß der bestehenden "operational uncertainty" ist. (Nerdinger, 1994, S. 274, spricht in gleichem Zusammenhang von "riskanten" Dienstleistungen.) Solche Unsicherheit resultiert in Variabilität und Mangel an Vorhersehbarkeit in den Arbeitsvollzügen und Anforderungen, einschließlich der Frage, was zu tun ist und auf welche Weise (Wall et al., a.a.O., S. 151). Angesichts der noch fehlenden empirischen Evidenz formulieren die Autoren ein vorsichtiges Fazit:
"Where the focus is on performance, initiatives to empower employees with respect to the execution of their core task are likely to be effective given a high level of operational uncertainty, but will be of much less value (and perhaps none) where work processes are more predictable and well understood. In contrast, initiatives to empower employees with regard to wider role responsibilities are likely to yield productivity benefits irrespective of the prevailing levels of operational uncertainty"(a.a.O., S. 164).
Ähnlich argumentiert Argyris (1998). Ausgehend von einer begrifflichen Unterscheidung von außen- und innengeleitetem Engagement, betont er , dass äußeres Engagement als vertraglich verabredete Pflichterfüllung eine Form des Anpassungsverhaltens darstelle, mit dem viele Mitarbeiter in den meisten Arbeitsumgebungen bestens zurechtkämen (a.a.O., S. 12). Am Beispiel des Reengineerings, das sich programmatisch zumeist dem Empowerment verwandter Floskeln bedient, weist Argyris (a.a.O., S. 9) darauf hin, dass Forschung und Praxis schließen lassen, diese Form des Transformationsmanagements sei dann am erfolgreichsten, wenn Aufgaben genauestens vorgegeben würden und nicht, wenn einzelne Mitarbeiter die Freiheit hätten, sie selbst zu bestimmen. Empowerment impliziere dagegen ein hohes Maß an Partizipation und innengeleitetem Engagement, das als Ziel für Organisationen von hohem Wert sei, ohne je ganz erreicht werden zu können (a.a.O., S. 10).
Ungeachtet aller "schönen Worte über Wandel und Organisationsentwicklung"(a.a.O., S. 15), wird die Praxis der Change-Programme insgesamt als trübe bezeichnet. In Bezug auf Empowerment-Projekte belegt Argyris an zahlreichen Beispielen, dass die Idee eines inneren, intrinsisch geleiteten Engagements keineswegs auf ungeteilte Gegenliebe bei MitarbeiterInnen und Vorgesetzten stößt. Für jene verbinde sich damit neben der Aussicht auf mehr Verantwortung und Entscheidungsfreiheit auch Mehrarbeit und Rechenschaftspflicht, diese vertrauten häufig doch lieber dem altbekannten Führungsmodell samt seinen Anweisungen und Kontrollen. Vor allem in Unternehmen, in denen langjährig äußeres Engagement praktiziert und durch verschiedenste Anreizsysteme (z. B. höhere Vergütung, bessere Aufstiegsmöglichkeiten, "Mitarbeiter des Monats") begünstigt wurde, werden erhebliche Schwierigkeiten konstatiert, Eigeninitiative und Sinn für persönliche Verantwortung zu entwickeln. Auch die Rolle von Beratern für OE (change agents) wird in diesem Zusammenhang problematisiert. Dadurch, dass die Grenzen und Widersprüchlichkeiten des Ansatzes nicht offen eingeräumt würden und Berater Managern nicht mit praktischen Ratschlägen zur Seite stünden, aus den resultierenden Zwickmühlen herauszukommen, würden viele Projekte nach anfänglicher Begeisterung in Schwierigkeiten geraten (a.a.O., S. 14).
Argyris (a.a.O., S. 15) beklagt, dass Maßnahmen zu mehr Empowerment allzu häufig in den Dunstkreis politischer Korrektheit gerieten und dann niemand mehr offen ausspreche, was er denke. Stattdessen sollten die Grenzen des Ansatzes und die Koexistenz äußeren und inneren Engagements bedacht werden. Argyris (a.a.O., S. 15f) plädiert deshalb ähnlich wie Wall et al. (2002, s. o.) dafür, nach Tätigkeiten zu differenzieren, ob eine stärkere Ermächtigung der MitarbeiterInnen vorteilhaft oder nicht erforderlich wäre (z. B. bei vielen Routinetätigkeiten). Nerdinger (1994, S. 274) teilt diese Auffassung und betont, dass nicht alle MitarbeiterInnen dem nach Selbstverwirklichung strebenden Menschenbild entsprächen.
2.3.5 Lernende Organisation und organisationales Lernen
Lernen ist in der modernen Gesellschaft, die u. a. von Ungewissheit und Turbulenz gekennzeichnet ist, ein überaus positiv besetzter Begriff.
"Er verspricht nicht nur die Bewältigung des immer rascheren sozialen Wandels, er erweckt außerdem Assoziationen von Selbständigkeit, Eigeninitiative und Eigenverantwortung … In der Informationsgesellschaft ist Lernen der Weg, eine der entscheidenden Steuerungsressourcen … zu vermehren: das Wissen (Heiner, 1998, S. 11).
Diese positive Konnotation des Lernbegriffs machen sich neuere Organisationskonzepte zunutze, die weniger den Stellenwert formaler Strukturen, rationaler Zweckorientierung und generalisierter Handlungsmuster für die Charakterisierung des "Organisation" genannten sozialen Gebildes betonen, sondern mehr die Bedeutung der beteiligten Akteure, kognitiven Prozesse und Selbststeuerungspotenziale in den Mittelpunkt stellen. Diese Konzepte der "lernenden Organisation" stellen organisationstheoretisch ein Bindeglied zwischen Handlungs- und Akteurstheorien einerseits und Strukturtheorien andererseits dar und erscheinen besonders geeignet, moderne Institutionalisierungsprozesse mit ihrer starken Veränderungsdynamik zu erfassen (a.a.O., S. 15).
Der dem Direktor des Center for Organizational Learning am Massachusetts Institute for Technology (MIT), Peter Senge (1990), zugeschriebene – in Ansätzen jedoch bereits im scientific management eines F. W. Taylor und später vor allem in den Arbeiten von H. A. Simon (1960) und C. Argyris & D. A. Schön (1978) anklingende – Begriff der "lernenden Organisation" ist deshalb zu einem viel benutzten Schlagwort geworden, wird aber keineswegs in einheitlichem Sinne verwendet. Luthans, Rubach & Marsnik (1995, S. 26) weisen überdies darauf hin, dass auch zwischen lernender Organisation und organisationalem Lernen unterschieden werden könne. Letzteres sei als Theorie jedoch erst in seiner "embryonic phase"(a.a.O.).
Das Konzept lässt sich, plakativ und stark simplifiziert, unter Verwendung originärer Schlüsselbegriffe ("core competencies") von Senge (1992) wie folgt charakterisieren:
"In learning organizations, managers should put aside their old ways of thinking (mental models), learn to be open with others (personal mastery), understand how their company really works (systems thinking), form a plan everyone can agree on (shared vision), and then work together to achieve that vision (team learning)"(Dumaine, 1994, zit. nach Luthans et al., 1995, S. 25).
- Persönliche Entwicklung (personal mastery) bezieht sich auf die Schnittstelle zwischen organisationalem und individuellem Lernen – das eine ist ohne das andere nicht zu realisieren.
- Eine Veränderung der mentalen Modelle (mental models) bezieht sich auf oftmals ungeschriebene Spielregeln, die den notwendigen Wandel behindern: Menschen halten gern an vertrauten Denk- und Handlungsmustern fest, auch wenn diese längst dysfunktional geworden sind.
- Gemeinsame Visionen (shared visions) beziehen sich auf erstrebenswerte Zukunftsbilder, denen sich die Organisationsmitglieder verpflichtet fühlen und für die sie sich einsetzen.
- Teamlernen (team learning) bezieht sich auf die Notwendigkeit, Problemlösekompetenzen und Dialogfähigkeit zu entwickeln.
- Systemisches Denken (systems thinking) – als die zentrale, "fünfte Disziplin" im gleichnamigen Buch von Senge (1990) – bezieht sich auf die zirkuläre Verknüpfung von Ursachen und Wirkungen, von Verzögerungs- und Beschleunigungsmomenten in den Rückkopplungsschleifen komplexer Systeme (Kolhoff, 2003, S. 59f).
Leitbild der lernenden Organisation sind zu solcherart vernetztem, systemischem Denken fähige MitarbeiterInnen, die bewusst, freiwillig, intrinsisch motiviert Verantwortung übernehmen und mitunternehmerisch handeln. Eine Unternehmensverpflichtung zur Qualität, die nicht auf intrinsischer Motivation gründet, ist nach Senge (1992, S. 31) auf Sand gebaut.
Führungskräfte lernender Unternehmen werden als Designer von Lern- und Veränderungsprozessen verstanden (Boxberg, 2003, S. 9); ihre Schlüsselaufgabe besteht darin, einen Interpretationsrahmen zu schaffen, auf den sich die einzelnen Organisationsmitglieder oder Organisationsteile beziehen können – Kontexte für Wirklichkeitsinterpretationen, die für jene Realitätskonstruktionen anschlussfähig sind, auf deren Grundlage die Organisationsmitglieder und -einheiten als sich selbst steuernde Systeme handeln (Heiner, 1998, S. 14).
Kumuliertes Lernen der MitarbeiterInnen macht dabei noch kein lernendes Unternehmen aus, obwohl naturgemäß nicht die Organisation als solche lernt, sondern ihre Mitglieder. Deren erworbenes und in Gruppen ausgetauschtes Wissen ist gleichfalls kein hinreichendes Charakteristikum für eine lernende Organisation. Die besondere Qualität ergibt sich neben der Kumulation des Wissens aller Organisationsmitglieder und der Möglichkeit, durch dessen Nutzung individuelle Lernprozesse abzukürzen, aus der Aufnahme, Archivierung und Weitergabe dieses Wissens (a.a.O., S. 44).
Allerdings ist damit noch keineswegs gewährleistet, dass die organisationale Wissensbasis qualitativ immer mehr ist als die Summe ihrer Teile, wie programmatisch gern behauptet wird. Organisationsmitglieder können Informationen zurückhalten, Kommunikationskanäle verstopfen oder Falschmeldungen streuen, wenn ihnen dies strategisch günstig erscheint, und bestimmte Organisationsstrukturen können ein solches Verhalten durchaus befördern (a.a.O.). Die heimlichen Machenschaften in Organisationen, Vorteile zugunsten einzelner Mitglieder oder Gruppen zu erlangen, werden als Mikropolitik bezeichnet (Blickle, 2004, S. 149).
Wissen als eine zentrale Steuerungsgröße in Organisationen muss deshalb im Kontext materieller Strukturen und Machtdimensionen analysiert werden. Ohne Berücksichtigung der Prozesse, wie Wissen z. B. verfügbar gemacht und in die organisationale Wissensbasis aufgenommen oder von ihr ausgeschlossen wird, gerät die einseitige Fokussierung auf diese kognitive Ressource und die damit verknüpften Lernprozesse zu einem idealistischen und harmonistischen Organisationsverständnis (Heiner, 1998, S. 44). In solchen Organisationen wäre jedoch ein Lernen im umfassenden Sinne nicht mehr möglich; denn dazu gehört ein Mindestmaß an Herausforderung und Dissens (vgl. Heiner, a.a.O.; Klatetzki, 1998, S. 61ff.).
Ohne an dieser Stelle zugrunde gelegte Konzeptionen von Lernen und die nur scheinbar einfache Frage "Wer lernt, wer lehrt und was wird gelernt?" zu erörtern (dazu Heiner, 1998, S. 15ff.), sei auf einige Aspekte näher eingegangen, um die Verwandtschaft mit Ansätzen des Qualitätsmanagements zu verdeutlichen.
Senge äußert in einem 1992 erschienenen Aufsatz die Befürchtung, dass die Qualitätsbewegung in den USA Gefahr laufe, ohne einigendes Rahmenkonzept in isolierte Initiativen und Slogans zu zerfallen. Angesichts der zahlreichen und theoretisch unverbundenen Ansätze wird es als nicht überraschend bezeichnet, dass viele PraktikerInnen darin jeweils nicht mehr sähen als "das Thema des Monats", das es auszuhalten gelte, bis die nächste Mode Einzug hält. Gesucht werde ein vereinigender konzeptioneller Rahmen, der berücksichtige, dass Total Quality keine geschlossene Methodologie sei, sondern eine offene, die sich mit den Bedürfnissen der Gesellschaft entwickele. Diesen Rahmen soll nunmehr die Konzeption der lernenden Organisation darstellen (Senge, 1992, S. 30).
Senge nimmt an, dass die Qualitätsbewegung nichts anderes ist als die erste Welle in der Entwicklung solcher lernenden Organisationen, verstanden als Organisationen, die kontinuierlich ihre Fähigkeit erweitern, die eigene Zukunft zu gestalten. In der ersten Welle lag seiner Ansicht nach der Fokus auf den "frontline workers" (vermutlich ist damit das "Kundenkontaktpersonal" gemeint, P. G.). Der Job des Managements habe darin bestanden, kontinuierliche Verbesserungen zu erkämpfen, bürokratische Hindernisse zu beseitigen, welche das Personal demotivieren und neue Methoden einzuführen, um die Prozesse zu verbessern (a.a.O., S. 31).
Die zweite Welle kennzeichnet nach Senge ein Fokuswechsel von der Prozessverbesserung zur Verbesserung der Art, wie wir arbeiten, denken und interagieren; im Mittelpunkt stehen die Manager selbst. Diese zwei Wellen werden nach Auffassung von Senge in eine dritte münden, in der Lernen als unausweichliche Anforderung für Manager und MitarbeiterInnen gleichermaßen institutionalisiert sein werde (a.a.O.).
Das auf Leistung, statt auf Lernen aufgebaute Erziehungssystem wird von Senge dafür verantwortlich gemacht, dass der natürliche Trieb zu lernen, der früher auftrete und länger anhalte als der Sexualtrieb, unterdrückt werde und Menschen Wissen stets als etwas betrachteten, das andere haben und man selbst nicht. Diese Haltung münde in die Figur des Bosses, des Lehrers, des Experten, der die Antworten hat und unsere Leistung beurteilt, statt dass wir uns als Lernende empfinden, die ihre Fähigkeiten entfalten. Eine radikale Reform des Schulsystems wird für notwendig gehalten, um das Arbeitsleben im Sinne der Vision der lernenden Organisation zu revolutionieren (a.a.o., S. 38).
Senge (zit. nach Dumaine, 1994, S. 154) soll auf die Frage, ob die lernende Organisation tatsächlich die nächste Stufe nach TQM sei, geantwortet haben: "If it isn´t working, we should stop and do something else." Dem Konzept ist somit die Selbstreflexion und Veränderung im Falle der Nichtbewährung immanent. Um hierüber ein Urteil fällen zu können, bedarf es nach Luthans et al. (a.a.O.) jedoch neben traditionellen Maßzahlen (z. B. aus Befragungen) innovativer Evaluationskriterien zur Feststellung, ob Lernen tatsächlich stattfindet und die Organisation effektiver als zuvor arbeitet.
Die Modelle lernender Organisationen und die Vorstellungen von den Möglichkeiten, die organisatorische Wissensbasis produktiv zu nutzen, variieren – wie schon betont – erheblich (Heiner, 1998, S. 42). Gemeinsam ist ihnen, dass Wissen als zentrale Steuerungsressource betrachtet wird. Die Nähe des Ansatzes zu Konzepten des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, des Wissensmanagements und betrieblichen Vorschlagswesens ist evident.
Cameron & Barnett (2000, S. 288) betonen die Bedeutung von "information-gathering activities focused on quality in the organization" und "balance between using standardized quality tools … and encouraging and rewarding innovation, creativity, new ideas, originality, and invention in producing quality improvements" als Prädiktor für "high levels of effectiveness and improvement in quality performance".
Luthans et al. (1995, S. 27ff.) fassen die allgemein akzeptierten Charakteristika lernender Organisationen in drei Merkmalsgruppen zusammen:
- presence of tension,
- presence of systems thinking,
- a culture which facilitates learning.
Die Autoren konzedieren, dass diese Charakteristika idealistisch und vage formuliert sind und nur von wenigen in Frage gestellt würden. Die Herausforderung bestehe jedoch darin zu bestimmen, welche operationalen Techniken eingesetzt werden müssen, um die Lernprozesse der Organisation zu befördern, m. a. W.: Was können Organisationen tun, um sich zu lernenden zu transformieren (a.a.O., S. 31f)? Als spezifische Techniken, die sich bei der Entwicklung organisationalen Lernens als hilfreich herauskristallisiert haben sollen, werden aufgeführt:
- learning laboratories/managerial micro-worlds,
- scenario planning,
- experimentation,
- learning from the past,
- learning from others,
- systemic problem solving,
- active learning.
In diesem Zusammenhang entscheidend ist die Frage nach der Qualität der organisationalen Lernfähigkeit. Regelgetreue Anwendung des bestehenden Wissens und Korrekturen als Reaktion auf Probleme, von Argyris (1992)"single loop learning" genanntes, adaptives Lernen wird als nicht hinreichend betrachtet. Für bedeutsamer werden generative Lernprozesse gehalten ("double-loop learning"), bei denen kreativ nach besten Lösungen gesucht wird, ggf. auch unter Infragestellung der Zielvorgaben. Reflexionsprozesse über diese Vorgänge werden schließlich als "triple-loop learning" bezeichnet. Sie erfolgen selbstorganisiert und selbstverständlich, ohne dass jeweils erst eine Aufforderung notwendig wäre (Heiner, a.a.O., S. 45). Auch Senge (1990) unterscheidet ähnlich Argyris zwei Arten des Lernens: adaptive (coping and accomodating) und generative (creative and innovative).
Angesichts des historischen Abstiegs von Firmen wie IBM oder General Motors trotz Umsetzung von TQM und des gleichzeitigen Erfolgs anderer Unternehmen wie Wal-Mart oder Motorola konstatieren Luthans et al. (1995, S. 25):"There now seems little question, on both an intuitive and empirical basis, that the ability of these organizations to learn, not just react to change but anticipate change, has much to do with their success or failure."
Der spezifische Beitrag des Konzepts der lernenden Organisation zur Erweiterung der "QM-Toolbox" besteht in der Betonung einer Steuerung durch Selbstreflexion, wie sie im Wechsel von zielbezogenem Vorgehen und reflexiven Schleifen, von Erkunden und Plädieren, von single und double loop learning, von Dialog und Diskussion zum Ausdruck kommt (Rappe-Giesecke, 2003, S. 11f).
2.4. Zur postmodernen Kritik des Qualitätsdiskurses
Ungeachtet aller positiven Konnotationen, die sich mit "Qualität" verbinden und auch den systematischen Bemühungen, sie möglichst wirkungsvoll zu steuern – Qualitätsmanagement genannt – zugute kommen, bietet der Qualitätsdiskurs Angriffsflächen, an denen sich Kritik im Detail oder im Grundsätzlichen entzündet. Einige Aspekte sollen im Folgenden erörtert werden. Dabei wird besonders Bezug genommen auf ein Konzept, das den Anspruch erhebt, über den Qualitätsdiskurs hinauszuweisen: Sensemaking.
Zunächst jedoch sei ein Sachverhalt problematisiert, der auf den ersten Blick spezifisch für den Profit-Bereich zu sein scheint, aber auch in Non-Profit-Organisationen eine erhebliche Rolle spielt – die Frage, wem QM auf lange Sicht nütze.
So äußert z. B. Kottmann (2002, S. 194) im Kontext einer Stellenbeschreibung für Qualitätsbeauftragte im Pflegebereich: "Es erfordert Geschick und Beharrlichkeit, die Skepsis der Mitarbeiter gegenüber Qualitätsmanagement auszuräumen. Ziel hierbei ist es, dass die Mitarbeiter Qualitätsmanagement nicht als Kontrolle, sondern als Chance zur Verbesserung und zur Erhöhung der eigenen Arbeitszufriedenheit ansehen."
Anders als seinerzeit in Japan ist in den westlichen Industrienationen eine fatale Gleichzeitigkeit des Aufkommens der Qualitätsbewegung mit dem Anstieg der Massenarbeitslosigkeit (Stichwort "Downsizing") zu konstatieren. Auch in der amerikanischen Fachliteratur wird nicht verhehlt, dass die rhetorische Beschwörung einer "shared vision" und organisationalen Commitments häufig in Widerspruch gerät zur praktizierten Fokussierung des Managements auf die Interessen der "stockholders"(vgl. Cole & Scott, 2000, S. xvi).
Die Frage, wie weit unter den Bedingungen gewinnorientierten kommerziellen Wettbewerbs die viel zitierten organisationskulturellen Erfolgsfaktoren Vertrauen, Fehlerfreundlichkeit, Offenheit u. a. m. sich mit betrieblichen Realitäten vereinbaren lassen, sei hier allerdings nur rhetorisch gestellt; sie lässt sich nicht "dekontextualisiert" (s. u.) beantworten.
Ein Nebenaspekt dieser urpolitischen Frage betrifft den Stellenwert von Anreizsystemen. Während z. B. der Nestor der Qualitätsbewegung, W. E. Deming (1986), und einer der Väter der "lernenden Organisation", Argyris (1998), die Bedeutung intrinsischer Motivation betonen und extrinsische Belohnungen für problematisch erachten, konstatieren Hackman & Wageman (2000, S. 43) nüchtern:
"When workers perceive that they are contributing more to the organization than they did previously, their initial response may be pride and pleasure. That may suffice for a while. Eventually, however, members of profit-making firms will realize that somebody is making more money as a result of their greater contributions, and it is not them. At that point, they may begin to withdraw their commitment to the enterprise, and signs of a motivational backlash may even be seen."
Auch Levine & Shaw (2000, S. 383) argumentieren pragmatisch: "Some respond well to intrinsic incentives, but others respond better to the extrinsic incentives of pay increases – they want to be paid for their extra effort and for the resulting improvements."
Dass Organisationskonzepte immer auch die Machtdimension tangieren, wurde bereits im Kontext von Mitarbeiterbeteilung, Empowerment und lernender Organisation thematisiert. Im Folgenden soll versucht werden, einen anderen Aspekt der Kritik ausführlicher zu erörtern, der sich mit "postmoderner Perspektive" umschreiben lässt. Dabei wird im Wesentlichen auf Beiträge von Dahlberg, Moss & Pence (1999) sowie Weick (2000) zurückgegriffen, deren sozialkonstruktivistische Argumentation sich – ohne aufeinander Bezug zu nehmen – weitgehend deckt.
Nach Dahlberg et al. (1999) gibt es keinen Zweifel daran, dass das Konzept der Qualität inzwischen eine dominante Rolle in unserem Denken, unserer Sprache und unseren Handlungen spielt: "The 'age of quality' is now well and truly upon us ..."(a.a.O., S. 4). Die AutorInnen plädieren jedoch am Beispiel der Elementarerziehung dafür, den Qualitätsdiskurs in Richtung auf einen discourse of meaning making zu überwinden. Nach ihrer Auffassung ist der Qualitätsdiskurs fest eingebettet in die Tradition und Erkenntnistheorie des logischen Positivismus, der seinerseits tief im Projekt der Moderne verwurzelt sei. Der Qualitätsdiskurs stelle in gesellschaftstheoretischer Hinsicht die qualitätsspezifische Variante des modernistischen Aufklärungskonzepts dar. Durch Standardisierung, Quantifizierung, Objektivierung, Varianzreduzierung, Globalisierung usw. solle erreicht werden, Produkte definierter Qualität herzustellen und Kundenbedürfnisse optimal zu befriedigen. Dabei spiele auch der demokratische Wunsch nach unparteiischen und transparenten Methoden der Bewertung an Stelle von persönlicher Willkür eine Rolle. Das Konzept der Qualität befasse sich primär damit, durch die Spezifikation von Kriterien einen generalisierbaren Standard zu definieren, gegen den ein Produkt verglichen und somit sicher bewertet werden könne. Qualität in diesem Sinne sei ein dekontextualisiertes Konzept (a.a.O., S. 93f).
Die zunehmende Erkenntnis, dass Qualität jedoch subjektiv, wertbasiert, relativ, dynamisch, multiperspektivisch, kontext- und prozessabhängig sei, erfordere ein Hinausgehen über dieses Konzept. Ein solches neues Konzept wird meaning making genannt (a.a.O.).
Statt von sozialen Einrichtungen wie früher von services zu sprechen, benutzen die AutorInnen nunmehr den Begriff der institution, um zu betonen, dass ein Wechsel von der Sprache der Anbieter und Nachfrager, Geber und Nehmer, Produzenten und Konsumenten zur Sprache der öffentlichen Foren, Plazas und Arenen mit kultureller und symbolischer Bedeutung sinnvoll sei, die in der Zivilgesellschaft lokalisiert sei und diese mitkonstituiere. In diesem Zusammenhang wird auch die Rolle der (vor allem amerikanischen) Entwicklungspsychologie problematisiert, die von universellen alterstypischen Entwicklungsstufen ausgeht.
Die AutorInnen argumentieren, dass der modernistische Qualitätsdiskurs die dekontextualisierte Suche nach Sicherheit durch die losgelöste und objektive Anwendung universeller und zeitloser Kriterien darstelle (a.a.O., S. 106). Dahlberg et al. halten das Konzept des "meaning making" für geeigneter, wenngleich Kontinuitäten zwischen den beiden Diskursen betont werden. Diese beträfen besonders den Wunsch, die Frage zu beantworten, was eigentlich vor sich gehe und was gute Arbeit ausmache. In postmoderner Sicht wird "gut" jedoch nicht verstanden als inhärente, substantielle und universelle Kategorie, sondern als Produkt einer Diskurspraxis, die immer zeitlich und räumlich kontextgebunden und oftmals der Unstimmigkeit und Verhandlung unterworfen sei. Während der Qualitätsdiskurs wertfreie technische Auswahlmöglichkeiten im Sinn habe, erfordere der Diskurs des meaning making explizit ethische und philosophische Entscheidungen mit Bezug auf weiterreichende Fragen wie die nach dem "guten Leben". Dieser Diskurs nehme nicht nur eine sozialkonstruktivistische Perspektive ein, sondern knüpfe an ein Verständnis von Lernen als Prozess der Ko-Konstruktion an, in dem Menschen in Beziehung zu anderen stehen und sich ein Bild von der Welt machen. Demgegenüber basiere der Qualitätsdiskurs auf einem Lernverständnis der Reproduktion eines festgelegten Wissensumfangs mit dem Experten als Wissensvermittler (a.a.O., S. 107).
"From a postmodern perspective, there is no absolute knowledge, no absolute reality waiting 'out there' to be discovered. There is no external position of certainty, no universal understanding that exists outside history or society that can provide foundations for truth, knowledge and ethics. Instead, the world and our knowledge of it are seen as socially constructed and all of us, as human beings, are active participants in this process …, engaged in relationship with others in meaning making rather than truth finding … For these reasons, knowledge and its construction is always context-specific and value-laden, challenging the modernist belief in universal truths and scientific neutrality"(Dahlberg et al., 1999, S. 23).
Während mit diesen Bemerkungen die postmoderne Perspektive relativ deutlich charakterisiert wird durch Aufweis der Schwächen eines zu statischen, präskriptiven, universalistischen und vermeintlich "objektiven" Qualitätskonzepts, ist die Beschreibung dessen, was die AutorInnen eigentlich unter "meaning making" verstehen, wesentlich schwieriger. Es handelt sich aber offenbar um sinngemäß das gleiche Konzept, welches von Weick (1995, 2000)"sensemaking" genannt wird. Auch das Sensemaking-Konzept ist ein Plädoyer wider technokratischen Glauben an die Beherrschbarkeit der Geschäftsprozesse zugunsten einer dynamischen Offenheit gegenüber den diversen organisationalen Umwelten. Sensemaking oder meaning making soll hier übersetzt werden mit "(soziale) Sinngebung"(vgl. Sommerfeld & Haller, 2003, S. 67f) und impliziert die immer subjektive Konstruktion von Bedeutung, Plausibilität und Wirklichkeitsverständnis.
Die aus dieser Perspektive gemachten Ausführungen von Weick (2000, S. 155-171) zur amerikanischen TQM-Bewegung sind geprägt vom Konstruktivismus. Dieser erkenntnistheoretische Ansatz betont die Abhängigkeit von Wahrnehmung und Handeln von "Vorgängen im Kopf". Erkenntnis beruht danach nicht auf einer Korrespondenz mit der externen Wirklichkeit, sondern auf Konstruktionen eines Beobachters; nur durch Konsens mit anderen wird Wirklichkeit "erfunden". Die Welt wird in Form von sozialen Artefakten verstanden und mit Hilfe von Begriffen, die in historisch bestimmten Austauschprozessen zwischen Personen gebildet worden sind (Bergius, 1998, S. 456). Vor allem in sozialen Handlungssystemen spielen sprachliche Symbole (Wörter) eine herausragende Rolle; sie repräsentieren Reize, die Reaktionen auslösen und erlangen dadurch selbst die Fähigkeit, Reaktionen hervorzurufen ("symbolischer Interaktionismus"). Im Wechselspiel von symbolischen und materiellen Aktivitäten wird soziale Realität konstruiert (Weick, 1995, zit. nach Scholl, 2004, S. 527).
Weick (2000, S. 158) äußert im Zusammenhang mit einer Kritik am TQM-Label: "However, if one grants that words are all we have, that words gain their meaning from their connections with other words rather than with external objects (a correspondence theory of truth is untestable and therefore of little help), and that people learn what they think by seeing what they say, and learn what they want by seeing what they do, then it makes sense to linger over words, their connotations, and their surplus meanings that are taken for granted."
Weick betont, dass menschliches Verhalten vielfach in Begriffen des individuellen Bedürfnisses erklärt werden könne, einer Situation Bedeutung zu verleihen ("making sense") und als kompetenter Akteur darin zu erscheinen. Mit zunehmender Institutionalisierung der Situationen akzeptierten Menschen existierende soziale Skripte, statt originäre Skripte zu entwerfen. Deshalb folgten viele Individuen Routinen und Leistungsprogrammen für Alltagsaktivitäten, statt neue Handlungspläne zu entwickeln (zit. nach Hamada, 2000, S. 300).
Die Konstruktion solcher Sinn- und Deutungsmuster, Sensemaking, wird als eine Schlüsselaktivität von Menschen verstanden, die eine Welt gestalten wollen, in der Qualität eine wichtige Rolle spielt (Weick, 2000, S. 155). Mit Bezug auf Heidegger ("Geworfenheit"), Quanten- und Chaostheorie wird die Welt als prinzipiell unerkennbar und unvorhersehbar bezeichnet. Sensemaking wird als ein Steuern mehr mit Kompass als mit Landkarte betrachtet. Während Landkarten Bekanntheit voraussetzen, führe ein Kompass auch durch unbekanntes Gelände und sei daher eine Säule für Lernen und Erneuerung (Weick, a.a.O., S. 161ff.).
Hamada (2000, S. 300) verdeutlicht den Prozess des individuellen sensemaking durch Analogie: Eine Person der Gegenwart, die Jazzmusik höre, könne diese sofort als solche identifizieren; Johann Sebastian Bach würde dagegen dieselbe Musik vermutlich nur als einen Mix aus Geräuschen bezeichnen. Um an bedeutungshaltigen sozialen Interaktionen teilnehmen und soziale Realität verstehen zu können, müsse der Mensch eine soziale und symbolische "Grammatik" erlernen (a.a.O.).
Weick (2000, S. 170f) fasst die Essenz seiner perspektivischen Überlegungen zum Sensemaking in 12 Punkten zusammen und formuliert praktische Implikationen für das Qualitätsmanagement (quality improvement):
"… if one wanted to improve quality, then one would socialize people to make do, be resilient, view constraints as of their own making, value quests, strive for plausibility, treat past experience with ambivalence, keep showing up, use retrospect to get a sense of direction, craft descriptions that energize, ground identity in a protean rather than singular self-image, and be wary of using rational accounts as job descriptions ….
If a team enacted those 12 practices, … there would be continuous updating and co-evolution of producer-customer relationships …, whether it was called quality improvement or not."
Das Verhalten von Menschen in Organisationen wird von Weick und anderen VertreterInnen des Konstruktivismus bevorzugt als ein sich selbst regulierendes System betrachtet, das durch organisationspsychologische Interventionen nur unterstützt, aber nicht von außen umstrukturiert oder durch Input wissenschaftlicher Informationen verändert werden kann (Holling & Kanning, 2004, S. 83). Dem konstruktivistischen Ansatz werden wertvolle Anregungen zum Organisationsverständnis konzediert (a.a.O., S. 84). Allerdings wird es für möglich gehalten, die von den Konstruktivisten präferierten Maßnahmen – z. B. verstärkte Partizipation, selbstorganisierte Lernprozesse – auch ohne den "ideologischen Überbau" zu begründen, etwa durch Bezug auf Motivationstheorien oder die Forschung zur hypothesengeleiteten Wahrnehmung (a.a.O.).
Diese Auffassung wird geteilt. Bei aller grundsätzlichen Berechtigung der konstruktivistischen Kritik ist nicht zu übersehen, dass sie sich – jedenfalls bei den zitierten AutorInnen – an einem Qualitäts- und Managementverständnis entzündet, das aus sozialwissenschaftlicher Sicht inzwischen als überholt gelten kann (vgl. Cole & Scott, 2000). Bezogen auf die Qualitätsrhetorik der Achtziger- und frühen Neunzigerjahre und die auch bei Angehörigen sozialer Berufe (meistens Leitungspersonal mit Sozialmanagement-Ambitionen, vgl. Gerull, 2001, Vorwort) zeitweilig anzutreffende naive Begeisterung für "Qualitäts-Managerialismus", mag die von Dahlberg et al. und Weick kritisierte Sichtweise auf Qualität legitim und notwendig (gewesen) sein. Den aktuellen Qualitätsdiskurs in sozialen Handlungsfeldern kennzeichnet sie jedoch nicht (mehr) korrekt (vgl. Kap. 5.1).
Im Zusammenhang mit einer Konzeptualisierung von Qualität als interaktives Epiphänomen formulierte Klaus (1991, S. 256) in einem ansonsten betriebswirtschaftlich orientierten Beitrag bereits vor über einem Jahrzehnt:
"Das Dienstleistungs-Qualitätsmanagement wird … gezwungen, die Grundlagen objektiver und absoluter Standards und Werte zu verlassen, wie sie im industriellen Qualitätsmanagement gefordert und genutzt werden. Stattdessen muß es sich in einer noch wenig erforschten Welt flüchtiger, subjektiver und relativer Qualitätsgrößen zurechtfinden."
2.5 Resümee: Zur Konvergenz und Integration der Ansätze
Kundenorientierung (customer focus), kontinuierliche Verbesserung (continuous improvement), umfassende Beteiligung (total participation) und gesellschaftliche Vernetzung (societal networking): nach Ansicht von Shiba & Walden (2001) – beides Professoren am Massachusetts Institute for Technology (MIT) und Autoren eines in den USA führenden Management-Lehrbuchs – sind dies die vier in der Praxis sich auswirkenden Revolutionen, die das heutige Management auszeichnen. Mit ihrer Hilfe soll es bei konsequenter Anwendung möglich sein, eine einzigartige organisationale Fähigkeit zu schaffen.
Die Nähe dieser Ansätze zu zentralen Konzepten des QM liegt auf der Hand. Zollondz (2002, Vorwort) sieht darin eine Bestätigung dafür, dass QM das gesamte Wirtschaftsleben seit über 50 Jahren nachhaltig geprägt habe wie keine andere Managementkonzeption und keinesfalls eine totgesagte Mode sei.
"Bei den Systemen des Qualitätsmanagements handelt es sich nicht um Kopfgeburten. Sie basieren auf jahrzehntelangen Erfahrungen anderer Unternehmen, stammen aus Beratungsleistungen von Experten und aus den Untersuchungen und Theoriebildungen angewandter Wissenschaften"(a.a.O., Hervorhebungen im Original, P. G.).
Dabei werden die Effekte dieser Bewegung durchaus unterschiedlich eingeschätzt. Während auf akademischer Seite Skepsis überwiegt und empirische Forschung – wenngleich mit erheblichen methodologischen Schwierigkeiten behaftet (vgl. Hackman & Wageman, 2000, S. 33f) – häufig auf Lücken zwischen Qualitätsrhetorik und Realität verweist (Cole & Scott, 2000, S. xxi), betonen Manager gern die positiven, vorwiegend prozessualen Veränderungen in größerem Kontext, z. B. die verbesserte Kooperation zwischen Design und Produktion oder die erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber externen Kunden (a.a.O., S. xxii; Hackman & Wageman, 2000, S. 35).
Wenn somit auch hinsichtlich der empirischen Wirksamkeit des Qualitätsmanagements viele offene Fragen bleiben, ist die Tatsache einer verstärkten Befassung der wissenschaftlichen Disziplinen mit dem Phänomen "QM" unverkennbar; sie ist auch überfällig, wenn man sich die in den Kapiteln zuvor erörterten Grundlagen und thematischen Schnittmengen von Qualitäts- und Organisationslehre bewusst macht.
In nahezu allen diesen Konzepten – seien sie eher betriebswirtschaftlich oder sozialwissenschaftlich akzentuiert – fehlt es nicht an Hinweisen auf die Bedeutung von systemischen Aspekten (Vermeiden von "Insel-Lösungen"; "Einbettung" in ein Bündel von Maßnahmen; struktureller, kultureller und klimatischer "Kontext") und Soft-Faktoren – Vertrauen, Offenheit, Fehlerfreundlichkeit, Kooperativität, Beteiligung, Commitment, Kommunikation, Lernen, Teamwork, evaluatives Denken. Dies offenbar sind die maßgeblichen Ingredienzien für effektive und nachhaltige Organisationsgestaltung. Dabei insinuiert der Gestaltungsbegriff ein Potenzial an aktiven Zugriffsmöglichkeiten, das von namhaften Organisationstheoretikern für gar nicht existent gehalten wird: Grenzen der Planbarkeit, Betonung von Anpassungs-, Lern- und Widerstandsfähigkeit ("resilience") in einer prinzipiell nicht vorhersagbaren Welt und ähnliche postmoderne Warnungen vor Überschätzungen eines Managerialismus sind hier zu nennen.
Die unterschiedlichen Perspektiven eher "universalistisch" argumentierender VertreterInnen des Qualitätsmanagements und eher "adaptationistisch", kontingenztheoretisch orientierter OrganisationswissenschaftlerInnen finden sich auch im bislang ambitioniertesten Beitrag zu einer Integration von QM und Organisationstheorie wieder: in dem von Cole & Scott (2000) herausgegebenen Sammelband "The Quality Movement and Organizational Theory".
Die Editoren diskutieren eingangs die amerikanische Qualitätsbewegung im zeit- und raumübergreifenden Kontext der komplexen Fragen, wie und warum sich Organisationen verändern (S. xiii). QM wird als rezentes und wichtiges Beispiel für einen solchen Wandel verstanden, der – ungeachtet der langjährigen Vernachlässigung durch die Organisationstheorie – eine Einbettung dieses Themas in einen größeren theoretischen Zusammenhang erfordere. Die Autoren würdigen Dean & Bowen (1994, Reprint 2000), die vornehmlich aus Sicht der Managementtheorie wichtige Beiträge zu dieser Frage leisteten, indem sie das Qualitätsthema in Verbindung brachten mit Führungstheorien, Human Resource Management, Strategischer Planung sowie Informations- und Analyseansätzen.
Die Überlegungen von Dean & Bowen (2000, S. 16f) lauten zusammengefasst:
1. Das Konzept der Total Quality (TQ) ist konsistent mit der Managementtheorie in folgenden Bereichen: Führung, Human Resource Practices (Mitarbeiterbeteiligung, Teamwork, Bedarfsanalyse und Evaluation von Trainingsmaßnahmen, Karrieremanagement).
2. Das TQ-Konzept muss durch Beiträge der Managementtheorie ergänzt oder korrigiert werden in folgender Hinsicht: Vermeiden einer Überschätzung der formalen Analyse von Informationen, besonders in uneindeutigen und politischen Settings; Berücksichtigung nicht nur von Kundenerwartungen, sondern auch von organisationalen Stärken und Schwächen bei der Strategieformulierung; höherer Stellenwert von Selektionsverfahren, besonders im Hinblick auf die Passung von Personen und Organisation; Verwendung eines kontingenztheoretischen Zugangs statt universalistischer Ansätze zur Gestaltung der internen und externen Beziehungen (Kunden-Lieferanten-Beziehungen, Mitarbeiterbeteiliung, Empowerment).
3. Das TQ-Konzept kann der Managementtheorie wichtige Forschungsimpulse vermitteln in folgenden Bereichen: Informationsverarbeitung, Strategieimplementation, Prozessverbesserung, Kundenorientierung und -zufriedenheit.
Vorläufiges Resümee: Ungeachtet der forschungsthematischen Schnittmengen und des offensichtlichen theoretischen Annäherungsprozesses zwischen QM, Betriebswirtschaftslehre, Organisationspsychologie und anderen betroffenen Wissenschaftsfeldern, wie sie in Kap. 2.2. und 2.3 exemplarisch erörtert wurden, ist der gegenwärtige Status dieses Prozesses als fragmentarisch zu bezeichnen. Dabei ist auch keineswegs auszumachen, unter welchem wissenschaftssystematischen Dach sich die verschiedenen Ansätze integrieren lassen oder angesiedelt sein sollten.
So werden einerseits Hoffnungen auf eine im Entstehen begriffene Qualitätswissenschaft artikuliert. Diese wird als interdisziplinäre Querschnittsverbindung verstanden, in der die – traditionell bis heute dominierenden – Ingenieurwissenschaften den technischen Anteil, die Sozialwissenschaften den humanen, die Umweltwissenschaften den ökologischen und die Wirtschaftswissenschaften den ökonomischen Aspekt repräsentieren (Kamiske & Brauer, 1999, S. 239ff.). Hinzu werden mindestens noch Rechtswissenschaft, Informatik und Statistik gezählt (Zollondz, 2002, S. 22f).
Weinert (1998, S. 69ff.) fordert dagegen eine interdisziplinäre Organisationswissenschaft, um die für ein tieferes Verständnis von Organisationen hemmende Filterfunktion der einzelwissenschaftlichen Paradigmen zu überwinden. Es sei noch keine interdisziplinäre Wissenschaftsdisziplin geboren, "wenn die mikrotheoretischen Probleme von Psychologen, die makrotheoretischen von Soziologen, Politologen, Wirtschaftswissenschaftlern, Historikern und von Leuten aus dem Management- und Human-Relations-Bereich behandelt werden und man wechselseitig die Forschungsergebnisse austauscht"(a.a.O., S. 69).
Seghezzi (1994, 1996, 2003) schließlich betont die Zuordnung der entstehenden Querschnittsdisziplin QM in die Wirtschaftswissenschaften, insbesondere in die Betriebswirtschaftslehre. Systematik und Struktur des St. Galler Management-Konzepts dienen ihm dazu, QM in die allgemeine Managementlehre zu integrieren (Seghezzi, 2003, S. VII). Wenngleich dieser Ansatz am weitesten gediehen ist und durchaus überzeugen kann, ist ihm eine größere fachliche Resonanz bislang vorenthalten geblieben.
Ein Resümee zur Konvergenz und Integration der verschiedenen Konzepte kommt deshalb nicht umhin, dem von Weinert (1998, S. 70) in Bezug auf die gegenwärtige Organisationsforschung geäußerten Eindruck zuzustimmen: verwirrend, diffus und ungeordnet, ohne integratives Rahmenwerk für die Forschungsergebnisse der einzelnen Disziplinen.
Ob die von Senge (1992, S. 30) propagierte learning organization die Funktion des "unifying conceptual framework" erfüllen kann, erscheint mehr als fraglich.
Kühl (2000) setzt sich kritisch mit Widersprüchen und Aberglauben im Konzept der lernenden Organisation auseinander. Er zitiert ethnologische und sozialanthropologische Erkenntnisse, wonach Rituale wie das des Regenmachers in traditionellen Kulturen latent funktional, nämlich gemeinschaftsfördernd sind, auch wenn sie ihren vorgeblichen Zweck – hier: Regen zu produzieren – gar nicht erfüllen. Diese Einsicht lässt sich nach Kühl auf das Konzept der "lernenden Organisation" bzw. auf Managementkonzepte allgemein übertragen. Ähnlich dem "Regenmacher-Phänomen" werden vermeintlich rationale Prinzipien für einen erfolgreichen Unternehmenswandel entwickelt, die zwar nicht zum Erfolg führen, aber dennoch einen versteckten, nicht sofort sichtbaren Nutzen stiften, nämlich den MitarbeiterInnen in einer Situation hoher Verunsicherung Orientierung zu geben. Statt die Rationalität der zugrunde gelegten Prinzipien in Frage zu stellen, werden in der Regel Erklärungsmuster für Misserfolge bereitgehalten, die nur auf Umsetzungsprobleme fokussieren.
Die konstruktivistische Skepsis in Bezug auf den Traum vom geplanten Wandel und die akkurate Beantwortbarkeit wissenschaftlicher Fragestellungen bei gleichzeitiger Betonung des "discovering rather than discoveries"(Weick, 2000, S. 171) ist vermutlich eine angemessene Reaktion auf eine Welt, die sich den objektivierenden Bemühungen positivistischer Wissenschaft gegenüber allzu sperrig verhält. Zugleich erhärtet sich der Verdacht, dass an die Stelle einer Qualitätsbewegung mit ausgeprägt rhetorischen, rituellen, ja quasi-religiösen Zügen eine nicht minder ideologisierte Sichtweise tritt, für die nicht mehr der moderne Glaube an die Gestaltbarkeit der Organisation durch Management kennzeichnend ist, sondern Vertrauen auf die Selbstregulierungskräfte eines kontinuierlich lernenden organisationalen Systems. Beide Pole des Ansichtenspektrums repräsentieren Formen säkularisierten Glaubenseifers, zwischen denen sich die Entscheidungsträger dienstleistender Einrichtungen und Organisationsforscher irgendwo pragmatisch positionieren müssen, wenn sie Qualitätsmanagement betreiben wollen.
3. Besonderheiten sozialer Dienstleistungen und ihres Managements
3.1 Formale und inhaltliche Abgrenzungen des Dienstleistungsbegriffs
3.1.1 Systematik betrieblicher Leistungen
Die folgende Systematisierung betrieblicher[1] Leistungen ist angelehnt an Arnold (1998) und Oettle (nach Krönes, 1998):
Betriebliche Leistungen
- Sachleistungen (z. B. Produktion von Fahrrädern),
- Dienstleistungen (z. B. Vermögensberatung).
Sach- und Dienstleistungen richten sich an konkret identifizierbare Leistungsabnehmer. Sind die Leistungen jedoch nicht an einzelne Personen, sondern an die Allgemeinheit adressiert, spricht man von
- Gesamtheitsleistungen (z. B. Sicherung des Gemeinwesens durch Polizei).
Dienstleistungen
- Konkrete (persönlich oder maschinell bzw. automatisiert erbrachte) Dienstleistungen setzen Anwesenheit des Kunden oder seines Objekts voraus und sind differenzierbar in
- sachbezogene Dienstleistungen (z. B. Reparatur einer Maschine),
- personenbezogene Dienstleistungen (z. B. Friseur, Geldautomat).
- Abstrakte Dienstleistungen (z. B. Versicherungsschutz)
Personenbezogene Dienstleistungen
- Periphere personenbezogene Dienstleistungen (persönliche Vertrauensbeziehung und aktive Mitarbeit des Kunden sind nicht oder kaum erforderlich, z. B. Beförderung, Konzert)
- Zentral personenbezogene (soziale) Dienstleistungen (Mitarbeit des Kunden ist für das Leistungsergebnis maßgeblich, „Koproduktion“, z. B. Psychotherapie).
3.1.2 Dienstleistungen: Definitionen und allgemeine Merkmale
Für die Wirtschaftswissenschaften war "Dienstleistung" lange Zeit eher ein Un-Begriff, eine residuale Sammelkategorie für jene ökonomischen Phänomene, die nicht eindeutig nach den gewohnten Kriterien zu klassifizieren waren und zumeist über Negativ-Prädikate bestimmt wurden: Dienstleistungen sind nicht materiell, können nicht gelagert oder transportiert werden, ihre Produktivität kann nicht gemessen und nicht kontrolliert werden usw. (Nerdinger, 1994, S. 46ff.).
In einer viel zitierten betriebswirtschaftlichen Definition (Meffert/Bruhn, 1997, nach Arnold, 1998, S. 259) wird der Begriff umfassend bestimmt, ohne allerdings Charakteristika sozialer Dienstleistungen aufzugreifen:
- „Unter Dienstleistungen werden selbständige, marktfähige Leistungen verstanden, die bestimmte Leistungsfähigkeiten/Potenziale bereitstellen (z. B. Versicherungsleistungen) bzw. einsetzen (z. B. Friseurleistung). Dabei werden interne Faktoren (z. B. Geschäftsräume, Personal, Ausstattung) und externe Faktoren (z. B. Person oder Objekt des Dienstleistungsnachfragers) im Rahmen des Erstellungsprozesses kombiniert. Ziel dieser Faktorenkombination ist es, nutzenstiftende Wirkungen bei den externen Faktoren zu erzielen.“
Soziologisch werden Dienstleistungen vor allem unter dem Aspekt ihrer Erstellung betrachtet. Direkt personenbezogene Dienstleistungen erfordern den unmittelbaren Kontakt zwischen Dienstleister und Bedienten bzw. Kunden. Deren Person ist Objekt der Leistungserstellung und die erbrachten Leistungen werden in der Kontaktsituation unmittelbar "verbraucht" – Produktions- und Konsumtionsprozess fallen räumlich und zeitlich zusammen (uno-actu-Prinzip). Hinzu kommt, dass die Bedienten dabei nicht nur Konsumenten, sondern infolge ihrer Mitarbeit partiell auch Produzenten der Dienstleistung sind und in persönliche Kommunikation mit dem Dienstleister treten ("face-to-face-Kontakt"). Beispiele sind Dienstleistungen wie Haareschneiden, Massieren, Krankenpflege, ärztliche Untersuchung und Beratung (Nerdinger, a.a.O.).
Indirekt personenbezogene Dienstleistungen können zwar ebenfalls einen persönlichen Kontakt von Angesicht zu Angesicht enthalten, sind aber wesentlich dadurch charakterisiert, dass bereits produzierte Leistungen/Güter verkauft, die Nutzung solcher Leistungen vermittelt oder an einem Objekt der Bedienten erbracht werden (a.a.O.).
Bezieht man die im vorigen Kapitel gemachte Unterscheidung von peripher und zentral personenbezogenen Dienstleistungen in diese Betrachtung ein, lässt sich feststellen:
- "Dienstleistungen können auf einem Kontinuum verortet werden – von weitgehend unstrukturierten Beratungssituationen, in denen ... zunächst die Regeln der Beziehung und die Rollenverteilung verhandelt werden müssen, bis zu praktisch vollständiger Determiniertheit der Interaktion an einem Fast-Food-Center, in dem die Rollenverhandlungen latent bleiben"(a.a.O., S. 118).
Unter psychologischen Aspekten können Dienstleistungen als jene Problemlöse-Tätigkeiten verstanden werden, die es erfordern, dass Dienstleister in face-to-face Interaktion zu Bedienten treten, mit denen sie nichts weiter verbindet als der Tausch "Leistung gegen Geld"(a.a.O., S. 54). Für die Zweierbeziehung zwischen Dienstleister und Bedientem, die Dienstleistungsdyade, sind somit die Aspekte Transaktion (Tausch "Leistung gegen Geld") und Interaktion konstitutiv (a.a.O., S. 59ff.). Zur Interaktion gehören instrumentelle Handlungen ("technische" Handlungen am Objekt des Bedienten, intentional auf Objekte gerichtet, a.a.O., S. 64) und soziale Handlungen (auf die Persönlichkeit gerichtete Handlungen auf der Beziehungsebene, intentional auf Subjekte gerichtet, a.a.O., S. 65).
Diese Überlegungen zusammenfassend, schälen sich vier Definitionsmerkmale einer Dienstleistung heraus:
- direkte Interaktion (face-to-face),
- Reduzierung eines individuellen Bedarfs bzw. Lösung eines persönlichen Problems,
- temporäres Zweckbündnis, d. h. keine über die Dienstleistungsbeziehung hinausgehende gegenseitige Verpflichtung der Interaktionspartner,
- Tauschbeziehung "Leistung gegen Geld"(vgl. Nerdinger, 1994, S. 53).
Damit wird eine Vielzahl von Tätigkeiten, die in der amtlichen Statistik dem tertiären Sektor zugeordnet sind, nicht als Dienstleistungen im psychologischen Sinne betrachtet, z. B. Leistungen von Reinigungspersonal (keine direkte Kommunikation), von Polizisten (Dienst wird der staatlichen Gemeinschaft erwiesen), von Lehrern (Zwangspräsenz der Bedienten), von "backoffice"-Mitarbeitern in Banken (a.a.O.).
Dienstleistungen lassen sich allgemein durch eine Reihe von Merkmalen gegenüber Sachleistungen abgrenzen (vgl. Bruhn, 1993, 1995, Arnold, 1998).
- Sie sind immateriell, intangibel (nichtgreifbar) und flüchtig.
- Sie können nicht gelagert, nicht gespeichert, nicht transportiert und nicht auf Vorrat produziert werden.
- Sie zeichnen sich durch Unteilbarkeit sowie die Gleichzeitigkeit von Produktion und Konsumtion aus (uno-actu-Prinzip).
- Es besteht die Notwendigkeit des direkten Kontakts zwischen Anbieter und Nachfrager an einem bestimmten Standort. Die Dienstleistung kann nur dort erbracht werden, wo sich der Nachfrager bzw. sein zu behandelndes Sachgut befindet.
- Der Nachfrager/Kunde muss einen Beitrag in den Leistungsprozess einbringen ("externer Faktor"), um das Dienstleistungspotenzial des Anbieters, also dessen Fähigkeit und Bereitschaft zur Dienstleistungserbringung, zu aktivieren.
Dieser Beitrag des Kunden kann situationsabhängig bestehen aus der Anwesenheit der eigenen Person (Beispiel: Friseurbesuch) oder des Objekts, an dem die Dienstleistung verrichtet wird (Beispiel: Autoreparatur) und/oder der Integrationsfähigkeit und -willigkeit zur Mitwirkung an der Leistungserstellung (Beispiel: Erziehungshilfe) und/oder der Erbringung einer Eigenleistung (Beispiel: Krankengymnastik) oder der Duldung von Handlungen (Beispiel: Operation) (vgl. Matul/Scharitzer, 1997).
- Die Nutzenstiftung der Dienstleistung durch Erhaltung oder Veränderung geistiger oder materieller Güter (z. B. Bildung, Gesundheit, Verfügungsrechte) ist mit einem Risiko verbunden; für den Konsumenten ist dieser Nutzen nicht immer sofort sichtbar – wenn überhaupt; er kann sich zunächst nur auf das Leistungsversprechen des Anbieters verlassen, dass ein Nutzen möglich ist.
- Daraus ergibt sich, dass die Qualität von Dienstleistungen im Unterschied zu materiellen Produkten nicht bei Vertragsabschluss bzw. Auftragserteilung vom Kunden geprüft werden kann, sondern erst nach Leistungserbringung. Dienstleistungen stellen somit Bereitstellungsleistungen dar; der Anbieter stellt sein Potenzial zur Verfügung und verspricht mit Auftragsannahme die fachgerechte Erbringung der Leistung, ohne jedoch ein erwünschtes Ergebnis garantieren zu können (ob dem Kunden der ausgeführte Haarschnitt gefällt, ist nicht Bestandteil des Leistungsversprechens, allenfalls Anlass für einen Nachbesserungsservice). Dienstleistungen werden deshalb auch als Vertrauensgüter bezeichnet.
- Angesichts der Notwendigkeit zur Integration des externen Faktors ergibt sich eine hohe Individualität der Dienstleistung, welche die mögliche Standardisierung/Normierung der Leistungserstellung stark eingrenzt; "Sonderanfertigungen“ sind eher die Regel als die Ausnahme.
- Die Messung und Bewertung von Dienstleistungsqualität ist deshalb problematisch. Sie kann z. B. nicht ohne weiteres durch Vergleich mit einem Referenzprodukt ermittelt werden, weil es sich um individuell zugeschnittene Leistungen handelt.
3.1.3 Merkmale sozialer Dienstleistungen
Die vorgenannten Merkmale charakterisieren natürlich auch soziale Dienstleistungen. Es kommen jedoch Besonderheiten hinzu, welche vor allem die Probleme der Qualitätsmessung potenzieren.
- Soziale Dienstleistungen sind unmittelbar auf Personen bezogen; damit rücken die Interaktionsbeziehungen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit (vgl. Olk, 1994).
- Die Leistungsempfänger sind an der Produktion beteiligt und nicht bloß passive Nutznießer einer an ihnen verrichteten Dienstleistung; vielmehr kooperieren bzw. koproduzieren sie in einem "joint venture“(Müller, 1996b). Aufgrund dieses transaktionalen Charakters pädagogischer, sozialer und therapeutisch-pflegerischer Arbeit sind Ergebnisse vom Handlungsverlauf mitbestimmt und Wirkungen stets beiden Gruppen von Akteuren zuzuordnen.
- Der Prozess der Leistungserbringung ist deshalb zwar planbar, aber nicht definitiv vorherzubestimmen; die Vielfalt der Einflussfaktoren auf das zwischenmenschliche Geschehen ist nicht sozialtechnologisch zu beherrschen. Qualität ist dementsprechend auch bei konsequentestem Einsatz von Verfahrensvorschriften und Kontrollinstrumenten nicht technisch zu sichern.
- Zugleich wächst die Bedeutung des subjektiven Faktors. Der Stellenwert persönlicher Wahrnehmungen und Entscheidungen ist hoch. Um die Gefahr willkürlicher oder einseitiger Handlungsweisen zu reduzieren, sind besondere Vorkehrungen zu treffen (z. B. interdisziplinäre Teamarbeit im Prozess der Hilfeplanung).
- Die Beziehung zwischen Leistungserbringer und -empfänger ist teilweise extrem asymmetrisch. Oft ist der Grad der Freiwilligkeit eingeschränkt und Aspekte sozialer Kontrolle statt Dienstleistung treten in den Vordergrund. Das Bedürfnis, die Leistung in Anspruch zu nehmen, ist häufig nicht primär, sondern entwickelt sich erst im Rahmen eines Aushandlungsprozesses. Der "Kunde“ ist somit nicht zwangsläufig "König“ und souveränes Mitglied des Marktes, sondern nicht selten völlig schutzlos; Aspekte einer "advokatorischen Ethik“(Brumlik, 1992) kommen ins Spiel. Oftmals ist die Herstellung einer Solidaritätsbeziehung mit dem Klienten erforderlich, um ein Arbeitsbündnis überhaupt begründen zu können.
- Die Leistung erfolgt im Rahmen einer "nicht schlüssigen Tauschbeziehung"(Bruhn, 2006, S. 96), an der neben Anbietern und Nachfragern weitere Partner (z. B. Behörden) beteiligt sind; eine marktanaloge Bezahlung durch den Leistungsempfänger findet in der Regel nicht statt.
- Das formell bestehende Wahlrecht des Leistungsempfängers wird durch die amtliche Anerkennungspraxis von Einrichtungen, mangelnde Alternativen und die Pflicht zur Begründung eines gewünschten Einrichtungswechsels beschränkt (Galiläer, 2005, S. 136).
- Das Produkt der sozialen Dienstleistung besteht nicht allein im sichtbaren Endergebnis, sondern bezieht den gesamten Prozess der Leistungserbringung mit ein. Vor allem "Beziehungsdienstleistungen“ sind ergebnisoffene Prozesse, denen oftmals gar kein Resultat mit Produktcharakter zugeordnet werden kann – "der Weg ist das Ziel“.
- Ebenso ist nicht allein der Kunde/Klient/Konsument der Dienstleistung ihr Nutznießer, sondern alle, die von der geleisteten Normalisierungsarbeit profitieren, im weitesten Sinne die Gesellschaft, deren "Normalzustand“ durch soziale Dienstleistungen geschützt, überwacht und reproduziert werden soll (Olk, 1994). Bei "meritorischen“ Dienstleistungen stehen die Interessen der Allgemeinheit sogar im Vordergrund, zumal wenn der "Kunde“ die Leistungen nur eingeschränkt willig annimmt (z. B. in der Straffälligenhilfe).
- Der Kunde sozialer Dienstleistungen – genauer: der Klienten-Kunde (im Unterschied zu anderen stakeholdern, z. B. Kostenträger-Kunden) – soll möglichst nicht wiederkommen.
- Die Unbestimmtheit des Aufgabenanfalls stellt ein Problem bei der Bereitstellung und Organisation sozialer Dienstleistungen dar (Notwendigkeit von Reservekapazitäten, Olk, 1994).
Angesichts dieser vielschichtigen Bestimmungsmerkmale sozialer Dienstleistungen stellt sich die – hier nur angerissene – Frage nach der Tauglichkeit des zugrunde liegenden theoretischen Ansatzes: Kann Soziale Arbeit überhaupt als Dienstleistung angemessen konzeptualisiert werden?
"Soziale Arbeit als moderne Dienstleistung ist ein programmatischer Entwurf, ein paradigmatisches Leitbild, das vorherrschenden bürokratischen Routinen und paternalistischen Handlungsmustern entgegengestellt wird. Es bedarf aber ethischer und handlungstheoretischer Erweiterungen..."(Galiläer, 2005, S. 140).
In diesem Zusammenhang sei auf die Ausführungen zur "politischen Ethik" und zur "Ethik der Fürsorge" (s. Kap. 1.6, Müller, 1996) bzw. zur "advokatorischen Ethik" (s. o., Brumlik, 1992) verwiesen.
3.1.4 Qualitätsmerkmale sozialer Dienstleistungen
Aussagen über die Qualität von Produkten bzw. Leistungen können sich auf den Gesamteindruck beziehen oder auf Einzelaspekte. Diese betreffen bestimmte Merkmale aus dem Bündel von Eigenschaften, die das Produkt insgesamt kennzeichnen, vor allem (vgl. Beywl, 1999b; Krönes, 1998; Gerull (Hrsg.), 2000):
- Art (z. B. ethisch, technisch, ökonomisch),
- Anzahl (z. B. Konzentration auf Schlüsselprozesse oder vollständige Leistungserfassung),
- Beziehungen der Merkmale untereinander (z. B. Vereinbarkeit und Gewichtung),
- Messbarkeit (z. B. quantitativ oder qualitativ),
- Transparenz (z. B. klar ersichtlich oder verborgen),
- Wahrnehmung durch Adressaten (z. B. vollständig oder selektiv),
- Stabilität (z. B. situationsabhängig oder normierbar),
- Akzeptanz (z. B. allgemeingültig oder subkulturspezifisch),
- Gewissheit (z. B. ursächlich wirksam oder von unklarer Kausalität).
Bezogen auf die Art von Dienstleistungen, um die es in sozialen Handlungsfeldern geht, haben wir es überwiegend mit Qualitätsmerkmalen zu tun (Gerull (Hrsg.), 2000),
- die komplexer Art sind und u. a. ethische, rechtliche, physische und soziale Aspekte enthalten;
- die aufgrund dieser Komplexität und Anzahl nicht in einem lückenlosen Ablaufplan berücksichtigt werden können, sondern eine Konzentration auf Schlüsselstellen (kritische Erfolgsfaktoren) erfordern;
- die teilweise in konflikthafter Beziehung zueinander stehen und situativ gewichtet werden müssen (z. B. Freundlichkeit und Konsequenz);
- die größtenteils nur durch "weiche“ Daten abgebildet bzw. messbar gemacht werden können;
- die selten transparent und klar ersichtlich sind und
- häufig subjektiv verzerrt wahrgenommen werden;
- die person- und situationsabhängig, wenig stabil und nur eingeschränkt standardisierbar sind;
- die keineswegs von allen Anspruchsgruppen gleichermaßen akzeptiert sind und der Konsensfindung bedürfen,
- und die selbst in Fachkreisen umstritten und ungewiss sind, was ihre spezifisch zuordenbare Wirkung anbelangt.
Wie viel einfacher ist es dagegen, die Qualität materieller Produkte wie Kaffeemaschinen zu bewerten. Selbst über die Qualität von Abschleppdiensten lässt sich relativ leicht Konsens herstellen, verglichen z. B. mit der Qualität einer Deutschstunde oder einer Sonntagspredigt oder eines "gelingenden Alltags“ im Heim.
Aber diese Problematik darf nicht dazu führen, grundsätzlich auf eine Qualitätsbewertung sozialer Dienstleistungen zu verzichten, weil diese ja ohnehin nicht objektiv möglich sei. "Arbeit ohne Bewertung ist der größte anzunehmende Unfug beruflicher Systeme“(Berker, 1998, S. 323).
Festzuhalten bleibt indessen, dass ein Qualitätsmanagement sozialer Dienstleistungen deren Spezifität berücksichtigen muss, will es nicht zur künstlich aufgesetzten, gegenstandsunangemessenen technischen Veranstaltung degenerieren.
Die zentralen Aspekte seien in Form von vier Thesen zusammengefasst:
1. Qualität sozialer Dienstleistungen ist nichts unmittelbar Gegebenes, sondern muss kontextbezogen bestimmt und kommunikativ validiert werden ("Konstruktcharakter“).
2. Qualität sozialer Dienstleistungen wird durch multiple Anspruchsgruppen definiert und muss diskursiv verhandelt werden ("Aushandlungscharakter“).
3. Qualität sozialer Dienstleistungen wird nicht technisch erzeugt, sondern muss durch interaktives Handeln realisiert werden ("Koproduktionscharakter“).
4. Qualität sozialer Dienstleistungen muss mehrdimensional und multiperspektivisch betrachtet werden ("Komplexitätscharakter“).
3.2 Perspektiven der Qualitätsbestimmung sozialer Dienstleistungen
In der Fachliteratur wird die Frage, wie Qualität zu definieren sei, häufig mit dem Hinweis auf unterschiedliche Blickrichtungen beantwortet, denen entsprechende Verfahren zur Qualitätssteuerung zugeordnet werden können.
Beywl (1996) differenziert besonders anschaulich zwischen folgenden Dimensionen von Qualität:
1. Mustergültigkeit (Bezugsgröße ist ein genormtes Produkt bzw. ein Standard, mit dem das zu beurteilende Produkt verglichen wird. Steuerungsansatz: ISO 9000 ff.),
2. Besttauglichkeit ( Bezugsgröße ist der Gebrauchswert eines Produkts im Sinne von erfüllten Anforderungen. Steuerungsansatz: Total Quality Management),
3. Ausserordentlichkeit/Einzigartigkeit (Bezugsgröße ist ein ästhetisches Empfinden von Schönheit und künstlerischem Wert. Steuerungsansatz: ??),
4. Preiswürdigkeit (Bezugsgröße ist ein durch Angebot und Nachfrage bestimmtes Preisniveau. Steuerungsansatz: Kosten-Nutzen-Analysen),
5. Höchstgedeihlichkeit (Bezugsgröße sind Prinzipien, Werte und fachliche Standards, die es einzuhalten gilt, um z. B. Entwicklungsprozesse bei Personen zu fördern. Steuerungsansatz: Selbst-/Evaluation).
Bezugsgröße kann aber auch eine statistische Kennzahl sein, z. B. ein Branchenmittelwert oder der "Klassenbeste“. In solchen Fällen kann das angestrebte Qualitätsniveau darin bestehen, nicht schlechter als die durchschnittliche Konkurrenz zu sein oder zum Branchen-Primus aufzuschliessen. Ein zugehöriger Steuerungsansatz ist das so genannte Benchmarking (s. Kap. 4.4.5.5) .
Eine andere, noch häufiger verwendete Systematik von Ansätzen der Qualitätsbestimmung geht auf Garvin (1984) zurück; die soeben erörterten Bezugsgrößen lassen sich bis auf den Aspekt der Höchstgedeihlichkeit ohne weiteres einbeziehen (Gerull (Hrsg.), 2000):
- transzendenter Ansatz (Qualität ist etwas Einzigartiges und Außerordentliches, das sich einer Definition entzieht und z. B. in ästhetischen Erfahrungen in der Kunst zum Ausdruck kommt – Bezugsgröße "Außerordentlichkeit“),
- produktbezogener Ansatz (Qualität ist das Niveau der vorhandenen, im Prinzip als messbar vorausgesetzten, Eigenschaften – Bezugsgröße "Mustergültigkeit“),
- fertigungsbezogener Ansatz (Qualität ist die Erfüllung spezifizierter Anforderungen an das Produkt aus Sicht des Herstellers; Fehlervermeidung steht dabei im Vordergrund – Bezugsgröße "Mustergültigkeit“),
- kundenbezogener Ansatz (Qualität ist die Erfüllung spezifizierter Anforderungen an das Produkt aus Sicht des Verbrauchers; das Niveau der Bedürfnisbefriedigung steht dabei im Vordergrund – Bezugsgröße "Besttauglichkeit“) und
- wertbezogener Ansatz (Qualität ist ein bestimmtes Preis/Leistungs-Verhältnis – Bezugsgröße "Preiswürdigkeit“).
Verschiedene Autor(inn)en, z. B. Achberger (1997), ergänzen diese Systematik um einen
- wertebezogenen Ansatz,
um die ethische Dimension und ideelle Zielsetzung von Nonprofit-Organisationen zu betonen (vgl. Heiner, 1996a). Der Aspekt der Höchstgedeihlichkeit lässt sich am ehesten hier integrieren.
Im Folgenden werden diese Ansätze und ihre Grenzen in sozialen Handlungsfeldern näher erläutert, ausgehend vom jeweiligen Verständnis der Anforderungen, die der Qualitätsbestimmung zugrunde liegen.
Produktbezogener oder sozialtechnologischer Ansatz
Die Anforderungen beziehen sich auf Eigenschaften des Produkts wie Funktion, Preis, Lieferzeit, Sicherheit, Umweltverträglichkeit, Normentsprechung (Mustergültigkeit).
Wird die Qualität daran bemessen, auf welchem Niveau das Produkt diesen Anforderungen (zumeist handelt es sich um herstellerseitig vorgegebene Standards) genügt, spricht man von einem produktbezogenen Ansatz der Qualitätsbestimmung (in der Sozialen Arbeit auch sozialtechnologischer Ansatz genannt, vgl. Piel, 1996).
Dabei wird vorausgesetzt, dass sich die qualitätsrelevanten Eigenschaften möglichst objektiv messen und Produkte sich diesbezüglich vergleichen lassen, wie es etwa bei materiellen Gütern zumeist möglich ist. Der Ansatz stößt folglich überall dort an Grenzen, wo es um die Objektivität der Maßstäbe schlecht bestellt ist, z. B. bei der Beurteilung von Beratungsqualität. In interaktiven Prozessen verändern sich Erfordernisse, Wünsche und Bedürfnisse, so dass ein auf Qualität untersuchungsfähiges Endprodukt schwerlich zu bestimmen ist.
Fertigungsbezogener oder expertokratischer Ansatz
Werden die Anforderungen, wie das Produkt sein soll, vom Hersteller bzw. Experten eindeutig festgelegt (so genannte Spezifikationen, im Dienstleistungsbereich zumeist Standards genannt) und im Produktionsprozess einwandfrei umzusetzen versucht, haben wir es mit einem fertigungsbezogenen Ansatz zu tun. Dabei bestimmt der Produzent durch Maßnahmen zur Fehlervermeidung und Erfüllung der Spezifikationen die Qualität des Produkts.
Dieser – im Bereich der Sozialen Arbeit auch expertokratisch genannte (vgl. Piel, 1996) – Ansatz vernachlässigt allerdings die Frage, ob die zugrunde gelegten Anforderungen/Spezifikationen, wie sie sich z. B. in Vorschriften und fachlichen Standards niederschlagen, auch tatsächlich vernünftig und zweckmäßig für den Kunden sind.
Diese Frage stellt sich vor allem dann, wenn die Kundenbedürfnisse, die den Vorschriften ursprünglich zugrunde gelegen haben mögen, sich zwischenzeitlich veränderten oder mit neuen Leistungsangeboten experimentiert werden muss, deren nachhaltige Akzeptanz auf Seiten der Kunden noch ungesichert ist.
Abweichungen von bewährten Handlungsroutinen stellen im Humandienstleistungsbereich zudem keineswegs immer Qualitätsminderungen dar, sondern kennzeichnen mitunter ein hohes Maß an Professionalität.
Kundenbezogener oder adressatenorientierter Ansatz
Sowohl der produkt- als auch der fertigungsbezogene Ansatz der Qualitätsbestimmung lassen weitgehend außer Betracht, ob ein Produkt – mag es noch so hochwertig im Vergleich zu anderen und fehlerfrei hergestellt sein – für den Kunden überhaupt von Nutzen ist.
Dieser Aspekt von Qualität, die Gebrauchstüchtigkeit und Tauglichkeit eines Produkts für die vom Kunden benötigten Zwecke, wird zwar auch von der objektiven Güte und Mängelfreiheit beeinflusst. Entscheidend ist jedoch der passgerechte Zuschnitt auf die Kundenbedürfnisse, so wie er in den Begriffen "Individualisierung“ und "Flexibilisierung“ zum Ausdruck kommt.
Der kundenbezogene Ansatz der Qualitätsbestimmung ist traditionell für viele Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe kennzeichnend, die im Unterschied zur Industrie keine genormten, sondern persönlich anforderungsgerechte Produkte verkaufen.
Für den Bereich sozialer Dienstleistungen greift jedoch auch dieser Ansatz zu kurz. Piel (1996) unterscheidet deshalb einen konsumeristischen Ansatz, bei dem die unreflektierte Bedürfnisbefriedigung des Adressaten im Mittelpunkt steht und eine demokratische Variante des kundenbezogenen Ansatzes, die auf Aktivierung und Emanzipation des Adressaten abzielt.
Wertbezogener Ansatz
Beim wertbezogenen Ansatz der Qualitätsbestimmung kommt der Aspekt der Preiswürdigkeit und des Kosten-Nutzen-Verhältnisses ins Spiel. Die Anforderungen an z. B. Mustergültigkeit, Fehlerfreiheit und Zuverlässigkeit werden dabei in Relation gesetzt zum Preis. Möglicherweise führt dies zu der Entscheidung des Kunden, lieber ein billigeres, dafür schlichteres Produkt zu erwerben, sofern seine wesentlichen Ansprüche auch dadurch erfüllt werden.
Der Ansatz spielt in der aktuellen Diskussion um die Qualität sozialer Dienstleistungen eine – zumindest implizit – dominierende Rolle. Es geht nicht zuletzt um die politisch zugespitzten Fragen, ob der betriebene Aufwand durch den erzielten Nutzen gerechtfertigt und dem Steuerzahler zumutbar ist und ob durch rationellere Formen der Betriebsführung (Qualitätsmanagement!) Qualitätsverbesserungen, zumindest Standardabsicherungen möglich sind.
Der Ansatz an sich bietet Raum für alle gesellschaftlichen Anspruchsgruppen, sich auf ein vernünftiges und bezahlbares Qualitätsniveau zu verständigen, steht aber real stets in der Gefahr, einseitig für Kostenreduzierung instrumentalisiert zu werden.
Wertebezogener und transzendenter Ansatz
Kunden- und wertbezogene Ansätze der Qualitätsbestimmung bedürfen der Einbeziehung von normativen Aspekten, um der ethischen Dimension und ideellen Zielsetzung vieler Leistungen gerecht zu werden. Dies gilt besonders für Nonprofit-Organisationen, in geringerem Maße jedoch auch für kommerzielle Unternehmen, die ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung tragen oder zumindest darum bemüht sind, einen solchen Eindruck zu erwecken.
Der Aspekt der Höchstgedeihlichkeit von Leistungen für das individuelle und soziale Wohlergehen erfordert somit einen wertebezogenen Ansatz der Qualitätsbestimmung. Diesem lassen sich auch jene Aspekte zuordnen, die mitunter als transzendenter Ansatz bezeichnet werden.
Dazu gehören ästhetische Urteile im Zusammenhang mit Kunst, Wissenschaft und Produkt-Designs, die nicht von einer definierbaren Qualität ausgehen, sondern die Erfahrung des Außerordentlichen, Einzigartigen, Absoluten betonen (vgl. Beywl, 1996); aber auch idealistische Anspruchsniveaus der sozialen und pädagogischen Berufe, z. B. das Ziel, sich selbst überflüssig zu machen oder in erster Linie "facilitator“ für Lernprozesse zu sein, sind in diesem Zusammenhang zu nennen.
Resümee:
Aufgrund der Komplexität sozialer Dienstleistungen und der "multiplen Kundenbeziehungen" wird keiner dieser theoretisch voneinander abgrenzbaren Ansätze der Wirklichkeit gerecht. Wenn man die Aushandlungsbedürftigkeit von Qualitätsanforderungen im Sozial- und Gesundheitsbereich ebenso berücksichtigt wie die nicht immer freiwillige Inanspruchnahme personenbezogener Dienstleistungen (z. B. Bewährungshilfe), kommt man nicht umhin, Sichtweisen verschiedener Anspruchsgruppen situationsangemessen miteinander zu verknüpfen (vgl. Volkmar, 1998).
Dies gilt in besonderem Maße für Dienstleistungen, die neben interaktiven Anteilen auch wirtschaftliches und/oder Verwaltungshandeln erfordern.
3.3 Qualitätsmodelle sozialer Dienstleistungen
3.3.1 Vorbemerkungen
Die im Folgenden beschriebenen Ansätze stellen keine Konzepte des Qualitätsmanagements dar, sondern Qualitätsmodelle im Sinne des Kapitels 2.1.3. Sie liefern einen Rahmen, verschiedene Aspekte sozialer Dienstleistungsqualität zu systematisieren. Ihre Nützlichkeit besteht vor allem darin, den Blick von der im Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsbereich zu kurz greifenden Ergebnisbetrachtung (z. B. Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit) auf die Leistungsvoraussetzungen und Umsetzungsprozesse zu lenken.
3.3.2 Das Qualitätsmodell von Donabedian und angelehnte Konzepte
1966 veröffentlichte der Medizinprofessor Avedis Donabedian seine auf das amerikanische Gesundheitswesen angewandten Überlegungen zur Qualität und definierte diese als „Grad der Übereinstimmung zwischen den Zielen des Gesundheitswesens und der wirklich geleisteten Versorgung“.
Zur Differenzierung dieses globalen Qualitätsbegriffs entwickelte Donabedian die seither prominent gewordenen Kategorien
- structure (ins Deutsche übersetzt als Struktur oder Potenzial),
- process (Prozess oder Durchführung),
- outcome (Ergebnis oder Produkt).
Die strukturelle oder Potenzialebene der Qualität bezieht sich auf die sachlichen, organisatorischen und persönlichen Voraussetzungen einer guten betrieblichen Leistung: vor allem Personal und dessen Aus- und Weiterbildungsstand, Arbeitskonzepte, bauliche und technische Einrichtungen.
„Strukturqualität (ist) als das Gesamt der institutionellen Qualitätsmerkmale zu definieren, die zumindest über bestimmte Zeiträume hinweg konstant bleiben und überindividuell, das heißt unabhängig von einzelnen Personen und Aufgabenausführungen, beschrieben und beurteilt werden können“(Holländer/Schmidt,1997, S. 5).
Die prozessualen Qualitätsaspekte beziehen sich auf die Art und Weise der Leistungserbringung, z. B. die medizinischen, pflegerischen oder pädagogischen Interventionen.
„Prozessqualität (ist) als der Komplex von Qualitätsmerkmalen abzugrenzen, der die individuumsbezogenen Leistungsprozesse charakterisiert und entsprechend nur über Analysen konkreter Einzelverläufe erfasst werden kann“(Holländer/Schmidt,1997, S. 5).
Die Ergebnisqualität bezieht sich zum einen auf die durch Interventionen bewirkten Verbesserungen bzw. Veränderungen bei Patienten, Klienten und anderen Leistungsempfängern. Ergebnisqualität in diesem Sinne beinhaltet Zielerreichungsgrad und Wirksamkeit der Intervention (Effektivität) sowie deren Effizienz im Sinne eines Kosten/Nutzen- bzw. Aufwand/Ertrag-Verhältnisses.
Von den Wirkungen einer Leistung, engl. Outcome, ist jedoch das bloße Erbringen der Leistung zu unterscheiden, der viel genannte Output. Dieser steht als Ergebnis im Mittelpunkt einer outputorientierten Betrachtungsweise von Qualität, garantiert für sich genommen jedoch noch keine Wirkung beim Klienten. Der Outcome ist mindestens teilweise von dessen individueller Potenzialqualität (s. u.: Modell von Meyer/Mattmüller) abhängig und kann in sozialen Handlungsfeldern nie eindeutig den professionellen Leistungsfaktoren zugeordnet werden.
Viele Autoren (z. B. Schwarte/Oberste-Ufer, 1997, Lemme/Ochs, 1998) halten es deshalb für nicht sinnvoll, Ergebnisziele im Sinne eines Outcome zu formulieren, da zwar solche angestrebt werden und die Organisation sich um die dazu erforderlichen Bedingungen bemühen müsse, die Erreichung dieser Ziele jedoch nicht garantiert werden könne. Die Zielerreichung obliegt nämlich der Koproduktion von Anbieter und Nachfrager; beide müssen im Leistungserstellungsprozess ihre jeweils eingebrachten Potenziale kombinieren .
Dessen ungeachtet, betont Heiner (1996a, S. 23), dass im Zuge der Qualitätsdiskussion von den Anbietern von Humandienstleistungen erwartet werde, in einer Art Leistungsbilanz darzulegen, was sich während des Leistungsprozesses (dabei, nicht dadurch) auf Seiten der NutzerInnen verändere.
Hingewiesen werden muss darauf, dass Donabedian seinen Qualitätsbegriff für reproduzier- und damit standardisierbare Pflegedienstleistungen im medizinischen Bereich entwickelte, nicht aber für interaktive Prozesse. Als Ordnungsbegriffe für ein weites Feld von Phänomenen, an denen sich Qualität in unterschiedlicher Form erweisen kann, werden sie dennoch von den meisten AutorInnen für nützlich gehalten. Über die Qualitätssicherungsdiskussion im Pflegebereich wurde die Differenzierung nach Donabedian auch in anderen Handlungsfeldern üblich.
Gelegentlich werden einzelne Kategorien anders benannt – z. B. Produkt- statt Ergebnisqualität (Trube u. a., 2001), Potenzial- statt Strukturqualität (Eversheim, 1997) –, kontextspezifisch ersetzt – z. B. Orientierungs- statt Ergebnisqualität (Tietze u. a., 1997) – oder um eine vierte und fünfte ergänzt – Konzeptqualität (von Spiegel, 1994), Normqualität (Vilain, 2003), Procederequalität (Trube u. a., 2001), Beziehungs- und Erlebnisqualität (Ackermann, 2003). Die Reihe ließe sich fortsetzen (technische, Rahmen-, Handlungs-, Wirkungsprozess-, Verfahrens-, Verrichtungsqualität u. a.).
Donabedian ging implizit von einem kausalen Zusammenhang zwischen den drei Kategorien aus. Eine bessere Strukturqualität sollte danach mit höherwertigen Prozessen korrespondieren, woraus sich verbesserte Ergebnisse ableiten ließen. Dieser unterstellte Zusammenhang ist vielfach problematisiert worden und trifft zumindest in linearer Weise selbst für den medizinischen Bereich nicht zu. Es dürfte im Einzelfall schwierig bis unmöglich sein, die jeweiligen Anteile an der Gesamtqualität einer Dienstleistung bestimmten Faktoren oder Qualitätsdimensionen zuzurechnen. So wenig einerseits die pauschale Annahme berechtigt ist, eine Erhöhung des strukturellen Aufwandes führe automatisch zu einer Verbesserung der Prozess- oder Ergebnisqualität, so plausibel ist jedoch andererseits die notwendige Einhaltung gewisser Mindeststandards.
Schon 1992 formulierte die Planungsgruppe PETRA diesen Sachverhalt in Bezug auf die Qualität von Tagesgruppenarbeit: „Eine schlechte Ausstattung mit Ressourcen kann erfolgreiche Arbeit relativ verlässlich verhindern, eine gute Ressourcenausstattung gute Arbeit aber nicht verlässlich sichern“(zit. nach Holländer/Schmidt, 1997, S. 5).
Im allgemeinen fachlichen Sprachgebrauch und in den meisten Leistungsbeschreibungen, welche sich an Donabedian orientieren, hat es sich eingebürgert, zunächst die Struktur-, dann die Prozess- und schließlich die Ergebnisqualität in den Blick zu nehmen. Dies entspricht der sachlogischen Reihenfolge der Leistungserstellung: 1. Schaffung der strukturellen Voraussetzungen, 2. Gestaltung der erforderlichen Prozesse, 3. "Lieferung“ der Ergebnisse.
Aus Sicht der Nachfrager oder Kunden vollzieht sich die Qualitätsbetrachtung eher in umgekehrter Richtung. Sie erwarten einen Nutzen (Ergebnis) von der in Anspruch genommenen Dienstleistung und vertrauen darauf, dass der Anbieter, wenn er auch keine positive Wirkung (Outcome) garantieren kann, zumindest dafür sorgt, dass zielführende Rahmenbedingungen (Strukturen) und Handlungen (Prozesse) professionell arrangiert und diesbezügliche Leistungsversprechen (Output) erfüllt werden.
Der Kunde ist somit primär am erzielten Nutzen (Ergebnisqualität) interessiert. Gleichzeitig möchte er jedoch auch freundlich und individuell behandelt werden (Prozessqualität) und angenehme Umstände vorfinden, z. B. akzeptable Öffnungs- und Wartezeiten (Strukturqualität).
Heiner (1996a, S. 31) subsumiert deshalb die Kategorien der Ergebnis-, Prozess- und Strukturqualität unter produktbezogene Qualitätsdimensionen (Kundinnenperspektive), denen sie folgende produktionsbezogene Qualitätsdimensionen (Produzentinnenperspektive) gegenüberstellt:
- Konzeptqualität (Tauglichkeit und Klarheit der Arbeitskonzepte),
- Mitarbeiterinnenqualität (Qualifikation und Motivation),
- Organisations- und Ausstattungsqualität (Funktionsfähigkeit und Arbeitsmittel der Institution),
- Ressourcenqualität (sozialpolitische, infrastrukturelle und gesetzliche Rahmenbedingungen).
3.3.3 Beurteilung und Integration der verschiedenen Ansätze
Der Ansatz von Donabedian verdeutlicht, dass die Qualität von Dienstleistungen nicht allein ergebnisorientiert zu betrachten ist, sondern auch von prozessualen und strukturellen Faktoren abhängt. Damit wird ein einseitiger Blick nur auf die Ergebnisdimension verhindert.
Allerdings lässt die gewählte Kategorienbildung – zumindest explizit – einen entscheidenden Aspekt der Qualitätsentstehung unberücksichtigt, nämlich die Mitwirkung des Patienten/Klienten/Kunden (Gerull (Hrsg.), 2000).
Die Bereitschaft, am Pflege- und Heilungsprozess mitzuwirken und das in der Praxis außerordentlich gravierende Problem, diese Bereitschaft auch in Abwesenheit des Arztes/Pflegepersonals aufrechtzuerhalten (z. B. verschreibungsgemäßer Gebrauch von Medikamenten), wird in der Medizin unter dem Stichwort Compliance/Noncompliance behandelt.
In das Qualitätsmodell von Donabedian – auch in der um die Konzept- oder Normqualität erweiterten Form – lässt sich dieser Aspekt nur indirekt integrieren. Man bezieht dazu die drei (bzw. vier) Kategorien allein auf die leistungserbringende Organisation und betrachtet den Klienten als externen Faktor, der mit den organisationsinternen Faktoren in Interaktion tritt. Die Art und Weise, wie die Einrichtung diese Interaktion gestaltet (z. B. durch zweckmäßige Kooperationsstrukturen und Kommunikationsprozesse), ließe sich dann als Struktur- und/oder Prozessqualität darstellen.
Die Förderung und Einbeziehung der Klientenmitwirkung wäre etwa unter dem Stichwort "Partizipation der Betroffenen“ der Prozesskategorie zuzuordnen, während die "Therapietreue“ (Compliance) bzw. Kooperativität des Klienten allen Dimensionen zugerechnet werden könnte: als notwendige Rahmenbedingung (Struktur), als interaktives Prozesselement und als anzustrebendes Ergebnis auf dem Wege zu erwünschten Wirkungen (Outcome).
Die maßgebliche Bedeutung dieser Integration des externen Faktors wird in vielen betriebswirtschaftlichen Dienstleistungsmodellen (z. B. Matul/Scharitzer, 1997) betont. In der klassischen Dreiteilung nach Donabedian hat sie jedoch keinen ausdrücklichen Platz und muss über den beschriebenen Umweg ins Modell eingeschleust werden.
Einige Autoren kritisieren am Donabedian -Modell, dass es zwar für den Anbieter ein fundiertes Raster zur Beschreibung der Dienstleistungsqualität darstelle, jedoch die Kundenperspektive ignoriere (BEB/PiC, 1998). Ausserdem könne damit nicht bewertet werden, inwieweit die durchgeführten Maßnahmen notwendig und situationsadäquat seien .
Zu resümieren ist, dass das Modell von Donabedian für interaktive Dienstleistungen nur eingeschränkt brauchbar und insgesamt zu einfach strukturiert erscheint. Dass der Ansatz häufig unkritisch übernommen wurde und so weitflächig verbreitet ist, kann deshalb nicht befriedigen, zumal ein besseres Modell verfügbar ist.
Dieses – von Meyer und Mattmüller bereits 1987 entwickelte betriebswirtschaftliche Qualitätsmodell für Dienstleistungen – ist leider nur vereinzelt im Sozialbereich (z. B. Lemme und Ochs, 1998) aufgegriffen worden, verdient aber größere Beachtung.
Das Modell (vgl. Meyer/Westerbarkey, 1995) bezieht den von Donabedian vernachlässigten Aspekt der Mitwirkung des Klienten bzw. der Integration des externen Faktors ein und benutzt die dynamischere deutsche Übersetzung von "structure“: Potenzial.
Qualität ergibt sich danach aus der Verknüpfung zwischen vier Subqualitäten:
- Potenzialqualität des Anbieters (Spezifizierungs- und Kontaktpotenzial),
- Potenzialqualität des Nachfragers (Integrations- und Interaktivitätspotenzial),
- Prozessqualität,
- Ergebnisqualität (prozessuales Endergebnis und Folgequalität).
Die Potenzialqualität des Anbieters – weitgehend identisch mit der Strukturqualität nach Donabedian – ist wesentlich durch die Leistungsfähigkeit der MitarbeiterInnen, die Qualität sächlicher Hilfsmittel und die betriebliche Kompetenz für kundenindividuelle Problemlösungen (Spezifizierungen) bestimmt. Dieses Spezifizierungspotenzial des Anbieters gilt es, durch geeignete Marketingmaßnahmen (Kontaktpotenziale) beim Kunden bekannt zu machen und als Image der Organisation öffentlich zu verankern.
Dennoch wird die Frage, wie ein Anbieter auf einen Nachfrager wirkt, vor allem durch die Potenzialqualität des Letzteren bestimmt, die allerdings durch Maßnahmen des Anbieters (z. B. Informationen, Bemühungen im Vorfeld der Leistungsinanspruchnahme) gesteigert werden kann.
In diese Potenzialqualität des Nachfragers gehen dessen Erwartungen, Problemverständnis und Mitwirkungsbereitschaft (Integrationspotenzial) ebenso ein wie die wechselseitigen Beeinflussungen zwischen verschiedenen Nachfragern (Interaktivitätspotenzial). Die Potenziale auf Seiten der Kunden können positiver, neutraler oder negativer Art sein und das Leistungsergebnis entscheidend mitbestimmen.
Prozess- und Ergebnisqualität entsprechen im Modell den gleichnamigen Kategorien Donabedians. Die Ergebnisqualität wird dabei differenziert in einen sofort wahrnehmbaren Anteil (prozessuales Endergebnis) und eine Folgequalität, die häufig erst nach Jahren sichtbar wird.
Das Qualitätsmodell von Meyer/Mattmüller betont die Subjektivität und Vielseitigkeit der Qualitätsbeurteilung und berücksichtigt die besondere Bedeutung des Kundeneinflusses. Ungeachtet der Frage, ob im wirtschaftlichen und sozialen Dienstleistungsbereich nicht unterschiedliche Motive am Werke sind, ist die Konvergenz der Ansätze zur Einbeziehung des Kunden bzw. Klienten bemerkenswert.
„Die Integration des Kunden in die Planung von Dienstleistungsprozessen und die Berücksichtigung von Kundenreaktionen verdeutlichen die gegenseitige Abhängigkeit von Kunden und Dienstleistern im Sinne eines geschlossenen kybernetischen Systems. Das Mitarbeiter-Kunden-Verhältnis, die Qualität der Dienstleistung und der Erfolg des Unternehmens stehen in unmittelbarem Verhältnis zueinander. Damit stellt die Art und Weise der Kundenbeteiligung eine Schlüsselgröße für die Qualitätspolitik von Dienstleistungsunternehmen dar ...“(Meyer/Westerbarkey, a.a.O., S. 100).
Der umseitige Vorschlag (siehe Kasten) für ein eklektisches und integratives Ordnungsmodell von Qualität in sozialen, pädagogischen und pflegerischen Handlungsfeldern greift einerseits die etablierten Begriffe Donabedians auf und integriert über die Potenzialqualität des Nachfragers nach Meyer/Mattmüller den externen Faktor. Die Differenzierung der Potenzialfaktoren in Spezifizierungs- und Kontaktpotenzial bzw. Integrations- und Interaktivitätspotenzial wird zwar nicht explizit übernommen, allerdings durch inhaltlich konkretisierte Subkriterien berücksichtigt.
Die von Heiner (1996a) vorgenommene Differenzierung von produkt- und produktionsbezogenen Dimensionen sowie ihre Überlegungen zu Grundwerten und Basiskriterien des Qualitätsmanagements (1996, S. 221ff.) lassen sich in dieses Modell ebenso einbeziehen wie der durch von Spiegel (1994) eingeführte Begriff der Konzeptqualität; diese kann nämlich als ein Aspekt der Potenzialqualität des Anbieters betrachtet werden. Auch andere gebräuchliche Differenzierungen des Qualitätsbegriffs sind integrierbar. Zur Überwindung einer nur auf die leistungserbringende Organisation und ihre Kunden ausgerichteten Blickrichtung wird das Modell um die wichtige Dimension der Infrastrukturqualität erweitert.
Zumindest als Systematisierungshilfe für eine Vielfalt von Sachverhalten, Rahmenbedingungen, Einflussfaktoren und sonstigen Phänomenen, die mit der Qualität sozialer Dienstleistungen zu tun haben, scheinen Modelle der beschriebenen Art nützlich zu sein. Sie entsprechen damit einem nicht nur akademischen Ordnungsbedürfnis und machen die fachliche Verständigung in mancher Hinsicht einfacher.
Um den Nutzen eines solchen Qualitätsmodells zu veranschaulichen, sind u. a. folgende Anwendungsmöglichkeiten denkbar:
- Raster für die Erstellung von Leistungsbeschreibungen,
- Raster für Dokumentationen wie Jahresberichte, Qualitätsberichte,
- Raster für strategische Planung und Schwerpunktsetzung,
- Raster für betriebliche Stärken- und Schwächenanalyse,
- Raster für den Einsatz von Evaluationsmaßnahmen.
Qualitätsmodell sozialer Dienstleistungen
Potenzialqualität des Anbieters (Einrichtungen und Dienste):
Leitfrage: Was kann die Organisation für die Leistungserbringung einsetzen?
- Konzepte (Normen/Werte, Didaktik/Methodik)
- Personal (Qualifikation, Motivation, Erfahrung)
- Organisation und Ausstattung (Aufbau, Abläufe, physisches Umfeld)
- Ressourcen (Kultur, Know-how, Finanzmittel)
- Marketing (Kontakte, Image, Bekanntheit)
Potenzialqualität des Nachfragers (KlientInnen und Kooperationspartner):
Leitfrage: Was bringen die "KundInnen" in die Leistungssituation ein?
- Problem (Ausgangssituation, Lösungsbedarf, Leidensdruck)
- Erwartungen (Problemverständnis, Anspruchshaltung, Informationsstand)
- Ressourcen (Fähigkeiten, Unterstützungspotenziale, Motivation)
- Integrationsbereitschaft (Kooperativität, Compliance/Noncompliance)
- Situative Faktoren (Wohnort, Erreichbarkeit, Mobilität)
Prozessqualität (Professionalität und Interaktion):
Leitfrage: Wie können die Organisationsmitglieder zu "gelingender Koproduktion" beitragen?
- Problemadäquates Procedere
- Transparenz des Leistungsgeschehens
- Zuverlässigkeit der Leistungserbringung
- Partizipation der Betroffenen
- Humanität der Beziehungsgestaltung
Ergebnisqualität (Aufgabenerfüllung und Situationserleben):
Leitfrage: Was konnte wie umgesetzt und erreicht werden?
- Leistungen/Output
- Wirkungen/Outcome
- Akzeptanz des Angebots/Zufriedenheit
- Kosten-Wirkungs-Verhältnis/Effektivität
- Kosten-Nutzen-Verhältnis/Effizienz
Infrastrukturqualität (Allokation und Vernetzung):
Leitfrage: Welchen Beitrag leistet die Organisation im Versorgungssystem?
- Bedarfsgerechtigkeit
- Zugänglichkeit
- Sicherheit
- Sozialverträglichkeit
- Wirtschaftlichkeit
[...]
[1] Der Begriff verdeutlicht, dass auch Anbieter sozialer Dienstleistungen "wirtschaften" müssen, dabei jedoch durch andere Zielsetzungen und Rahmenbedingungen geprägt sind als gewinnorientierte Unternehmen der Erwerbswirtschaft (Arnold & Maelicke, 1998, S. 20). Der Begriff "Nonprofit-Organisation (NPO)" wird synonym verwendet.
[2] Im BSHG § 93 bzw. im SGB XII §§ 75, 76 wird z. B. im Unterschied zu SGB VIII nicht von Qualitätsentwicklung svereinbarung, sondern von Prüfung svereinbarung gesprochen, deren Gegenstand jedoch neben der Wirtschaftlichkeit auch die Qualität der Leistungen ist.
[3] Dahme et al. (2004, S. 410) unterscheiden zwei zum Teil gegensätzliche Modernisierungsstrategien: eine des organisierten Wettbewerbs sowie eine des Kontraktmanagements.
[4] "Leitidee des Managerialismus ist die Neuordnung und Standardisierung von Arbeitsprozessen, um diese effizienter gestalten und umstellen zu können. Diese Aufgabe umfasst auch die Anforderung eines ökonomischen Umgangs mit den Humanressourcen und dementsprechend konstituiert der Managerialismus auch eine Technik 'zeitgenössischer Menschenführung' ..."(Wohlfahrt, o. J., S. 6). Sommerfeld & Haller (2003, S. 62) diskutieren den Begriff im Kontext der Befürchtung, dass die ohnehin fragile Professionalisierung der Sozialen Arbeit durch die "Subsumtion unter eine fremde Macht" – hier: der Betriebswirtschaft – ins Stocken gerät oder gar definitiv zerbricht.
[5] Damit ist der beklagenswerte Umstand gemeint, dass bei der bürokratischen Verwaltung des Sozialbudgets in der Praxis immer weniger bei den wirklich bedürftigen Zielgruppen ankommt – ein Problem der „allokativen Effizienz“.
[6] Der Pol "Gesellschaft" im Wohlfahrtsdreieck ist dabei als Summe der privaten Haushalte zu verstehen und verkörpert den Aspekt "Selbstversorgungsgrad"(vgl. Abelmann, 2005, S. 61).
[7] Die demokratische Wohlfahrtsgesellschaft ist geprägt von der „Rekonstruktion des Sozialen durch eine aktive und kompetente Gesellschaft.“ „Aufgabe der Politik ist es nicht, die Gesellschaft zu bedienen, sondern sie zu aktivieren“(Dettling, 1995, nach Keupp, 2000, S. 41).
[8] Anderer Auffassung sind Dahme et al. (2004, S. 413); die Verwaltung habe durch das Kontraktmanagement überall faktisch an Bedeutung und an Steuerungskapazität gewonnen.
[9] Die Entwicklung der sozialpolitischen Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern einerseits und Kommunen andererseits lässt sich als Zentralisierung von Entscheidungskompetenzen und Dezentralisierung der Aufgabenerbringung darstellen, wobei die Länder eine Vermittlungsposition einnehmen. Diese Aufgaben- und Kostenüberwälzung durch den Bundesgesetzgeber hat zur Folge, dass die kommunalen Gestaltungsspielräume vielerorts gegen Null tendieren (Backhaus-Maul, 1998, S. 39).
[10] Dahme et al. (2004, S. 412f) konstatieren, dass das Subsidiaritätsprinzip zwar nicht formell, jedoch faktisch auf dem Altar des Wettbewerbs geopfert worden sei; die Definitionsmacht über Fälle und Kosten werde beim Kostenträger (re)konzentriert, bei der Sozialverwaltung.
[11] "Betrieb“ wird hier als Oberbegriff für leistungserbringende Einrichtungen und Dienste verwendet und definiert als „organisierte Wirtschaftseinheit, in der verfügbare Mittel unter Wagnissen zur Erstellung von Leistungen und Abgabe dieser Leistungen an außenstehende Bedarfsträger eingesetzt werden“(Lechner/Egger/Schauer nach Horak, C., 1995, S. 12).
- Arbeit zitieren
- Peter Gerull (Autor:in), 2006, Qualitätsmanagement sozialer Dienstleistungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65862
Kostenlos Autor werden



















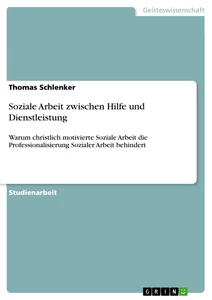


Kommentare