Leseprobe
Inhalt
Vorwort
1. Einleitung
1.1 Zentraler Auftrag von Einrichtungen der Behindertenhilfe
- Der Leistungsberechtigte im Mittelpunkt
1.2 Behindertenhilfe und soziale Sicherung als sozialstaatliche Errungenschaften
1.3 Notwendigkeit der Implementierung von QS-Maßnahmen
- Transparenz und Professionalisierung der Arbeit
- Sozialpolitische Entwicklungen – Sozialstaat in der Krise?
1.4 Dynamik der Übernahme eines QM-Systems aus der Wirtschaft
2. Leitbilder der Behindertenhilfe im Wandel der Geschichte
2.1 Historische Entwicklung
- Erbkrank und unheilbar
- Versorgt und verwahrt
- Entpsychiatrisiert und individualisiert
- Subventioniert und legalisiert
- Therapiert und isoliert
- Integriert und selbstbestimmt
2.2 Das Normalisierungsprinzip
2.3 Integration
2.4 Selbstbestimmtes Leben
- Assistenzkonzept
- Kundenmodell
- Empowerment
- Regiekompetenz
- Self-Advocacy
- Der Trialog
2.5 Vom Klienten zum Bürger
- Persönliche Zukunftskonferenz
- Supported Living
- Betreutes und Unterstütztes Wohnen
- Community Care
- Offene Hilfen
- Persönliches Budget
- Deinstitutionalisierung
2.6 Legitimation der ›Selbstbestimmt-leben-Forderung‹
- Humanistische Rechtfertigung
- Praktische Aspekte
3. Qualitätssicherung und marktwirtschaftliche Entwicklung in der sozialen Arbeit
3.1 Gesetzliche Vorläufer als Grundlagen von Qualitätssicherung in der Behindertenhilfe
- Pflegeversicherung – § 80 SGB XI
3.2 Novellierung des § 93 BSHG
- Relativierung der Vorrangstellung Freier Träger – § 93 / 1 BSHG
- Vergütung und Leistungsvereinbarung – § 93 / 2 BSHG
- Qualitätssicherung und -prüfung – § 93 a / 3 BSHG
- Gruppen mit vergleichbarem Hilfebedarf – § 93 a / 2 BSHG
4. Qualitätsentwicklung, -sicherung und -management
in der Behindertenhilfe
4.1 Ziele und Methoden von Qualitätssicherung in der Behindertenhilfe
4.2 DIN EN ISO 9000 ff
- ISO-Normen und Arbeitsprozesse
- Qualitätsdimensionen
- Qualitätsbeauftragte und Qualitätszirkel
- Qualitätshandbücher, Auditieren und Zertifizierung
- Dokumentation
4.3 Bereits bekannte Verfahren der Standardisierung
- PASSING
- LEWO
- SYLQUE
- FILM
4.4 Ermittlung des Hilfebedarfes nach Metzler – Leistungstypen
4.5 Externe Organisations- und Personalberater
5. Probleme von Markt, Wettbewerb und Standardisierung in der Behindertenhilfe
5.1 Der Wert des Ökonomischen kontra Humanität
- ISO 9000 – an der Wirtschaft orientiert
- Die Zertifizierung als Qualitätsnachweis?
- Ökonomisches Marktmodell
- Qualitätssteigerung durch Wettbewerb und Konkurrenz?
- Persönliche Lebensqualität oder ökonomisch orientierte Qualität?
- Erfolgsnachweis nach Input-Output-Muster
5.2 Der ›Kundenbegriff‹ – Chance oder Euphemismus?
- Dreiecksverhältnis Kostenträger-Institution-Klient
- Informationsasymmetrie und mangelnde Kundensouveränität
5.3 Probleme der Standardisierung im Sozialen Bereich –
normierende Qualitätsstandards kontra Individualisierung?
- Ausreichend und zweckmäßig statt bedarfsgerecht
5.4 ›Qualitätszirkus‹ als Mittel zur individuellen beruflichen Aufwertung
5.5 Erfahrungen von QS und Ökonomisierung im sozialen Bereich
- Qualitätsstandards in der Pflegeversicherung
- Beispiel USA – Ökonomie und soziale Qualität
5.6 Die Qualitätsdiskussion als Vorwand für Ökonomisierung? – Finanzmittelkürzungen kontra Menschenbild und Ethos in der Behindertenhilfe
- Dominanz der Marktorientierung – ideologische Verschleierung?
- Machtentfaltung von Wirtschaft – das Soziale als Hemmnis?
- Behindertes Leben als Kostenfaktor – eine neue Euthanasie?
- Ökonomisierung des Sozialen – Bedrohung des Sozialstaatsprinzips?
6. Praktische Erfahrungen mit Auswirkungen von Qualitätssicherung
6.1 Erheblicher zeitlicher Mehraufwand einzelner Maßnahmen
kontra individuelle Betreuungszeit
- Minuziöse Dokumentation – Pflege, Haushalt, Betreuung
- Einverständniserklärungen für Behandlungen und Verordnungen
- Hygieneverordnungen, Rückstellproben
- Taschengeld-Quittungen
- Audits und Q-Zirkel
7. Forderungen an ein sinnvolles QM-System
7.1 Besonderheiten von Beziehungsdienstleistungen und sozialer Qualität
- Potentialqualität und Outcome
- Interaktionalität der Teilwerte sozialer Qualität
7.2 Notwendigkeit permanenter Qualitätsentwicklung
- Soziale Qualität vor der Ökonomisierung –
Trend der Kundenorientierung in den 70er Jahren
- Lebensqualität und Lebenswertorientierung
- Notwendigkeit eines QS-System, das Klienten vor per-sönlich motiviertem und willkürlichem Wirken schützt
7.3 Individualisierung statt Standardisierung –
kundenorientierte kontra standardorientierte Qualität
- Nutzerbewertung von QS-Maßnahmen
- Angemessenheit der Dokumentation
7.4 Integration und Partizipation im Qualitätsmanagement-Konzept
- Organisationskultur und Unternehmensphilosophie
- Mitarbeiter als Beteiligte und nicht als Betroffene von QM-Maßnahmen
7.5 Ethische Grundlagen sozialer Arbeit
- Moral und Menschenwürde als Grundlage allgemeiner Sozialordnung
- Sicherung sozialer Qualität als ›Verteidigung des Sozialen‹
7.6 Fachlich und moralisch orientierte Qualitätsentwicklung
kontra ökonomisch dominantem QM
- Das Modell Niederlande
- Strukturelle Veränderungen seitens der Einrichtungs- und Kostenträger
- Qualitätssicherung als vorübergehende Modeerscheinung?
- Kritische Überlegungen zum Trend der Ökonomisierung
8. Anhang
- Duisburger Erklärung
- Glossar
Literaturverzeichnis
Sachregister
Vorwort
Vor einigen Jahren schien sich sowohl in meiner, als auch in der Wahrnehmung so mancher sozialer Fachleute die Natur der Arbeit in Wohneinrichtungen für Menschen mit einer (geistigen) Behinderung in entscheidenden Aspekten zu verändern.
Die karitative Werteordnung der Behindertenhilfe durfte sich durch die Novellierung der §§ 93 ff BSGH unerwartet über Zuwachs aus dem Bereich der Ökonomie freuen – nicht folgenlos für Klientel und Beschäftigte. Neue Begrifflichkeiten wie ›Wettbewerb‹, ›Markt-orientierung‹, ›Effizienzsteigerung‹ und ›Standardisierung nach ISO-Normen‹ sowie ›Qualitätssicherung‹ haben seitdem den Fachjargon von Pädagogen und Sozialarbeitern bereichert. Die Innovationen sollen dem Wohle der Betroffenen, also den behinderten Menschen dienen, was jedoch angesichts der praktischen Auswirkungen und vor dem Hintergrund der Herkunft der zugrunde liegenden DIN ISO 9000 – nämlich dem der Wirtschaft – schlicht euphemistisch klingt.
Die vorliegende Arbeit weist mitunter Analogien zu meiner (im Litera-turverzeichnis genannten) Abhandlung über das Thema ›Selbstbe-stimmung‹ aus dem Jahre 1999 auf, deren Inhalt ich im zweiten Kapi-tel in Teilen übernommen habe.
In ausdrücklicher Anerkennung der Emanzipation der Frau habe ich dennoch und lediglich der sprachlichen Ästhetik halber auf weibliche Termini wie ›BetreuerInnen‹ oder den Zusatz ›und Betreu-erinnen‹ im gesamten Text verzichtet. Hinsichtlich der Rechtschrei-bung liegen überwiegend (aber nicht ausschließlich) die neuen Regeln zugrunde; ausschlaggebend war auch hier mein ästhetisches Verständnis.
Obwohl ich diese Abschlussarbeit gemäß der Vorgaben der Diplom-prüfungsordnung selbständig angefertigt habe, sind im Folgenden dennoch einige Personen zu nennen, deren Hilfe sich unmittelbar und in erwähnenswertem Maße auf die vorliegende Ergebnisqualität aus-gewirkt hat.
Besonderer Dank ist an erster Stelle Rainer J. Freise auszu-sprechen, der mit unermüdlichem Einsatz sowohl für orthografische, syntaktische und logische Korrekturen zur Verfügung stand, als auch teilweise das ›Catering‹ übernahm. Ohne ihn läge dieser Text nicht in dieser Form vor. Der ›Theodor Fliedner Stiftung‹ gilt insofern ein zweifacher Dank, als sie mir einerseits Beispiele für die Grundlage meiner Arbeit lieferte und andererseits als Arbeitgeber den nötigen Urlaub bewilligt hat. Zu danken ist Herrn Professor Klaus-Joachim Spangenberg, der mit Empathie, Geduld und Sachverstand einen ganz erheblichen Beitrag zur Planung und Erstellung des Aufsatzes geleistet hat. Ein Dankeschön auch an Diana Holländer, die mit bril-lanter Schlüssigkeit sicher auch die allerletzten Unzulänglichkeiten dieser Arbeit aufgespürt hat. Weiterhin geht eine Danksagung an Herrn Matthias Peltzer, der quasi als exekutiver und abschließender ›Hardware-Operator/Provider‹ für die Vervielfältigung des Werkes zu-ständig war.
Und last but not least ist noch ein ganz besonderer Dank an die postmortale Anschrift einer nahen Verwandten zu richten, die durch den gut getimten Erbfall für die nötige materielle Strukturqualität der gesamten Realisierung gesorgt hat.
Duisburg, Februar 2003 Philip Schröder
1. Einleitung
Seit Anfang der neunziger Jahre ist die fachliche und institutionelle Entwicklung der Qualität der Behindertenhilfe, und damit die prak-tische Arbeit in den Heimen für behinderte Menschen in enorme Turbulenzen geraten und sieht sich mit ihr bisher fremden Qualitäts-interessen konfrontiert. Begriffe wie ›Qualitätssicherung‹ ›Effizienz-steigerung‹ und ›Controlling‹ halten Einzug in den Jargon von Erzie-hern, Sozial- und Heilpädagogen. Ehemals gültige Orientierungs-werte der Arbeit mit geistig behinderten Menschen, wie ›Selbst-bestimmung‹ und ›Individualisierung‹, verlieren zunehmend an Be-deutung, und ein betriebswirtschaftlich ausgerichtetes ›Qualitäts-management‹ erhält Leitfunktion – die Verwirrung ist groß.
„Die bisher im Sozial- und Gesundheitswesen gültigen Werte und Normen werden in Frage gestellt. Sie seien nicht mehr bezahlbar. Zugleich wird nach mehr Qualität gerufen – ein offensichtlicher Widerspruch, vor allem, wenn man in Rechnung zieht, dass es insgesamt noch nie so viel Geld gegeben hat wie heute, und dass auf der anderen Seite dem Sozial- und Gesund-heitsbereich in empfindlicher Weise Mittel entzogen werden, so dass logi-scherweise seine Qualität herabgesetzt wird“ (Speck 1999a, S. 11).
Vor der Zeit massiver wirtschaftlicher Rezession und ›leerer Kassen‹ war sozialen Diensten der Luxus vergönnt, sich ohne prinzipielle öko-nomische Erwägungen oder Schwierigkeiten an ihren Leitprinzipien und fachlichen Erkenntnissen und an den Bedürfnissen der betroffe-nen Menschen orientieren zu können. Die Öffentlichkeit interessierte sich auch relativ wenig dafür, nach welchen Qualitätsmaßstäben in den sozialen Einrichtungen gearbeitet wurde; nur gelegentlich kam es zu Aufsehen, wenn besonders eklatante und medienwirksame Miss-stände ans Tageslicht befördert wurden.
Was bis dahin die Qualität der Arbeit betraf, so entwickelten die Einrichtungen selber ein wachsendes Interesse an ›Lebensqualität‹, welche allerdings primär an fachlichen Merkmalen und der subjekti-ven Wahrnehmung der behinderten Menschen gemessen wurde; die ›Qualität der Arbeit‹ war weitestgehend synonym mit der ›persönli-cher Lebensqualität der Klienten‹. Es oblag auch ausschließlich den fachlich Verantwortlichen selber, sich um eine Verbesserung der fachlichen und institutionellen Qualität zu bemühen. QS (Qualitäts-sicherung) im heutigen Sinn geht weit darüber hinaus (vgl. Speck 1999b, S. 17).
Spätestens seit der Novellierung der §§ 93 ff des Bundessozial-hilfegesetzes (Kostenübernahme von Einrichtungen) im Jahre 1999 sind ›Qualitätssicherung‹ und ›Qualitätsmanagement‹ zu unumgäng-lichen Schlüsselbegriffen in der Sozialen Arbeit geworden. Auch den Institutionen und Mitarbeitern, die bislang der Diskussion über QM (Qualitätsmanagement) in der Sozialarbeit eher reserviert bis ableh-nend gegenüberstanden und darin mehr eine vorübergehende Mode-erscheinung sahen, bleibt mittlerweile nichts anderes mehr übrig, als die Auseinandersetzung mit Qualitätssicherungskonzepten als exis-tentielle Notwendigkeit hinzunehmen. Infolge der neuen gesetzlichen Anforderungen haben sich im gesamten Feld der sozialen Einrich-tungen die Rahmenbedingungen hinsichtlich der Finanzierung und hinsichtlich der Legitimation der geleisteten Arbeit erheblich verändert (vgl. Nüssle 1999, S. 106).
In den Vordergrund treten unaufhaltsam neue und fachfremde Werte, vornehmlich ökonomischen Ursprungs, wie Produktivität, Wettbewerb oder Effizienz. Auch soziale Dienstleistungen werden nun privatisiert und dem Wettbewerb des Marktes ausgesetzt.
Zugleich ändern sich mit der Durchsetzung ökonomischer Werte auch kulturelle und sozialethische Mentalitäten: Behindertes Leben wird (wiederum) als ›lebensunwertes Leben‹ bewertet und als Kostenfaktor auf den utilitaristischen Prüfstand gestellt; es schließen sich Überlegungen an, den Aufwand, der nicht unmittelbar der ›Pro-duktivität‹ dient, zu überprüfen und zu rationalisieren – eine Demon-tage von Solidarität mit Behinderten zeichnet sich ab (vgl. Speck 1999a, S. 13 f).
Die immer augenfälliger werdenden Kontraste und Widersprüche las-sen daran zweifeln, dass marktwirtschaftliche Bedingungen für den Bereich der karitativen Tätigkeiten zu wünschenswerten Verhältnis-sen führen.
Vermehrt tauchen Fragen auf, die sich mit dem Ursprung dieses Wertewandels auseinandersetzen. Ging es bei der Einführung von Markt, Wettbewerb und Qualitätsprüfungen vordergründig um die Verbesserung der Lebensqualität der betroffenen Menschen oder war der Wunsch nach Kosteneinsparungen die Intention? Handelt es sich nur um eine vorübergehende Finanzkrise, oder haben wir es mit einer grundlegenden gesellschaftlichen Neuordnung zu tun? Zumindest sieht sich das Prinzip der sozialen Sicherung und Integration behin-derter Menschen in Frage gestellt bzw. an den Rand gedrängt; die Gesellschaft scheint vor einer Spaltung zu stehen (vgl. a.a.O.).
Mit der vorliegenden Arbeit habe ich versucht, offensichtliche Schwie-rigkeiten, Widersprüche und mögliche Verschleierungen im Zusam-menhang mit QM und Qualitätssicherung in Institutionen der Be-hindertenhilfe – insbesondere aus Sicht und Interessenlage geistig behinderter Menschen – offenzulegen und einen Beitrag zur Entwick-lung klientenzentrierter Qualitätskriterien zu leisten.
1.1 Zentraler Auftrag von Einrichtungen der Behindertenhilfe
Institutionen der Behindertenhilfe sind in erster Linie gemeinnützige Organe sozialstaatlichen Handelns, die als ›Non-Profit-Unternehmen‹ und für öffentliche Gelder und in treuhänderischer Verwaltung Dienst-leistungen erbringen, die behinderten Menschen per Rechtsanspruch zustehen.
Darüber hinaus sehen sich alle sozialen Einrichtungen auf dem Weg zu einer qualitätsvollen Dienstleistungsgesellschaft vor die Auf-gabe gestellt, sich umzuorientieren und dabei gleichzeitig die traditio-nellen in ihren Leitbildern festgeschriebenen Werte beizubehalten. Vor dem Hintergrund der veränderten gesetzlichen Rahmenbedin-gungen sind nun auch die Einrichtungen der Behindertenhilfe ver-stärkt mit der Aufgabe konfrontiert, sich mit Fragen nach der Qualität der von ihnen zu erbringenden Leistungen auseinanderzusetzen.
Da zur Bestimmung dieser Qualität Wertesysteme eingeführt wurden, die bislang eine gänzlich untergeordnete Rolle im Bereich des sozialen Helfens gespielt haben, und weil die Einrichtungen nach wie vor an einer eigenverantworteten Weiterentwicklung ihrer profes-sionellen Fachlichkeit interessiert sind, vollzieht sich die gegenwärtige Diskussion um Qualitätssicherung und -entwicklung in einer ungeheu-ren normativen Spannung, die neue Antworten herausfordert (vgl. Speck 1999b, S. 13).
Bei allen notwendigen Erneuerungen, Umstrukturierungen und öko-nomischen Sachzwängen sollte jedoch auch in Zukunft das ›selbst-bestimmte Leben‹ von Menschen mit geistiger Behinderung und deren Wunsch- und Wahlrecht für ein weitgehend selbständiges Wohnen die Grundlage und der Motor allen Handelns und aller Planungen innerhalb der Behindertenhilfe sein (vgl. Lebenshilfe-Verlag 2002, S. 2). Dieser zentrale Auftrag von Einrichtungen für be-hinderte Menschen muss auch der Mittelpunkt der Qualitätssiche-rungssysteme bleiben, d. h. Lebensformen, die sich auf Interaktionen, Kommunikation und alle Dimensionen des Miteinanders beziehen, müssen durch Erhebungsmethoden abgebildet und erarbeitet wer-den, die diesen komplexen und systemischen Zusammenhängen gerecht werden können (vgl. Bader 1996, S. 24).
- Der Leistungsberechtigte im Mittelpunkt
„Personen, die […] körperlich, geistig oder seelisch wesentlich be-hindert sind, ist Eingliederungshilfe zu gewähren“, deren Aufgabe es u. a. ist, „den Behinderten in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört vor allem, dem Behinderten die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen“, heißt es im § 39 des Bundessozial-hilfegesetzes (BSHG). Diese Formulierung ist Grundlage des Rechtsanspruches, den ein Leistungsberechtigter vor allem auf ambulante oder stationäre Maßnahmen der Eingliederungshilfe hat. Der Sozialhilfeempfänger ist seit dem grundlegenden Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Rechtsanspruch auf Sozialhilfe (BverwG 1, 159) nicht lediglich Objekt sozialer Hilfe, sondern Inhaber einer subjektiven Rechtsposition, die dieser auch im Rechtswege verfolgen kann.
Wenn nun gemäß der neuen gesetzlichen Anforderungen ›Grundsätze für die Qualitätssicherung‹ der zu erbringenden Leis-tungen einer Einrichtung festgelegt werden müssen (vgl. Kap. 3.2, S. 63), sollte man davon ausgehen, dass auch in diesem Zusammen-hang der Leistungsberechtigte das Maß aller Bemühungen ist, zumal neue Formen des Qualitätsmanagements im Sachbereich der Sozial-hilfe explizit den Sozialhilfebedürftigen als ›Kunden‹ fokussieren.
Angesichts der Realitäten der Sozialhilfe ist das jedoch eine euphemistische Wortwahl – vor allem, wenn noch ergänzt wird, dass „Qualität bedeutet, die Zufriedenheit des Kunden anzustreben, dies mit so geringen Kosten wie möglich zu erreichen und dabei Motivatio-nen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden zu berücksichtigen“ (Bap-tiste, zit. b. Wienand 1999, S. 36).
Unter diesen teils widersprüchlichen Vorgaben ergeben sich hinsichtlich der zu sichernden Qualität etliche Fragen: Welche Qualität mit welchen Eckpunkten ist eigentlich in der Sozialhilfe zu sichern? Wie hält man es mit einem Recht, gar einem Grundrecht auf freie Wahl des Leistungserbringers, wie mit dem Wunsch- und Wahl-recht, wie mit dem Wunsch des Schwerbehinderten, ambulant und nicht stationär betreut zu werden, wie mit dem Spannungsverhältnis zwischen Gebot zur Selbsthilfe und Verbot der Selbstbeschaffung von sozialen Dienstleistungen? Welche Qualität der sozialen Hilfe ist schließlich zugrunde zu legen, wenn es einmal um die Mehrkosten stationärer Unterbringung geht, das andere Mal um die Mehrkosten ambulanter Hilfe?
Tatsache ist, dass diese Fragen nicht allein im Binnenverhältnis zwischen dem leistungsberechtigten Sozialhilfeempfänger und dem Leistungserbringer (Einrichtung) beantwortet werden können, da der Sozialhilfeträger hier auch ein Wort mitzureden hat. Es besteht ein Dreiecksverhältnis der Art, dass qualitative Festlegungen bilateral zwischen Sozialhilfeträger und Einrichtung, aber auch zwischen Sozialhilfeträger und dem behinderten Menschen sowie zwischen Einrichtung und dem Behinderten denkbar sind (vgl. Kap. 5.2, S. 94 f, und Wienand 1999, S. 36).
Jenseits aller nüchternen juristischen und verwaltungstechnischen Formulierungen obliegt es letztendlich den Institutionen der Behinder-tenhilfe, dem Rechtsanspruch ihrer Klientel in Form von fachlichen Konzepten und qualitätsleitenden Grundsätzen Gestalt zu verleihen. Denn eines steht fest: Ob Leistungsberechtigter, Kunde, Klient, Betreuter oder Bewohner – immer gilt der Mensch und dessen Zu-friedenheit als oberstes Gebot von Qualität (vgl. Baur/Hartmann-Templer 1999, S. 262).
Wichtig und fachlich anspruchsvoll wird zukünftig die Aufgabe sein, vermehrt aussagekräftige Formen zu finden, wie Menschen mit geistiger Behinderung in den Prozess der Qualitätsentwicklung sowie die Beurteilung über ihre Wohnsituation miteinbezogen werden können (vgl. Schädler 1998, S. 15).
1.2 Behindertenhilfe und soziale Sicherung als sozialstaatliche Errungenschaften
Deutschland kann mit Stolz auf die Tradition und die – Geschichte gewordenen – gesellschaftlichen Errungenschaften seines Sozial-staates zurückblicken, wie z. B.
- die Krankenversicherung für Arbeiter (seit 1883)
- die Unfallversicherung (seit 1884)
- die Invaliden- und Altersversicherung (seit 1889)
- die Arbeitslosenversicherung (seit 1927)
- die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (seit den 1950er Jahren)
- die Koppelung der Renten an die Lohnentwicklung und
- die Pflegeversicherung (seit 1995).
Im Bereich der Behindertenhilfe sind die verschiedensten Gesetze, Einrichtungen und Maßnahmen zur sozialen Sicherung und Rehabili-tation zu nennen:
Nach § 10 des Ersten Buches SGB (Sozialgesetzbuch) soll jeder Behinderte oder von einer Behinderung Bedrohte ein ›soziales Recht‹ auf diejenige Hilfe haben, die notwendig ist, um (1) eine Be-hinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu verbessern, ihre Verschlim-merung zu verhüten oder Ihre Folgen zu mildern, und um (2) diesen Menschen einen ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz im gesellschaftlichen Leben, vor allem im Arbeitsleben, zu sichern.
1961 entstand das ›Bundessozialhilfegesetz‹, dessen Bestim-mungen zur „Eingliederungshilfe für Behinderte“ (BSHG § 39 ff) wie-derholt verbessert wurden.
1974 erhielten nach dem ›Schwerbehindertengesetz‹ „alle Schwerbehinderten“, unabhängig von der Art und Ursache ihrer Behinderung, nun ein „Sonderrecht auf Beschäftigung und Sicherung ihrer Arbeitsplätze“. Zu deren „langfristiger Sicherung wurde für sie ein erweiterter Kündigungsschutz“ eingeführt. Es sollte „Chancen-gleichheit im beruflichen Wettbewerb mit Nichtbehinderten“ herge-stellt werden.
Im Rahmen von Ländergesetzen erlangten u. a. die Prinzipien der sozialen Eingliederung, der Normalisierung und der Orientierung der Hilfe an den individuellen Bedürfnissen rechtliche Geltung.
Eine Erhebung aus dem Jahre 1998 wies schätzungsweise 8-10 % der Gesamtbevölkerung aus, denen die genannten Hilfen zugute kamen. Die sozialen Rechte dieses Personenkreises konnten sich auf die im Grundgesetz verankerten Grund- und Menschen-rechte stützen, wonach allen Bürgern der Bundesrepublik die ›Ach-tung der Menschenwürde‹, das ›Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit‹, die ›freie Entfaltung der Persönlichkeit‹ und die ›Be-achtung des Sozialstaatsgrundsatzes‹ garantiert wird. Ausdrücklich wurde im Jahr 1994 noch das Grundgesetz im Art. 3 Abs. 3 durch den Satz erweitert: „Niemand darf wegen seiner Behinderung be-nachteiligt werden“ (vgl. Speck 1999a, S. 15 f).
Als sozialpolitische Erneuerung der jüngeren Vergangenheit ist natür-lich in unserem Zusammenhang an erster Stelle die Novellierung der §§ 93 ff BSHG zu nennen, die nach wie vor noch nicht abge-schlossen ist. Dies gilt ebenso für die praktische Umsetzung des seit Juli des letzten Jahres bestehenden neuen SBG IX (›Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen‹). Ziel dieses neuen Gesetz-buches soll eine höhere Transparenz hinsichtlich der verschiedenen Gesetze sein, die in der Bundesrepublik zur Rehabilitation von Men-schen mit Behinderung gelten.
Das bereits im letzten Jahr verabschiedete 3. Gesetz zur Ände-rung des ›Heimgesetzes‹ ist zum 1. Januar 2002 in Kraft getreten. Ziel dieser Heimgesetzänderung war es, ein an den Grundsätzen der Menschenwürde ausgerichtetes Leben für ältere und behinderte Men-schen in Heimen zu sichern und die Qualität der Betreuung und Pfle-ge weiterzuentwickeln, es sollte mehr Schutz, mehr Transparenz und mehr Mitwirkung für Menschen mit Behinderung ermöglicht werden, wobei die konkrete Umsetzung für den Bereich der Eingliederungs-hilfe mangels ausgearbeiteter fachlicher Methodik in Teilbereichen außerordentlich schwierig ist.
Das ›Bundesgleichstellungsgesetz‹ für behinderte Menschen ist am 1. Mai 2002 in Kraft getreten. Kernstück dieses Gesetzes ist die Herstellung barrierefrei gestalteter Lebensbereiche, d. h. Menschen mit Behinderung sollen zu allen Lebensbereichen einen umfassenden Zugang und eine uneingeschränkte Teilhabe an diesen bekommen; sie sollen nicht mehr Objekte staatlichen Handelns sein, sondern ihr Leben selbst in die Hand nehmen und aktiv gestalten können.
In einer gemeinsamen Tagung der Evangelischen Akademie und des Fachverbandes am 20. Juni 2002 in Mülheim wurde das Gleichstellungsgesetz vorgestellt und seine Auswirkungen diskutiert. Schwerpunktmäßig wurde die Frage thematisiert, wie das Gesetz im Alltag umgesetzt werden kann und welche Konsequenzen dies z. B. für verschiedene Lebensbereiche, aber auch für behinderte Men-schen selbst hat (vgl. Fachverband Behindertenhilfe 2002, S. 4 ff).
Wenn auch gerade die in den vergangenen drei Jahren zum Thema ›Rehabilitation und Rechte Behinderter‹ eingeführten Gesetze zum einen kaum in ihrer praktischen und konsequenten Umsetzung über-zeugen und zum anderen sogar teils Widersprüchlichkeiten unterein-ander aufweisen (vgl. Kap. 5.3, S. 97 f), so bleibt doch unbestritten, dass sich die Grundausrichtung von Behindertenpolitik und Behinder-tenarbeit heutzutage an der ›Selbstbestimmung‹ Betroffener orien-tieren muss. Das gebietet nicht zuletzt der durch die Behinderten- und Krüppelbewegung erfochtene Fortschritt in der Behindertenarbeit und das durch große Teile dieser Bewegung im Verbund mit vielen Organisationen durchgesetzte und bereits erwähnte Diskriminie-rungsverbot des Artikels 3 Abs. 3 GG vom Oktober 1994 (vgl. Steiner 1999, S. 1).
1.3 Notwendigkeit der Implementierung von QS-Maßnahmen
Die Gründe für eine Notwendigkeit von Qualitätssicherung in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen sind vielfältig und stellen gewiss keine Innovation dar, die erst im Zuge erwähnter Gesetzes-änderungen entstand (vgl. Kap. 7.2, S. 134 f).
Die Verpflichtung, um eine Verbesserung der Lebensqualität behinderter Menschen besorgt zu sein, orientiert sich im wesentlichen an deren Bedürfnissen und den fachlich-professionellen Erfordernis-sen, um ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen (vgl. Speck 1999a, S. 30). Neben der ohnehin erforderlichen anwaltschaftlichen Kontrolle der Betreuung geistig Behinderter, um Übergriffen und Missbrauch entgegenzuwirken, besteht insbesondere in der stationä-ren Behindertenhilfe aufgrund des essentiellen psychologischen Stel-lenwerts des ›Wohnens‹ im Leben eines Menschen der dringende Bedarf, die Qualität der zugrunde liegenden Strukturen zu prüfen und sicherzustellen (vgl. Flade 1987, S. 52 ff).
„Damit der Mensch mit sich und seiner Umwelt im Einklang leben kann, muss seinen Wohnbedürfnissen Rechnung getragen werden.
Gerade in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen muss dieser Erkennt-nis eine besondere Bedeutung beigemessen werden, da diese meist nur begrenzt in der Lage sind, ihre Wohnung, bzw. ihre Wohngruppe selber zu gestalten oder auf die Abläufe und Struktur eines Heimbetriebes wesentlich Einfluss zu nehmen. Hier sind sie oftmals auf Gedeih und Verderb auf ihre Betreuer angewiesen“ (Schröder 1999, S. 5).
Schließlich schafft sich der Mensch durch Bauen einer Behausung nicht nur einen Schutz vor Witterungseinflüssen, vielmehr hat er einen wichtigen und festen Bezugspunkt, von dem nach E. F. Boll-now (in Flade 1987, S. 13) alle Wege eines Menschen ausgehen und zu dem sie wieder zurückführen, der die Lebensmitte und der Ort ist, an dem er wohnt und wo er zu Hause ist. Heimkehren können bedeutet, verwurzelt zu sein, und hat einen elementaren Stellenwert im Leben eines Menschen.
„Unsere Wohnung bietet uns Schutz und Geborgenheit. Sie ermöglicht uns, allein zu sein oder mit anderen zusammenzuleben. Sie ist ein Stück un-mittelbare Umwelt. Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen sind [...] fast ausnahmslos auf stationäre Heimeinrichtungen angewiesen. Die Wohneinrichtung soll dem Menschen mit Behinderung alles ermögli-chen, was wir alle in unseren vier Wänden für selbstverständlich halten“ (Das Band 1998, S. 1).
Angesichts dieser enormen Relevanz der Wohnumgebung eines Menschen wäre es aus humanen Gründen nicht verantwortbar, die Qualität von Wohnheimen oder -gruppen für geistig Behinderte aus-schließlich dem individuellen Geschick der zuständigen Betreuer, also letztlich dem Zufall, zu überlassen.
Ein weiterer wichtiger Bedarf an festgelegten Qualitätsmaßstäben er-gibt sich schließlich auch aus der Tatsache, dass Institutionen der Behindertenhilfe (von einigen wenigen ›Selbstzahlern‹ abgesehen) treuhänderisch mit öffentlichen Geldern haushalten, deren sinnvolle und qualitätsbewusste Verwendung es auch für die Öffentlichkeit zu belegen gilt.
- Transparenz und Professionalisierung der Arbeit
Neben dem Erfordernis der Rechenschaftslegung für die öffentliche Hand sind die Überprüfung und das Sichtbarmachen der Vorgänge innerhalb karitativer Einrichtungen für die Professionalisierung sozia-ler Arbeit von grundlegender Bedeutung.
Qualitätsentwicklung und -sicherung muss sich zum Ziel set-zen, Transparenz und Verbindlichkeit für die Dienstleistungen der Behindertenhilfe aufzubauen, um so eine weitgehende Übereinstim-mung zwischen den vorgegebenen Qualitätszielen der Einrichtung und den konkreten betreuerischen Maßnahmen zu erreichen (vgl. Bader 1996, S. 25).
- Sozialpolitische Entwicklungen – Sozialstaat in der Krise?
Ein zusätzlicher Bedarf an Methoden zur Überprüfung sozialstaat-licher Leistungen ergebe sich – laut der Befürworter von Qualitäts-sicherung – aus einer veränderten wirtschaftlichen Lage, die dazu zwinge, dass bisher als selbstverständlich angesehene Leistungen auf ihre Notwendigkeit hin untersucht und rationalisiert werden müssen.
Die Zeiten, in denen sich die zu leistenden Maßnahmen für Be-nachteiligte und Schwache in unserem Land ohne ökonomische Zwänge ausschließlich am Bedarf orientierten, scheinen seit Anfang der neunziger Jahre eine Wendung genommen zu haben. Durch eine rapide gestiegene Zahl der Erwerbslosen, durch die Kosten der Wie-dervereinigung und die demographische Entwicklung in der Bundes-republik hat sich sie Sachlage derart verändert, dass die allgemeine soziale Sicherung nun nicht mehr von einer genügend großen Zahl Erwerbstätiger sichergestellt wird. Immer weniger Erwerbstätige müssen für immer mehr arbeitslose und alte Menschen Steuern und Sozialabgaben aufbringen. Es klafft eine Finanzierungslücke, die zur Zeit des Inkrafttretens des BSHG und der ›Vollbeschäftigung‹ in den sechziger Jahren nicht abzusehen war.
Es ist allgemein von einer ›Finanzkrise des Staates‹ die Rede, in deren Folge sich dieser nun veranlasst sieht, seine sozialen Siche-rungsverpflichtungen zu überprüfen und zu rationalisieren. Ange-sichts der knappen Mittel werden die Sozialleistungen insgesamt als überzogen kritisiert; gefordert werden die ›Verschlankung‹ des So-zialstaates und eine ›neue Kultur der Selbständigkeit‹. ›Weniger Staat‹ und gleichsam mehr private Verantwortlichkeit sollen sogar eine nötige qualitative Verbesserung des Sozialwesens mit sich bringen, ist seitens der Ökonomen und verantwortlichen Sozial-politiker zu vernehmen (vgl. Speck 1999a, S. 17 ff).
1.4 Dynamik der Übernahme eines QM-Systems aus der Wirtschaft
Auffällig an dem gegenwärtigen Umwälzprozess im Sozialbereich ist die extrem kurze Vorwarnzeit von – wenn man von der Novellierung des BSHG im Jahre 1994 ausgeht – lediglich vier Jahren. Damals wurden die Mitarbeiter der Behindertenhilfe mit der Nachricht konfron-tiert, dass demnächst ›Umfang und Qualität der angebotenen Leis-tungen über bestimmte Kriterien nachprüfbar‹ sein müssten (vgl. Kap. 6, S. 111 f).
„Wer die Geschichte der Sozialen Arbeit und der Heilpädagogik seit Jahr-zehnten kennt, ist jedenfalls in hohem Maße überrascht, wie rasch das in religiösen und humanistischen Werte- und Leitsystemen tief verankerte System der Sozialen Hilfe durch bisher fremde Gesichtspunkte und Werte gründlich durcheinandergebracht werden konnte, und wieviel Dynamik […] in Sachen Qualitätssicherung ausgelöst wurde. Zu denken gibt auch die Tatsache, dass ein neues Arbeitsgebiet mit eigenem QM-Know-how und auch neuen Arbeitsplätzen, also neuen Kosten, etabliert worden ist, die sog. Qualitätsbeauftragten oder Qualitätsmanagement-Fachkräfte, und das unter dem Aspekt von Kostendämpfungsabsichten“ (Speck 1999b, S. 16)!
Die ausnehmend große Bedeutsamkeit und der einschneidende Cha-rakter der ›Qualitätssicherungsdebatte‹ in der Behindertenhilfe wer-den vor dem Hintergrund der in Jahrzehnten entstandenen und kon-sequent weiterentwickelten Fachlichkeit und Werteordnung dieses Arbeitsbereiches besonders deutlich.
2. Leitbilder der Behindertenhilfe im Wandel der Geschichte
Um die Besonderheit der sich momentan vollziehenden Erneuerun-gen im Zusammenhang mit Qualitätsmanagement und -sicherung zu veranschaulichen, soll im Folgenden sowohl ein Überblick über den historischen Wandel innerhalb der Behindertenhilfe, als auch über den aktuellen fachlichen Diskurs – insbesondere hinsichtlich des ›Pa-radigmas der Selbstbestimmung‹ – gegeben werden.
Seit Beginn der Professionalisierung der Behindertenhilfe sahen sich Helfer wie Betroffene regelmäßig mit neuen Leitbildern und Modellen konfrontiert, die die Arbeit mit behinderten Menschen in unterschiedlicher Intensität beeinflussten. Neue Prinzipien und Para-digmen besitzen oft Aufforderungscharakter, problematisieren und stellen die bis dahin bewährte Praxis auch immer – wenigstens teil-weise – in Frage (vgl. Bradl 1996, S. 363). Manche einst revolutio-nären Ansätze sind mittlerweile längst etablierte Handlungsgrund-sätze und aus der Praxis nicht mehr wegzudenken.
2.1 Historische Entwicklung
Die Entwicklung im Umgang mit geistig behinderten Menschen macht eine sich verändernde gesellschaftliche Einstellung gegenüber Men-schen mit Behinderungen deutlich. Wenngleich diese Haltung bereits mit der Ausbreitung des Christentums weitgehend durch eine ent-sprechende Ethik geprägt und Fürsorge von Behinderten ein selbst-verständlicher Akt der Nächstenliebe war, so stellt die Zeit des Natio-nalsozialismus in Deutschland eine derart massive Regression dar, dass hier ein Neuanfang einsetzen musste, der in den Fokus der Betrachtung zu stellen ist (vgl. Hähner 1999a, S. 25 f).
Die Forderung nach einem selbstbestimmten Leben geistig behinder-ter Menschen verunsicherte zunächst die Fachwelt, wie es bei ähn-lich auffordernden Prinzipien in der Vergangenheit entsprechend war. In den 60er und 70er Jahren wurde ›Rehabilitation und Förderung‹ statt ›Verwahrung‹ gefordert, in den 70er und 80er Jahren ›Norma-lisierung‹ statt ›Besonderung‹ und in den 80er und 90 Jahren wurde die Forderung nach ›Integration‹ laut (vgl. Bradl 1996, S. 363).
Der hier relevante Begriff der ›Selbstbestimmung‹ hatte seine Wurzeln bereits Ende der 60er Jahre in der ›Independent-Living-Bewegung‹, einer Bürgerbewegung körperbehinderter Menschen in den USA. Hieraus entwickelte sich bezogen auf Menschen mit einer geistigen Behinderung die ›People-First-Bewegung‹ (People first = Zuerst sind wir Menschen), deren Forderungen in Deutschland je-doch erst ab Mitte der 80er Jahre Einfluss auf die Arbeit mit geistig Behinderten zu nehmen begann (vgl. Hähner, 1998a, S. 27 ff).
Obwohl die ›Selbstbestimmt-leben-Forderung‹ kein grundsätz-lich neues oder revolutionäres Gedankengut enthält, hat sie wie kein anderer Paradigmenwechsel ganz erheblich am Selbstverständnis der meisten Pädagogen gekratzt und allmählich begonnen, deren bis-herige Auffassung von Behinderung in Frage zu stellen (vgl. Schrö-der 1999, S. 8). Ein Blick auf die historische Entwicklung der Behin-dertenhilfe in Deutschland seit 1945 (ehem. DDR bleibt unberücksich-tigt) soll dies veranschaulichen.
- Erbkrank und unheilbar
Das ›Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses‹ wurde 1933 von den Nationalsozialisten erlassen und legitimierte so die Zwangs-sterilisation von einigen hunderttausend Menschen.
Nach Kriegsbeginn sorgte Hitler durch einen Geheimerlass für den ›Gnadentod für unheilbar Kranke‹, was die systematische Ermor-dung Behinderter und psychisch Kranker in den Tötungsanstalten der Euthanasie sowie die Tötung in psychiatrischen Einrichtungen durch Hunger, Überdosierung von Medikamenten und Nichtbehandlung von Krankheiten beinhaltete (vgl. Hähner 1998a, S. 26 f).
- Versorgt und verwahrt
In der deutschen Nachkriegsgeschichte galten in der Arbeit mit geis-tig behinderten Menschen Handlungsansätze, die sich mit den Begrif-fen ›Verwahren‹ und ›Fördern‹ umreißen lassen (vgl. a.a.O, S. 25).
Nach dem Krieg wurden in vielen Fällen die geistig behinderten Menschen von gleichem Personal in den gleichen psychiatrischen Krankenhäusern betreut wie vor dem Kriegsende. Das Konzept war eine karitativ motivierte pflegerische Versorgung der behinderten Menschen, wobei ›Behinderung‹ zwangsläufig die Diagnose ›Pflege-fall‹ zur Folge hatte und somit zur Einweisung und Anstaltsunterbrin-gung führte. In die Oligophrenenabteilungen der Psychiatrien einge-wiesene Menschen mussten sich aufgrund dieser Etikettierung weit-gehend im Bett aufhalten (vgl. Schröder 1999, S. 8 f).
Die Unterbringung von geistig behinderten Menschen in Psy-chiatrien stellte nach dem Krieg die Normalität in Deutschland dar. Theunissen bezeichnet das hier zu Grunde liegende Menschenbild als ›biologistisch-nihilistisch‹ (1998, S. 154 ff). Aussagen wie ›bildungsunfähig‹, ›total spielunfähig‹ oder ›lernunfähig‹ weisen auf einen als unveränderbar angesehenen feststehenden Defekt hin, der einen normalen menschlichen Lebenslauf und Selbstverwirklichung unmöglich macht. Vor diesem Hintergrund beschränkte sich die Betreuung der Menschen auf eine rein pflegerische Versorgung der ›Patienten‹ (vgl. Hähner 1998a, S. 26 ff). Es ist festzustellen, dass viele der vermeintlichen Defekte und Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung auf die Anstaltsunterbringung zurückzuführende Symptome waren.
„Der Patient verschließt sich langsam immer mehr in sich selbst, wird ener-gielos, abhängig, gleichgültig, träge, schmutzig, oft widerspenstig, regrediert auf infantile Verhaltensweisen, entwickelt starre Haltungen und stereotype Ticks, passt sich einer extrem beschränkten und armseligen Lebensroutine an, aus der er nicht einmal mehr ausbrechen möchte. [...] Wenn man einem Insassen seine menschliche Würde nimmt, wird sein Verhalten unwürdig und unmenschlich, wenn er dauernder Bewachung, brutalen Freiheits-beschränkungen, Missbrauchshaltungen und psychischen Gewalttätigkeiten ausgesetzt ist, wird sein Verhalten um so ärmer, würdeloser, feindseliger, verzweifelter und gewalttätiger“ (Jervis zit. b. Hähner 1998a, S. 27).
- Entpsychiatrisiert und individualisiert
Die ›Psychiatrie-Enquête‹ stellt im Jahre 1975 fest, „dass von einer Minderzahl eindeutig krankenhausbedürftiger geistig Behinderter ab-gesehen, das psychiatrische Krankenhaus für die Behandlung und Betreuung dieser Personengruppe nicht geeignet ist. Geistig Behin-derte bedürfen in erster Linie heilpädagogisch-sozialtherapeutischer Betreuung, die ihnen in der Regel in hierfür geeigneten Einrichtungen außerhalb des Krankenhauses angeboten werden sollte“. Die Bedin-gungen seien „elend“ und „zum Teil menschenunwürdig“ (zit. b. Häh-ner 1998a, S. 27). Fast ein Fünftel aller in psychiatrischen Einrich-tungen Untergebrachten waren Menschen mit einer geistigen Behin-derung.
Die Empfehlung, Behinderteneinrichtungen außerhalb psychia-trischer Einrichtungen zu installieren, wurde zuerst vom Landschafts-verband Rheinland übernommen. Es wurden eigenständige Heime eingerichtet, die Forderung nach Dezentralisierung und dem Ausbau kleiner, gemeinwesenorientierter Hilfsangebote wurde gestellt. Nur durch das gemeinsame Vorgehen von Politik und Wissenschaft mit den Praktikern wurde dieser Schritt der Enthospitalisierung möglich, was einen wesentlichen Beitrag zur Humanisierung der Arbeit mit behinderten Menschen in der Bundesrepublik darstellte (vgl. Schrö-der 1999, S. 11).
- Subventioniert und legalisiert
Die 60er Jahre bezeichnet Hähner als die „Dekade des Aufbruchs“ (1998a, S. 28), in denen wichtige sozialpolitische Entscheidungen getroffen wurden. Im Jahre 1961 wurde das Bundessozialhilfegesetz erlassen, in dem nach dem Subsidiaritätsprinzip der Vorrang der freien Wohlfahrtspflege beim Ausbau und der Errichtung von Einrich-tungen der Behindertenfürsorge festgesetzt wurde.
Die Elternverbände ›Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind‹ und der ›Verband für spastisch Gelähmte und andere Körper-behinderte‹ wurden Ende der 50er Jahre gegründet. Da in den 50er Jahren noch keine Kindergärten und Schulen für behinderte Kinder existierten, waren Eltern um die Gründung von Vereinen bemüht, die ihnen Entlastung verschafften.
Die 60er und 70er Jahre waren – auch dank des wirtschaftli-chen Aufschwunges – durch die Gründung vieler Förder-, Rehabilita-tions- und Sondereinrichtungen gekennzeichnet. 1964 konnte man im ZDF zum ersten Mal die Sendung ›Aktion Sorgenkind‹ sehen, die durch eine publikumswirksame Mixtur aus Show, Quiz, Lotterie und karitativem Gedanken nicht unerhebliche Gelder in die Einrichtungen der Behindertenhilfe fließen ließ – im übrigen auch heute noch kein unwesentlicher Hilfefaktor.
„Zementiert wurde dabei allerdings die gesellschaftliche Tendenz, den Um-gang mit (und das heißt immer häufiger die Therapie von) behinderten Men-schen außerhalb von Regeleinrichtungen zu realisieren und speziellen Fach-leuten zu übertragen. Aktion Sorgenkind gab damit dem gesellschaftlichen Umgang mit Behinderten keine eigenen neuen Impulse, sondern griff Ent-wicklungen und Tendenzen auf und verstärkte bzw. verbreitete sie unterm Publikum“ (Heiler zit. b. Hähner 1998a, S. 29).
- Therapiert und isoliert
Das Phänomen ›Geistige Behinderung‹ wurde zunehmend für die Wissenschaft interessant, so dass Mitte der 60er Jahre das vermehr-te Interesse an einer neuen Fachdisziplin für die Schaffung des ersten Lehrstuhls für Geistigbehindertenpädagogik sorgte. Die Domi-nanz der Medizin wurde sukzessive durch den pädagogischen Um-gang mit behinderten Menschen abgelöst. Von 1962 an erschien die Zeitschrift ›Lebenshilfe‹, die 1980 in die Fachzeitschrift ›Geistige Behinderung‹ umgewandelt wurde. Das ›biologistisch-nihilistische‹ Menschenbild wurde durch ein ›pädagogisch-optimistisches‹ ersetzt (vgl. Schröder 1999, S. 12).
„Der Pessimismus um die Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen mit Be-hinderungen wich einer insgesamt optimistischen Auffassung. Menschen mit Behinderungen wurden nicht mehr verwahrt und gepflegt, man begann sie zu behandeln, zu fördern. Förderung wurde zum zentralen Begriff in der Be-hindertenpädagogik“ (Hähner 1998a, S. 30).
Das entstehende Fördersystem beinhaltete Werkstätten für Behin-derte, Sonderschulen für geistig Behinderte, Sonderkindergärten, Frühförderstellen, Wohnheime, behindertenspezifische Freizeit- und Sportangebote. Der behinderte Mensch wurde so von Fachleuten be-treut, die unter dem Mantel des Förderns die Menschen mit Behinde-rung an die Welt der ›Normalen‹ anzupassen versuchten (vgl. a.a.O.).
Im Zuge des Aufschwunges und der Professionalisierung in Re-habilitation, Sonderpädagogik, Förderung und Therapie entwickelte sich ein stark ›expertengeprägtes‹ Bild von Behinderung und es zeigten sich immer deutlicher Auswüchse, die auf eine Entfremdung vom Menschen hinweisen.
„Die praktische Hilfe wird zur lebenspraktischen Förderung, die Kontaktauf-nahme zur basalen Förderung, das Einkaufengehen zur sozialtherapeuti-schen Maßnahme. Der Begriff der ›Förderkette‹, also das Durchlaufen bestimmter Förderstufen, symbolisiert in besonderer Weise dieses Denk-modell: Aufnahme und Akzeptanz in die ›normale‹ Gesellschaft erfolgt erst, wenn ein bestimmtes Maß an Hilfebedarf abgebaut und ein gesellschaftlich akzeptierter Grad an Selbständigkeit erreicht ist“ (Bradl 1996, S. 369).
Bereits in den 70er Jahren wurde diese Problematik des Rehabilita-tionsgedanken deutlich. Es war von ›Isolationskarrieren‹ die Rede, die mit dem Eintritt in die Frühförderung beginnen und über Sonder-kindergärten und Sonderschulen in Werkstätten und Wohnheimen für Behinderte münden (vgl. Hähner 1998a, S. 31).
- Integriert und selbstbestimmt
Kennzeichnend für die beginnenden 80er Jahre waren die Rück-nahme der Leistungen und Einschränkungen, da die Kassen sich leerten. 1981 lautete das deutsche Motto des internationalen Jahres der Behinderten ›Einander Verstehen – Miteinander Leben‹. Damit die Erfahrungen dieses Jahres auch genutzt werden konnten, wurde von der UNO 1983–1993 die ›Dekade der Behinderten‹ ausgerufen.
Insgesamt wandelte sich das Selbstbewusstsein behinderter Menschen, vor allem der körperbehinderten. Geistig behinderte Men-schen bedurften zunächst der Anwaltschaft ihrer Eltern bzw. innovativ engagierter Profis; so fand 1982 in Dortmund erstmals ein Treffen der ›Eltern gegen Aussonderung‹ statt. Es wurde Kritik an den bestehen-den Sondereinrichtungen geübt und ›Integration‹ gefordert (vgl. Häh-ner 1998a, S. 31). Es findet eine Umorientierung im Denken statt; neben dem Begriff der ›Normalisierung‹ gewinnt der Faktor ›Lebens-qualität‹ an Bedeutung. Nach Speck steht nicht mehr der behinderte Mensch allein im Brennpunkt der Betrachtung, sondern der „behin-derte Mensch in seiner Lebenswelt“ (1998, S. 20).
„Vom Defizitwesen zum Dialogpartner“ verändert sich der geis-tig behinderte Mensch laut Goll (zit. b. Hähner 1998a, S. 32) in der Wahrnehmung der Experten. Dass vermehrt vom ›Menschen mit geistiger Behinderung‹ statt vom ›Geistigbehinderten‹ gesprochen wird, ist Ausdruck einer neuen Sichtweise. Der geistig Behinderte wird als Mensch mit Bedürfnissen wahrgenommen und im Dialog als kompetentes Individuum erlebt. Normalisierung scheint nicht mehr nur das Schaffen der Möglichkeiten zu meinen, die dem Behinderten ein dem Nichtbehinderten ähnliches Leben erlauben, vielmehr be-zeichnet es heute auch die Normalisierung der Beziehungen und des Dialogs.
Die Zunahme von mobil-ambulanten, ›offenen‹ Hilfen, Freizeit-clubs sowie Fortbildungsangeboten für geistig behinderte Menschen sind Merkmale eines anderen, sich weiter entwickelnden Bewusst-seins, das Individualität und Lebensgestaltung von Menschen mit geistiger Behinderung in den Mittelpunkt der Bemühungen stellt (vgl. Schröder 1999, S. 14).
2.2 Das Normalisierungsprinzip
Das Normalisierungsprinzip entwickelte sich in Dänemark aus der Kritik – vornehmlich von Eltern geistig Behinderter – an der damals bestehenden Versorgungspraxis behinderter Menschen.
Es wurde in erster Linie die Auflösung großer Einrichtungen, die Wahrnehmung der Rechte behinderter Menschen und die Humanisie-rung ihrer Lebensbedingungen gefordert. Diese Kritik führte 1959 zu dem ›Gesetz über die Fürsorge für geistig Behinderte‹, in dem der Gedanke der Normalisierung erstmals aufgegriffen wurde (vgl. Thimm 1994, S. 33 ff).
Die erste Formulierung des Normalisierungsprinzips stammt von dem Dänen B. Mikkelsen. So heißt es in dem erwähnten Däni-schen Gesetz zur Sozialfürsorge:
„Normalisierung bedeutet hier als Leitziel, dem geistig behinderten Men-schen ein weitgehend normales Leben zu ermöglichen, ihm also normale – im Sinne von typischen, den anderen Bürgern des Landes vergleichbare – Lebensbedingungen zu verschaffen“ (zit. b. Thimm 1994, S. 34 f).
Mikkelsen war Jurist und Sozialpolitiker und wurde bei der Vorbe-reitung zur Reform der dänischen Sozialgesetzgebung auf die Miss-stände in den großen stationären Einrichtungen für ›Geisteskranke‹ aufmerksam. Diese Menschen lebten isoliert von der Gesellschaft. Ihre Lebensbedingungen wichen in eklatanter Weise von denen der anderen Gesellschaftsmitglieder ab, so dass in der Präambel vom „Gesetz über die Fürsorge für geistig Behinderte und andere beson-ders schwach Begabte“ die generelle Forderung erhoben wurde, dass „geistig behinderte Menschen ein Leben so normal wie möglich führen können“ (Dänisches Sozialgesetz 1959).
Das Normalisierungsprinzip orientiert sich an folgenden acht Merkma-len, wobei neben allgemeinen ethischen Richtlinien der gesellschaft-liche Standard als Orientierung dient:
- Normaler Tagesrhythmus
- Normaler Wochenrhythmus
- Normaler Jahresrhythmus
- Normaler Lebenslauf
- Respektierung von Bedürfnissen
- Angemessener Kontakt zwischen den Geschlechtern
- Normaler wirtschaftlicher Standard
- Standards von Einrichtungen
Die angeführten Kriterien setzen nicht nur im direkten Kontakt mit Menschen mit geistiger Behinderung an, sondern bedeuten in der Konsequenz auch Veränderungen in Sozialpolitik, Trägerpolitik und der pädagogischen Praxis.
Die Forderungen des Normalisierungsprinzips stellten die trei-bende Kraft der nun einsetzenden Reform der großen stationären Einrichtungen und ihrer schrittweisen Ersetzung durch kleinere Ver-sorgungsinstitutionen dar. Der Gedanke der Normalisierung wurde zunächst in Schweden aufgegriffen, wo die ersten praktischen Versu-che der Umsetzung erfolgten (vgl. Thimm 1994, S. 35 ff).
Das Normalisierungsprinzip wird missverstanden, wenn man lediglich die ›Normalisierung der Behinderten‹ meint, vor dem Hintergrund der Vorstellung, dass der Mensch mit Behinderung selbst durch Verhal-ten und Erscheinung zur eigenen Stigmatisierung beiträgt. Das Trai-nieren von Basisfunktionen, lebenspraktische Förderung sowie das Erlernen einfacher Umgangsformen sollte zur Normalisierung des behinderten Menschen beitragen (vgl. Hähner 1998a, S. 43).
Hinsichtlich der Normen einer Gesellschaft erfährt das Normali-sierungsprinzip bei dem Amerikaner Wolfensberger eine Erwei-terung. Maßgebend sei, was normal, üblich oder typisch ist. Er spricht in diesem Zusammenhang von einer Aufwertung der sozialen Rolle von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Grundsätzlich ist für ihn Normalisierung gleichzusetzen mit physischer und sozialer Integration (vgl. in Speck 1998, S. 411 ff). Zwar nimmt die Erziehung zur Unauffälligkeit und zur Angleichung an die ›Normalen‹ innerhalb dieser Diskussion einen breiten Raum ein, jedoch kann Normalisie-rung nicht heißen, Menschen mit Behinderungen an die Gesellschaft anzupassen.
2.3 Integration
Neben dem skandinavischen Normalisierungsmodell gewinnt nun das ›Integrationsmodell‹ zunehmend an Einfluss.
Integration bezeichnet alle Maßnahmen, die eine möglichst ein-fache Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft zum Ziel haben. Nach Bleidick (1998, S. 44) machen „persönliche Sinnerfüllung und gesellschaftliche Eingliederung [...] den Endzweck aller Bemühungen in Bildung und Erziehung von Behinderten aus“. Speck formuliert, dass sich personale und soziale Integration ge-genseitig beeinflussen (vgl. 1996, S. 415), so dass „persönliches Glück und soziales Angenommensein [...] miteinander verbunden sind“ (Bleidick 1998, S. 45).
Der einst fortschrittliche Gedanke, diverse Sondereinrichtungen für verschiedene Behinderungen und unterschiedliche Therapieziele zu konzipieren, geriet somit in den Verdacht, behinderte Menschen vom eigentlichen Leben auszugrenzen (vgl. Hähner 1998a, S. 34).
„Das heilpädagogische System, im wesentlichen das Sonderschulsystem, stieß zum ersten Male auf entscheidende Kritik von außen“, „... diese stei-gerte sich bis zur grundsätzlichen Infragestellung des Sonderschulsystems. Auch das System der Heime als stationäre Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit [...] Behinderungen wurde einer radikalen Kritik unterworfen, die in der Forderung nach Abschaffung der Heime (‚Holt die Kinder aus den Heimen!’) gipfelte“ (Speck 1996, S. 43).
Speck erklärt jedoch auch, warum zu einer gelungenen sozialen Integration ein „entsprechendes soziales Klima“ Voraussetzung sein muss. Er führt aus, dass
„innerhalb einer integrativen Gruppe entsprechende integrative Bereitschaf-ten, soziale Annäherungs- und Solidarbedürfnisse oder Regeln gültig sein müssen. Gemeint sind Einstellungen, die auf die Überwindung sozialer Ver-fremdung hinauslaufen. Man könnte auch sagen, dass die Hindernisse für eine integrative Verständigung nicht zu groß sein dürfen“ (a.a.O., S. 417 ff).
Der Grad erfolgreicher Integration kann auf Grund persönlicher und sozialer Gegebenheiten differieren, wird also hauptsächlich subjektiv bestimmt. Er lässt sich nicht standardisieren. Es wird aber eine gesellschaftliche Verpflichtung anerkannt, die für die Verwirklichung sozialer Integration grundlegend erforderlichen Voraussetzungen und äußeren Bedingungen zu schaffen, wobei hier der Grundsatz „Jedem das Seine!“ gilt (vgl. Bleidick in Speck 1996, S. 394).
2.4 Selbstbestimmtes Leben
Selbstbestimmung erscheint in einer demokratischen Gesellschaft als Selbstverständlichkeit, auch juristisch gibt es in unserer Gesell-schaftsordnung kein ›Recht auf Fremdbestimmung‹. Sollen die Mög-lichkeiten der Selbstbestimmung eingeschränkt werden können, so liegt die Beweislast bei der Person, die die Einschränkungen erwirken will, und das geht lediglich, wenn in erheblichem Maße Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt. Für Menschen mit einer Behinderung musste dieses Grundrecht jedoch erst erkämpft werden (vgl. Schröder 1999, S. 25 ff).
Selbstbestimmung im Leben Behinderter setzt voraus, dass notwendige Hilfe weitestgehend unabhängig von Institutionen und deren fremdbestimmenden Zwängen und von fremdbestimmender, entmündigender Hilfe durch die so genannte Fachlichkeit von Helfern organisiert wird (vgl. Steiner 1999, S. 1). Die ›Selbstbestimmt-leben-Forderung‹ bei geistig behinderten Menschen bezieht sich auf verschiedene Ebenen des menschlichen Zusammenlebens; sie betrifft ebenso scheinbar winzige Alltagsentscheidungen – z. B. die Auswahl von Speisen, Kleidung oder den Zeitpunkt des Schlafen-gehens – wie auch die großen Entscheidungen der Lebensplanung: Wohnung, Ausbildung, Beruf und Familienstand (vgl. Niehoff 1998a, S. 55 ff).
Selbstbestimmung ist zunächst ein grundlegendes Bürgerrecht, das wir alle selbstverständlich für uns reklamieren als das Recht, in allen unseren Belangen selbst und eigenständig Entscheidungen treffen zu können. Selbstbestimmung hieße im Umgang mit geistig behinderten Menschen ganz allgemein:
- Äußerungen und Bedürfnisse wahrzunehmen, zu verstehen, zu akzeptieren und ihre Realisierung zu begleiten;
- Wahl- und Entscheidungsspielräume zu sehen, zu gestalten und selbstbestimmte Entscheidungen zuzulassen;
- echte Wahlmöglichkeiten im Hilfesystem zu schaffen (Art, Ort der notwendigen Hilfen; Auswahl der Betreuer).
Es steht außer Frage, dass sich die Selbstbestimmung des Einzelnen immer im sozialen Bezugssystem realisiert, dort ihren Handlungs-spielraum, aber auch ihre Grenzen findet (vgl. Bradl 1996, S. 363 ff).
Der Begriff der ›Selbstbestimmung‹ ist zum einen klar abzu-grenzen von ›Selbständigkeit‹, die als ein Leben ohne fremde Hilfe zu verstehen ist, andererseits aber auch von ›Autarkie‹, die Bedürf-nislosigkeit, wirtschaftliche Unabhängigkeit, Selbstgenügsamkeit und Unabhängigkeit zum Ausdruck bringt. Selbstbestimmung muss im Sinne von ›Autonomie‹ und als Gegenbegriff zu jeglicher Fremdbe-stimmung verstanden werden (vgl. Steiner 1999, S. 2).
Die nötige Begleitung eines geistig Behinderten setzt Einfüh-lungsvermögen in die Bedürfnisse des Klienten voraus, grenzt sich deutlich von Bevormundung und Überversorgung ab, begrenzt aber schließlich die Selbstbestimmung im Konfliktfall (vgl. Schwarte 2002).
Zwischen fürsorglich ›bemutterndem‹ und ›gluckenhaftem‹ Zwang einerseits und Vernachlässigung – und damit Verletzung der Sorgfaltspflicht und Berufsethik – andererseits liegt jedoch ein weites Feld, auf dem die Leitidee der Selbstbestimmung auf differenzierte Weise zum Tragen kommen kann (vgl. Hähner 2002, S. 29).
Nachfolgend werden einige zunächst sehr plakativ wirkende Schlag-wörter und bekannte Leitbilder der Selbstbestimmung erläutert und beschrieben, die – wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten – alle das Autonomie-Streben des Klienten als gemeinsamen Grund-satz ihrer Philosophie haben.
- Assistenzkonzept
Kernpunkte dieses Ansatzes sind, dass der Hilfeabhängige sich die Assistenten aussucht, sie anleitet, seinen Vorstellungen gemäß ein-setzt und bezahlt. Die Bezeichnung der Rolle bzw. Aufgabe des Hel-fers als ›Assistenz‹ beinhaltet eine „Abkehr vom therapie- und förder-zentrierten Modell der Betreuung behinderter Menschen“ (Niehoff 1998a, S. 53). Ausschlaggebend ist nicht mehr eine „durch Dritte defi-nierte Therapie- und Fördernotwendigkeit“, sondern die vom Klienten gewünschte Form der Alltagsbewältigung (vgl. a.a.O.). Assistenz meint hier die Hilfe bei dem Erreichen der gewünschten Ziele und orientiert sich an der Lebensqualität, der Selbstbestimmung und dem Grundsatz der Selbsthilfe; „Begleiten und befähigen statt betreuen und bevormunden“ (vgl. Schwarte 2002).
Körperbehinderte Menschen, aus deren Diskussion um die ›Selbstbestimmt-leben-Forderung‹ das Assistenzkonzept erwachsen ist, sprechen häufig von ›persönlicher Assistenz‹. Persönliche Assis-tenz umfasst jede Form der Hilfe, die dem ›Assistenznehmer‹ erlaubt, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. Der ›Assi‹ steht so in einem Arbeitnehmerverhältnis zu dem behinderten Menschen, der seinerseits Zeit, Ort und Ablauf der Hilfeleistungen bestimmt.
„Wer sich von dem Aufwand des Arbeitgebermodells überfordert fühlt oder tatsächlich dem Aufwand nicht gewachsen ist, gründet mit anderen Betroffe-nen eine Assistenzorganisation, die die notwendigen Organisationsarbeiten abnimmt, sie erledigt, aber den Selbstbestimmungsgedanken in der Form der Assistenz ermöglicht. Das kann ein Verein oder eine Genossenschaft oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung sein. Bei dieser Form der Indirekten Assistenz sind die Assistenten bei der Organisation angestellt“ (Steiner 1999, S. 1).
In Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung bedarf das Assis-tenzkonzept einer Erweiterung, da diese oft Schwierigkeiten haben, Anleiterfunktionen auszuüben bzw. richtig einzuschätzen, wieviel und welche Hilfe sie benötigen (vgl. Niehoff 1998a, S. 54). Es muss daher bei ihnen um den Aspekt der Begleitung ergänzt werden, die sich in ihrer Ausgestaltung an den Lebensbedingungen und Äußerun-gen der Assistenznehmer zu orientieren hat (vgl. Schwarte 2002).
- Kundenmodell
Hilfe für behinderte Menschen als Dienstleistung zu verstehen, die auf einer vertraglichen Regelung beider Beteiligten basieren, schafft ein klares Verhältnis der Beziehung zwischen Hilfegebendem und Hilfenehmendem. Das Kundenmodell erreicht so die Befreiung einer einseitigen Abhängigkeit in der helfenden Beziehung. Das ›Abhängig-keitsverhältnis‹, das die klassische Helferbeziehung kennzeichnet, kehrt sich zugunsten eines ›Machtverhältnisses‹ um. Der behinderte Mensch nimmt eine ›Kundenrolle‹ ein, die ihn emanzipiert und in die Lage versetzt, eine qualitativ gesicherte soziale Dienstleistung zu erhalten.
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass er sie auch ›kauft‹, was – von einigen Selbstzahlern abgesehen – bei einem im Heim leben-den Menschen so nicht ohne weiteres zutrifft. Zwischen ihm, dem Hilfeleistenden und dem Kostenträger besteht ein Dreiecksverhältnis, in dem allerdings letzterer sowohl Inhalt und Form der Leistung be-stimmt, als auch dafür bezahlt. So gesehen wäre der Kostenträger der Kunde der Leistungen. Bei geistig behinderten Menschen vom ›Kunden‹ zu sprechen, scheint auch deshalb fragwürdig, weil ein solches Verhältnis ein souveränes Kundenverhalten bedingt, das zum einen intellektuelle und psychische Kompetenzen und zum anderen wirtschaftliche Marktfähigkeit voraussetzt (vgl. Niehoff 1998a, S. 54, und Kap. 5.2, S. 95 ff).
„Doch kann man von Kunden sprechen, wenn die Betroffenen an sich noch ›unkundig‹ sind, sich auf dem Markt der (Begleitungs-)Möglichkeiten nicht zurechtfinden, wenn ihnen die kritische Betrachtung ebenso fehlt wie die nötigen Vergleiche, um eine Wahl treffen zu können, wenn sie sich nur auf ihre eigenen Gefühle verlassen können, denen sie wiederum misstrauen, weil sie meinen, alle anderen müssten und fühlten besser als sie? Und was stellt schließlich ein Kunde ohne Geld dar, welche Macht hat er?“ (Hähner 2002, S. 29).
Obgleich für den behinderten Menschen enorme Mengen an Geld in Form von Pflegesätzen und Fördermitteln aufgewandt werden, hat er selbst nur sehr geringen Einfluss auf deren Verwendung und damit keine Macht. Eine Chance zu einer Verbesserung in dieser Hinsicht besteht möglicherweise seit dem Jahr 2001, als die Reform des Neunten Buches des Sozialgesetzbuches in Kraft trat, nach der ›Selbstbestimmung und Teilhabe an Leben in der Gemeinschaft‹ zum programmatischen Ziel erklärt wurden (vgl. a.a.O., und Kap. 1.2, S. 14 f).
- Empowerment
In dem ›Empowerment-Konzept‹ geht des darum, „die Situation der Machtlosigkeit und den subjektiver empfundenen Verlust von Kon-trolle über wesentliche Aspekte des individuellen und sozialen Lebens“ (Stark 1991, zit. b. Hähner 2002, S. 30) zu überwinden. ›Empowerment‹, was sich am ehesten mit ›Selbstbemächtigung‹ übersetzen lässt, bezeichnet jene Hilfen, die den geistig behinderten Menschen befähigen, eigene Kontrolle über sein Leben zu gewinnen. „Ermächtigt werden sollen einzelne Gruppen von Menschen, die unterprivilegiert, machtlos und damit in der Möglichkeit, ein selbst-bestimmtes Leben zu führen, eingeschränkt sind“ (Niehoff 1996, S. 60).
Bei diesem Konzept geht es also in keiner Weise darum, den Behinderten an einen gesellschaftlichen Durchschnitt anzupassen oder zu integrieren, sondern seine subjektiv empfundene Machtlosig-keit sowie den Kontrollverlust über wesentliche Teile seines indivi-duellen und sozialen Lebens zu überwinden (vgl. Hähner 1998b, S. 129).
„Eine Reihe von Untersuchungen hat ergeben, dass die (Wieder-)Gewin-nung von Kontrollbewusstsein und Kontrolle über die eigenen Lebensum-stände eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung psychischer Ge-sundheit darstellt“ (ders. 2002, S. 30).
Das ›Empowerment-Konzept‹ stützt sich auf die These, dass Hilfsbe-dürftigkeit von Behinderten auch das Produkt eines ungünstig verlau-fenden Lernprozesses sein kann, der prinzipiell auch wieder umkehr-bar ist. Ziel des ›Empowerment-Ansatzes‹ ist es, durch Ermutigung zum Entdecken der eigenen Stärken und zum Umsetzen eigener Ideen, dem behinderten Menschen – sowohl im Rahmen von Selbst-hilfegruppen, als auch in einem handlungsleitenden Rahmen der sozialen Fachleute – ein Erleben von Macht und Kontrolle über das eigene Dasein zu verleihen (vgl. Niehoff 1998a, S. 56).
Da auch der geistig behinderte Mensch als der Experte seines Lebens anzusehen ist, der über eigene Ressourcen verfügt, aus sich selbst heraus zu wachsen sowie nach Selbstverwirklichung, Selbst-erhaltung und einem sinnvollen Dasein strebt, werden Maßnahmen wie ›Behandlung‹, ›Förderung‹ und ›Therapie‹ nach diesem Ansatz überflüssig bzw. müssten von ihm selbständig eingefordert werden. Der Brennpunkt von Empowerment ist also nicht defizitorientiert, viel-mehr richtet er sich nach den Fähigkeiten des Subjektes. So wird ver-sucht, eigene Stärken zu entdecken, um den behinderten Menschen handlungsfähig zu machen (vgl. Hähner 1998b, S. 130 ff).
„Fördern wird hier nicht im Sinne des Lehrens und Lernens verstanden, wie es die Förderkonzepte vorsehen, also diagnostizierte Defizite zu kompensie-ren durch systematische Trainings, sondern im Sinne eines Zutageförderns vorhandener, bisher nicht gezeigter Fähigkeiten“ (ders. 2002, S. 30).
- Regiekompetenz
Der Begriff ›Regiekompetenz‹ beschreibt den Anspruch behinderter Menschen, über die Formen der Hilfen zur Alltagsbewältigung mög-lichst weitgehend selbst zu bestimmen, eben Regie darüber zu führen.
Entgegen dieser Forderung wurde in der Vergangenheit so das gesamte Hilfesystem für Behinderte schwerpunktmäßig von nicht-behinderten Fachleuten arrangiert. Entsprechend fordert der ›Regie führende‹ behinderte Mensch Kompetenzen ein, wie:
- Finanzkompetenz
- Personalkompetenz
- Anleitungskompetenz
- Raumkompetenz
- Sozialkompetenz
Obwohl sich die aufgeführten Kompetenzen nicht problemlos auf Menschen mit einer geistigen Behinderung übertragen lassen, bleibt der prinzipielle Anspruch dennoch legitim. Vielmehr sollte heraus-gefunden werden, in welchen Bereichen im Leben eines geistig be-hinderten Menschen eigene Entscheidungsgewalt und Kontrollmög-lichkeiten Platz haben oder finden können (vgl. Niehoff 1998a, S. 57 ff).
„Wenn der Einfluss geistig behinderter Menschen auf ihren Alltag erhöht werden soll, sind beispielhaft folgende Fragen zu bedenken:
- Welchen Stellenwert haben persönliche Wünsche geistig behinderter Menschen in fachlich abgeleiteten Förderplänen?
- Welche Mitspracherechte haben geistig behinderte Menschen bezüglich ihres Arbeitsplatzes oder ihres Wohnorts?
- Welche Mitspracherechte haben geistig behinderte Menschen in der Personalpolitik der Einrichtungsträger?
- Welchen Einfluss haben geistig behinderte Menschen bzw. deren Mitwir-kungsgremien auf das Entlohnungssystem einer WfB?
- Welchen eigenverantwortlichen Freiraum gibt es im Umgang mit dem Taschengeld?“ (a.a.O., S. 58).
Unabhängig vom Grade der Behinderung wächst im Zuge vermehrt ausgeübter Regiekompetenz die Fähigkeit und Sicherheit, eigene Ressourcen neu zu entdecken und in die eigene Lebensplanung wie -führung zu integrieren (vgl. Schröder 1999, S. 30 ff).
- Self-Advocacy
Die Forderung nach ›Self-Advocacy‹ (= Selbstvertretung) wurde in Deutschland nach dem Krieg zum ersten Mal von der Elternvereini-gung ›Lebenshilfe‹ und anderen Verbänden vorgetragen (vgl. a.a.O., S. 11 f und S. 32).
Neben diesen qualifizierten Hilfesystemen erheben heute selbstbewusste geistig behinderte Menschen im Alltag ganz natürlich die Forderung nach ›Self-Advocacy‹. Da nicht alle geistig Behinderten ihre Interessen sprachlich differenziert vorbringen können, muss nach Wegen gesucht werden, die Erfüllung dieses staatlich verbrieften Rechts auch intellektuell beeinträchtigten Personen zu garantieren. Die Notwendigkeit, dass auch die Formen der nonverbalen Willens-bekundungen, wie z.B. Mimik, Gestik oder Verhalten wahrgenommen werden, setzt von den jeweiligen Bezugspersonen ein verschärftes und sensibles Empfinden voraus.
Geistig behinderte Menschen zum Artikulieren ihrer Interessen zu befähigen, sollte gleichsam mit der Schaffung neuer Mitwirkungs-gremien einhergehen. Dass geistig Behinderte neben Heimbeiräten oder Beschäftigtenvertretungen in WfBs auch in bundesweiten ein-flussreichen Gremien vertreten sind, bleibt momentan noch bei der ›Bundesvereinigung Lebenshilfe‹ eine modellhafte Ausnahme (vgl. Niehoff 1998a, S. 60 f).
- Der Trialog
Der Begriff ›Trialog‹, der sich nicht im Duden findet, bedeutet in Ab-grenzung zum Dialog den Einbezug des Betroffenen in Gespräche und Verhandlungen, die bislang überwiegend ohne die Teilnahme des Kranken oder Behinderten stattgefunden haben. Seinen Ur-sprung hat der ›Trialog‹ innerhalb der deutschen Sozialpsychiatrie (Weltkongress 1994) und nahm fast zeitgleich Einfluss auf die Praxis der Behindertenhilfe.
Neben populären Beispielen, die belegen, wie notwendig die kritische Reflexion der Rolle der Angehörigen und Fachleute in ihrem Handeln für (geistig) behinderte Menschen ist (z. B. die Bücher: ›Ich will nicht länger inmich sein‹ von B. Selin, und ›Warum sollte ich jemand anderes sein wollen‹ von F. Saal), war der Duisburger Kon-gress ›Ich weiß doch selbst, was ich will!‹ am 1.10.94 – sowohl was die Vorbereitung, als auch die Durchführung betrifft – ein gelungenes Beispiel für eine ›trialogische‹ Verwirklichung (vgl. a.a.O., S. 63 ff).
„Redet nicht über uns, sondern mit uns! Wir wollen Wahlmöglichkeiten, z.B. in den Bereichen Ausbildung, Wohnen, Arbeit und Freizeit. […] Wir wollen zusammenarbeiten, wir sind keine Befehlsempfänger. […] Wir können mehr, als uns zugetraut wird. Das wollen wir zeigen; auch wenn man mal etwas gegen den Willen der Eltern oder der Betreuer tun muss“ (aus: Duisburger Erklärung 1994, s. Anhang).
2.5 Vom Klienten zum Bürger
Die aktuellen fachlichen Konzepte der Behindertenhilfe stehen seit jeher auf dem Prüfstand kritischer Betrachter. Ob es sich um ›Förde-rung‹, ›Normalisierung‹ oder ›Integration‹ handelte – alle ehemals richtungweisenden Leitprinzipien sahen sich irgendwann einmal der Kritik derer ausgesetzt, die mit neuen Theorien bzw. neuen Hand-lungsmaximen aufwarteten.
So werden seit einigen Jahren Stimmen laut, die auch Aspekte der im letzten Kapitel erläuterten Ideen kritisieren, da diese auf fach-lichen und institutionellen Grundlagen beruhten, die eine wirkliche Gleichberechtigung nicht zuließen. Kritiker fordern eine gesellschaftli-che Ordnung, innerhalb derer ›Selbstbestimmung‹ oder ›Integration‹ Behinderter nicht explizit forciert werden müsse, weil es sich ohnehin um selbstverständliche Grundrechte handele (vgl. Boban 2002).
Wenn auch diese Idee momentan gesellschaftspolitisch unrea-listisch und utopisch klingen mag, so verweist sie doch auf ein legiti-mes Anliegen: Die Zugehörigkeit behinderter Menschen zu einer Gesellschaft, die sich als ›inklusive Gesellschaft‹ versteht. Der Behin-derte nähme so nicht mehr die Rolle eines ›Klienten‹ ein, dessen Selbstbestimmungsrecht und soziale Teilhabe verteidigt werden muss, sondern die eines ›Bürgers‹, der ein homogener Teil des Gan-zen ist.
„Selbstbestimmung braucht Strukturen, die Entscheidungs- und selbstbe-stimmte Handlungsmöglichkeiten überhaupt erst zulassen. Betrachtet man die Behindertenhilfe und unterzieht man das gesamte System und die dort gängigen Strukturen einer kritischen Analyse, so wird schnell deutlich, dass Selbstbestimmung, wie sie für jeden Bürger unserer Gesellschaft gilt, in die-sem Rahmen auch nicht annähernd möglich ist“ (Hähner 2002, S. 34).
Nachfolgend werden einige Begriffe der Behindertenhilfe erläutert, die in diesem Zusammenhang relevant sind. Auch sie beinhalten die For-derungen nach selbstbestimmtem Leben, jedoch mit dem Schwer-punkt des Inklusionsgedankens.
- Persönliche Zukunftskonferenz
Unter ›Persönlichen Zukunftskonferenzen‹ werden Gesprächsrunden zur persönlichen Zukunftsplanung verstanden, die ausdrücklich den Behinderten als Subjekt in den Mittelpunkt stellen, gänzlich ungeach-tet seiner Behinderung und seines Artikulationsvermögens. Die wach-sende Nichtakzeptanz starr vorgegebener Lebenswege in Sonder-einrichtungen ist eine wichtige Ausgangsrealität für die Suche nach individuellen und bisher ungewöhnlichen Lebenswegen. Intention die-ses Konzepts ist nicht die Zukunftsplanung für einen Menschen mit Behinderung, sondern gemeinsame Planung mit diesem Menschen und seinem sozialen Umfeld.
Moderatoren ›Persönlicher Zukunftskonferenzen‹ wollen über die engen Grenzen und Hemmnisse der alltäglichen Behinderung hinaus neue individuelle Lebenswege möglich werden lassen, wobei der Wunsch nach Veränderung von Lebensbedingungen behinderter Menschen eine wichtige Triebfeder für den Handlungsoptimismus der Beteiligten ist. Nicht die gesamte Gesellschaftsveränderung wird hier Programm, sondern die Veränderung der Lebensbedingungen und gesellschaftlichen Umfeldrealitäten jeweils für Einzelne (mit erhofften Langzeitwirkungen im gesamtgesellschaftlichen Bereich).
Insbesondere für Menschen mit Behinderungen, die sich kaum oder gar nicht artikulieren können, ist die Zukunftskonferenz im Rah-men eines ›Unterstützerkreises‹ (emphatischer Denkkreis von Ver-trauenspersonen, Bekannten, Freunden und beteiligten Professionel-len) ein existentiell wichtiges Beratungs- und Zukunftsinstrument.
Die Planung, Organisation und Durchführung solcher Zukunfts-konferenzen ist sicherlich eine zeitaufwendige Form der Zukunfts-planung und Lebensweg-Beratung. Notwendige Voraussetzung für den Erfolg einer Zukunftskonferenz ist, dass die beteiligten Unter-stützer die betroffene Hauptperson gut kennen. Die Durchführung von Zukunftskonferenzen mit Unterstützerkreisen braucht viel Vorlauf und frühzeitige Einladungen; die Unterstützerkreise werden auf Wunsch der betroffenen Hauptperson zusammengestellt.
In einem 8-Phasen Moderationsprozess wird die Sammlung von Lebensperspektiven gesteuert (Vorstellungsrunde, Geschichte, Traum, Alpträume, die Person, Stärken, Bedürfnisse, Planung). Die so genannte ›Zeitreise‹ und ›Entwicklungsphantasien‹ schließen sich an, um zu optimistischen und doch konkreten Zielplanungen und Ziel-vorstellungen zu kommen.
Die Idee der Zukunftskonferenz mit Unterstützerkreis ist keine, die sich nur auf den ambulanten oder stark familiär geprägten Bereich bezieht, sondern ist durchaus auch Herausforderung und Anregung für den stationären Heimbereich. Hier insbesondere gilt es, den reinen professionellen Kreis (›Fallkonferenzen‹) zu durchbrechen und, soweit vorhanden, Angehörige und Freunde, durchaus aber auch Bekannte, Kollegen, Mitbewohner, gesetzliche Betreuer oder Werkstattmitarbeiter in die Konferenz einzubeziehen. Hauptziele des Unterstützerkreises sind interdisziplinäre Zusammenarbeit, Unterstüt-zung für die Familie, Zukunftsplanung, Krisenbewältigung, Netzwerk-bildung, einen Arbeitsplatz finden und ein langfristiges Unterstüt-zungssystem zu bilden (vgl. Boban 2002).
- Supported Living
›Supported Living‹ bedeutet wörtlich ›unterstütztes Leben‹ und be-schreibt die Neugestaltung der Umwelt als inklusive Gesellschaft, in der nicht der behinderte Mensch lernen muss, sich zu integrieren oder anzupassen, sondern ausschließlich die gegebenen Umwelt-hindernisse problematisiert werden.
Während man bislang aus professioneller Sicht vom ›Klienten‹ sprach, dessen Selbständigkeit mit Hilfe individueller Förderpläne im Rahmen interdisziplinärer Teamarbeit heilpädagogischer Sonderein-richtungen gefördert werden sollte, spricht man hier vom ›Bürger‹, der mittels individueller ›Persönlicher Unterstützerkreise‹ Assistenz für die Verwirklichung seines selbst gewählten Lebensweges erhält. Die-ses Modell individueller Unterstützung geht davon aus, dass ›Bürger‹ im Vergleich zu ›Klienten‹ keiner Förderung und integrativer Maßnah-men bedürfen, sondern ihnen eine wirkliche Teilhabe ohne Umwelt-hindernisse in der Gesellschaft ermöglicht werden muss (vgl. Boban 2002).
- Betreutes und Unterstütztes Wohnen
Die traditionelle vollstationäre Institution der Behindertenhilfe, also das klassische Heim, als ausschließliche Wohnform für Menschen mit geistiger Behinderung lässt Selbstbestimmung nur sehr begrenzt zu. Dieses Manko liegt in der Natur der Sache, da in einem Heimbetrieb meist zwangsläufig rigide Strukturen vorherrschen, an die sich die Menschen anpassen müssen. Ein überwiegend fremdbestimmtes System, das sich etlichen Sachzwängen und Regeln unterzuordnen hat, ist ein denkbar schlechter Nährboden für Selbstbestimmung. Hin-gegen können sich Kleinsteinrichtungen und kleine überschaubare Wohngemeinschaften wegen ihrer überschaubaren Strukturen und ihrer kleinen Mitarbeiterteams flexibler auf den einzelnen Menschen einstellen und viel eher Formen der Selbstbestimmung für geistig behinderte Menschen ermöglichen (vgl. Hähner 2002, S. 34 f).
›Betreutes‹ und ›Unterstütztes Wohnen‹ sind in diesem Zusam-menhang zu nennende Perspektiven, wobei das durch einen Betreu-ungsschlüssel finanzierte ›Betreute Wohnen‹ eine bereits bekannte Alternative zu stationären Wohnformen darstellt. Beim ›Unterstützten Wohnen‹ orientiert sich die Hilfe nicht am üblichen Betreuungsschlüs-sel, d. h. an der pauschalen Bemessung der Mittel an der Größe der zu betreuenden Gruppe, sondern am individuellen Hilfebedarf und den Lebensgewohnheiten der Nutzer. Diese Wohnform stellt also ein ›individuelles Hilfearrangement‹ dar, das in ein Netzwerk vielfältiger und offener Hilfen (z. B. Mobilitätshilfen) eingebunden ist.
Historisch gesehen bedeutete dies ein Rückgängigmachen der Separierung behinderter Menschen, ein Rückbilden sozialer Barrieren sowie ein Abschiednehmen von selbst erfundenen Sonderformen für Behinderte, wie z. B. die (familienähnliche!) 8er-Gruppe, als ob es in der Natur des Behinderten läge, immer in 8er-Gruppen aufzutauchen.
›Unterstütztes Wohnen‹, dessen einzelne Dienstleistungen im Rahmen individueller Hilfeplanungen regelmäßig überprüft werden müssen, bietet neben seiner flexiblen, zielgerichteten und offenen Angebotsstruktur dem Adressaten sowohl den souveränen Status in einer Dienstleistungsbeziehung, als auch den Rechtsstatus eines Mietvertrages (vgl. Schwarte 2002).
[...]
- Arbeit zitieren
- Dipl. Soz. Päd. Philip Schröder (Autor:in), 2003, Qualitätssicherung in der Behindertenhilfe. Schnäppchen oder Mogelpackung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58715
Kostenlos Autor werden

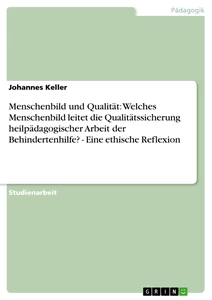




















Kommentare