Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Was ist DMP?
2.1 Ursprung der DMPs
2.2 DMP in Deutschland
2.3 Konkretes zum DMP
3. Kritische Betrachtung
3.1 Evidenzbasierte Leitlinien
3.2 Datenschutz
3.3 Exkurs
3.4 Positionen und Motive
4. Die ersten Erfahrungen mit DMP
5. Schluss
6. Quellenverzeichnis
1. Einleitung
Eine Verbesserung der Versorgung von chronisch Kranken bei gleichzeitiger Kostenreduktion
So lautet der Vorsatz der Disease Management Programme, die einhergehend mit dem Anbruch des neuen Jahrtausends, als Lösung auf die Probleme in unserem hilfebedürftigen Gesundsheitssystem fungieren sollen. Dabei handelt es sich um ein amerikanisches Vorbild, welches nach dem Case Management nun das zweite Instrument des Managed Care darstellt.
Während jedoch beim Case Management der einzelne Patient mit all seinen Erkrankungen im Vordergrund steht, konzentriert man sich beim DMP auf eine Personengruppe mit einer bestimmten Erkrankung. DMP ist in Abgrenzung zu Managed Care ein prozessorientiertes Modell, welches mittlerweile in Deutschland eingeführt wird.
Ich werde zunächst eine Einführung in das Thema liefern, in der ich mich mit dem Hintergrund und Ursprung des DMP befasse, um mich später dem Thema immer konkreter zu nähern. So will ich zunächst erklären woher DMP kommt, wie es nach Deutschland kam und in welcher Form es bei uns abläuft.
Nachdem ich nun ein gewisses Basisverständnis geschaffen habe, werde ich im zweiten Schritt auf verschiedene wichtige Themen innerhalb der DMP- Diskussionen eingehen und diese kritisch beleuchten. Darüber hinaus werde ich mich in einem ausführlichen Exkurs, einem nur mittelbar mit den DMP in Verbindung stehenden Thema widmen, welches ich jedoch unter dem Aspekt der Wahrung einer gewissen Objektivität als recht sinnvoll erachte.
Hinterher gehe ich auf die verschiedenen Standpunkte der Beteiligten ein, um nicht die Komplexität der DMP- Situation zu vernachlässigen. Ich werde dabei versuchen einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Positionen der ‚Mitspieler’ zu gewähren, um einseitigen Sichtweisen entgegenzuwirken. Jedoch werde ich den Schwerpunkt bei den Sichtweisen der Hausärzte setzen, da diesen eine zentrale Rolle im DMP zukommt.
In meiner Darstellung der Situation werde ich versuchen Studien und Befragungen einzubauen, um dem wissenschaftlichen Anspruch dieser Arbeit gerecht zu werden.
Nachdem ich nun eine umfassende Beschreibung des DMP und der Beteiligten geliefert habe, gehe ich auf die ersten Erfahrungen ein, die bislang in Deutschland damit gemacht wurden. Dieser Teil nimmt jedoch keinen großen Umfang an, was mit der kurzen Zeitspanne zusammenhängt, die das Vorhandensein von DMP in Deutschland kennzeichnet.
Im Anschluss daran formuliere ich mein Schlusswort, worin ich zuletzt auf die Position des (chronisch kranken) Patienten eingehe, die ich bis dahin bewusst aus den Darstellungen der Sichtweisen der Beteiligten im DMP weggelassen habe.
Meine Arbeit endet mit dem Quellenverzeichnis.
2. DMP- Was ist das?
2.1 Ursprung der DMPs
Disease Management Programs (DMP) wurden ursprünglich in den USA Mitte der 90er Jahre eingeführt. Sie sollten dazu dienen, zusätzlich Kosten im Gesundheitswesen zu reduzieren.
Die Beweggründe hierfür liegen in dem amerikanischen Gesundheitssystem, dass mit durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben von 4.637 $ (im Jahr 2000), zu den teuersten weltweit gezählt werden darf. Zu den hohen Kosten führten – wie in anderen westlichen Ländern auch- „demographische Entwicklungen, neue Krankheitstrends, Inflation, Fortschritte in der Technikentwicklung, höhere Ausnutzung diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen“, hohe Arztgebühren, die aufgrund der vielen Rechtsklagen gegen Ärzte, durch deren hohe Rechtsschutzkosten mit beeinflusst worden sind. (Hearn 2002, S.11) Ein weiteres „grundlegendes Problem“, laut Gesine Küspert Hearn von der Idaho State University, liege darin, dass „das System der Einzelleistungsvergütung keine Anreize“ biete, die Kosten gering zu halten.
Aus dem World Health Report 2000 geht hervor, dass die U.S.A. trotz der hohen Kosten lediglich Platz 15 unter 25 Industrienationen einnehmen. Grund für dieses Ergebnis sind die Versorgungsunterschiede und Gesundheitszustände verschiedener Bevölkerungsgruppen in den U.S.A. „Personen mit niedrigem Einkommen, Angehörige ethnischer Minderheiten und Einwanderer sind die Benachteiligten im amerikanischen Gesundheitssystem.“.
Zudem bestehen regionale Versorgungsunterschiede: „Ländliche Gebiete und Innenstadtbezirke großer Städte sind oftmals krass unterversorgt“. (Hearn 2002, S.11)
Man muss wissen, dass nicht alle Menschen in den U.S.A. Versicherungsschutz haben.
So wurden im Jahr 2000 rund 14% der amerikanischen Bevölkerung – das sind fast 39 Millionen- als nicht krankenversichert registriert.
Üblicherweise sind die meisten über ihren Arbeitsplatz krankenversichert.
Für jene, die es jedoch nicht sind, wurden vom Staat Alternativen eingerichtet:
So versichert Medicare Personen ab 65 Jahre; Personen mit Einkommen unter der Armutsgrenze, Behinderte und Sozialhilfeempfänger können Medicaid, einen weiteren staatlichen Versicherungsschutz in Anspruch nehmen. Des Weiteren genießen 3% der amerikanischen Bevölkerung als Militärangehörige staatlichen Versicherungsschutz.
Jedoch ist versichert sein nicht gleichbedeutend mit guter Versorgung, da z.B. hohe Abschlagszahlungen und Zuzahlungen Patienten davon abhalten, Leistungen in Anspruch zu nehmen. Auch, ist die freie Arztwahl und der Zugang zu Spezialisten oft eingeschränkt.
(vgl. Hearn 2002, S.11)
Eine Antwort auf die Probleme des amerikanischen Gesundheitssystems schien Managed Care zu sein. Es sollte kosteneffizienter und organisierter sein, als das traditionelle System der Einzelleitungsvergütung. Managed Care kann entweder vom Arbeitgeber oder von privaten Versicherungsunternehmen angeboten werden. Es gibt sie in vielen Formen wie z.B. Health Maintance Organizations (HMOs) bis hin zu Versicherungsplänen mit nur minimalen Anteilen von Managed Care – Funktionen. „HMOs sind Versicherungspläne mit einer festgesetzten und vorab zu bezahlenden Prämie, die bestimmte Leistungen garantieren. Ärzte in einer HMO sind entweder angestellt in einer Gruppenpraxis oder bleiben unabhängig und schließen Verträge mit einer HMO ab.“ Neben dieser Form gab es noch weitere, wie z.B. IPAs (Independant Practice Associations) und PPOs (Preferred Provider Organizations).
(Hearn 2002, S.12)
Anfang der 90er Jahre zeigte sich, dass Managed Care tatsächlich dazu beigetragen hatte, dass sich die Kosteninflation im Gesundheitswesen verlangsamte. Die Kostendämpfung war auf Kopfpauschalen, der ständigen Überprüfung von Leistungen und Verordnungen, dem Widerrufen der Bezahlung unnötiger Leistungen, der Einschränkung von Überweisungen zu den teureren Spezialisten, Vorschriften für die Verschreibung von billigeren Generika, günstigere Prämien für jüngere und gesündere Patienten, Ausgrenzung von Patienten mit hohem Bedarf an Leistungen (Schwerkranke, Behinderte) etc. zurückzuführen.
Schließlich wurden auch die Nachteile von Mangaged Care ziemlich bald offensichtlich:
- Patienten haben keine Wahlfreiheit bezüglich der Haus- , Fachärzte und Einrichtungen
- Enges Zeitlimit bei Arztbesuchen
- Wachsende Unpersönlichkeit zwischen Arzt und Patient, die das Vertrauen zum Arzt untergräbt
- Steigende Rechtsklagen gegen Ärzte
- Benachteiligung behinderter und schwerkranker Patienten
- Zunahme von bürokratischem Aufwand
- Etc.
Rein wirtschaftlich hat Managed Care sein Versprechen gehalten. Jedoch war es ein politischer und kultureller Misserfolg, da sowohl Patienten, als auch Ärzte und Arbeitgeber zunehmend frustriert und verärgert wurden. (vgl. Hearn 2002, S.12f)
Schließlich wurden Mitte der 90er Jahre DMPs eingeführt. „DMP bieten die Koordination von Gesundheitspflege mit Mitteln der Intervention und Kommunikation an. Patienten mit Erkrankungen, die ein hohes Maß an Selbstpflege verlangen, sind die Zielgruppe von DMP. Die verschiedenen Komponenten der Programme sind: Die Identifizierung von Patientengruppen, die Erstellung und Anwendung wissenschaftlich erprobter Richtlinien, die Zusammenführung aller Beteiligten im Pflegeprozess, Erziehung der Patienten zu Selbstständigkeit, Messung und Analyse von Verlaufs- und Enddaten und ein laufender Feedback- Prozess.“ (Hearn 2002, S.13)
Entwickelt wurden die DMPs von pharmazeutischen Unternehmen, die in den Verschreibungsrichtlinien und Leistungsbeschränkungen der HMOs eine Bedrohung ihrer Profite und Existenz sahen. Die Pharmaunternehmen entwickelten Informationsprogramme für chronisch kranke Patienten, die an HMOs, Arbeitgeber und Krankenhäuser verkauft wurden – in der Hoffnung, den Verkauf ihrer Produkte zu steigern.
(vgl. Fischer u. a. 2005, S.8)
„Der Verkaufsslogan war: Kostensenkung bei gleichzeitiger Verbesserung der Versorgungsqualität und des Gesundheitsstatus chronisch kranker Patienten.“
(Hearn 2002, S.13)
Doch wiesen die DMPs ähnliche Mängel auf wie die HMOs, wie z.B. die Präferenz von „günstigeren“ Patienten. So bestehen die in ein DMP eingeschriebenen Patienten typischerweise aus hochmotivierten, finanziell gut gestellten chronisch Kranken.
Auch stellen Disease Management Programme wieder eine zusätzliche Verwaltungsebene mit zusätzlichen Verwaltungsaufgaben dar, was langfristig gesehen kein erstrebenswertes Szenario sein kann. (vgl. Hearn 2002, S.13)
2.2 DMP in Deutschland
In Deutschland sieht die Situation etwas anders aus: Zwar gehört das deutsche Gesundheitssystem bei der Versorgung akut erkrankter Personen im weltweiten Vergleich zu den Spitzenreitern, dies gilt jedoch nicht bei der Versorgung chronisch Kranker. (vgl. Müller de Cornejo u.a. 2002, S.4) Dass jedoch gerade eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Situation chronisch Kranker zwingend ist, bestätigte der Sachverständigenrat für die konzentrierte Aktion im Gesundheitswesen in seinem Gutachten „Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit, Band III Über-, Unter und Fehlversorgung“ aus dem Jahr 2001: Darin wird der Anteil chronisch Kranker in der ambulanten bzw. stationären Versorgung auf mindestens 40% geschätzt. Auf diese entfallen bereits ¾ der Krankheitsausgaben. In seinem jüngsten Gutachten stellt der Sachverständigenrat fest, dass viele europäische Länder mit weniger finanziellen Mitteln bessere Gesundheitsergebnisse erzielen als Deutschland. So hat sich die Gesamtmortalität bei Herzkrankheiten in Deutschland schlechter entwickelt als in vielen europäischen Ländern oder den USA, obwohl hierzulande doppelt so viele Herzkatheteruntersuchungen gemacht werden wie im europäischen Durchschnitt. Ein anderes Beispiel ist die Zahl der Diabetes-bedingten Fußamputationen, die in der Schweiz um 87% gesenkt werden konnte, während die jährliche Amputationsrate in Deutschland aufgrund diabetischer Spätfolgen in den letzten Jahren konstant geblieben ist. Desweiteren bestehen Defizite bei der Früherkennung, Diagnose, Behandlung und Nachsorge von Brustkrebs.
(vgl. Scholze 2002, S.6)
Schließlich wurde das aus den USA stammende Modell der Disease-Management-Programme in die gesundheitspolitische Diskussion in Deutschland eingebracht als Qualitätsinstrument zur Verbesserung der Versorgung chronisch Kranker. Dabei standen zunächst medizinische Motive, wie die Einführung einer evidenzbasierten Medizin und die Aktivierung der Patienten zur Übernahme von mehr medizinischer Verantwortung, im Vordergrund. (vgl. Scholze 2002, S.6) Dass jedoch auch wirtschaftliche Aspekte eine wesentliche Rolle einnehmen zeigte sich zunehmend bei der Einführung der DMPs.
Im Januar 2002 trat das Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs (RSA) in Kraft. Darin ist geregelt, dass der Koordinierungsausschuss (mittlerweile der GemBA) dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) mindestens 4 chronische Krankheiten empfiehlt, die sich für ein Disease-Management-Programm eignen. (vgl. Müller de Cornejo u.a. 2002, S.5) Der Koordinierungsausschuss ist eine Arbeitsgemeinschaft aus Mitgliedern der GKV, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Bundesärztekammer. Seit dem 1.Januar 2004 hat der Gemeinsame Bundesausschuss (GemBA) die Aufgaben des Koordinierungsausschusses übernommen.
Am 7.Februar 2002 hat das BMG auf der Basis der Empfehlungen des Koordinierungsausschusses folgende chronische Krankheiten für die Entwicklung von DMPs empfohlen:
1. Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 (inkl. Modul Hypertonie)
2. Chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen (Asthma bronchiale und COPD)
3. Brustkrebs
4. Koronare Herzkrankheit (inkl. Modul Hypertonie)
Wesentliches Kriterium bei der Auswahl war das Vorherrschen der Krankheiten in der GKV.
(vgl. Müller de Cornejo u. a. 2002, S.5 u. S.7)
Im 2. Schritt hat der Koordinierungsausschuss die Anforderungen an die Ausgestaltung der Programme definiert und an das BMG empfohlen. Folgende definierte Eckpunkte sollten hierbei berücksichtigt werden:
1. Behandlung nach evidenzbasierten Leitlinien unter Berücksichtigung des jeweiligen Versorgungssektors,
2. durchzuführenden Qualitätssicherungsmaßnahmen,
3. Voraussetzungen und Verfahren für die Einschreibung des Versicherten in ein Programm einschließlich Dauer der Teilnahme,
4. Schulungen der Leistungserbringer und der Versicherten
5. Dokumentation und
6. Bewertung der Wirksamkeit des Behandlungsprogramms und der Kosten (Evaluation) und die zeitlichen Abstände zwischen den Evaluationen eines Programms sowie die Dauer seiner Zulassung
(vgl. Müller de Cornejo u. a. 2002, S.7)
Eine wesentliche Bedeutung kommt im Zusammenhang mit dem DMP dem Risikostrukturausgleich zu: Hierbei sollte man wissen, dass der RSA den Zweck verfolgt, dafür zu sorgen, dass Krankenkassen nicht aufgrund ihrer Mitgliederstruktur finanziell benachteiligt werden, und somit in Wettbewerb um gesunde Patienten treten, was wiederum zu einer Benachteiligung chronisch kranker und/oder weniger jungen Patienten führen würde.
Daher zahlen alle gesetzlichen Krankenkassen regelmäßig aus den Beiträgen ihrer Versicherten, den selben Prozentsatz der beitragspflichtigen Einnahmen ihrer Mitglieder (Ausgleichsbedarfssatz) in einen RSA- Ausgleichstopf. Das BVA (Bundesversicherungsamt) ermittelt dann anhand der
- Anzahl der mitversicherten Familienangehörigen
- Alter und Geschlecht
- Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit
- unterschiedlicher Krankengeldansprüche
den jeweiligen Beitragsbedarf jeder Krankenkasse. Diese erhalten dann entsprechende Beitragsbedarfszuweisungen gemessen an der Risikostruktur ihrer Mitglieder.
(vgl. Müller de Cornejo u. a. 2002, S.6)
So wurden im Jahr 2000 rund 24,2 Milliarden DM zwischen den Krankenkassen hin- und herbewegt.
Das Hauptmanko der RSA war jedoch bis vor kurzem, dass die Morbidität der Versicherten nicht berücksichtigt wurde, also kein Unterschied gemacht wurde zwischen jemandem, der mit 35 an Diabetes leidet und daher höher finanziert werden muss, und einem gleichaltrigen, der nur zwei Mal im Jahr zur Zahnkontrolle geht. Verständlich, dass diese Situation zu massiven Wettbewerbsverzerrungen führte und insbesondere neu gegründete Betriebskrankenkassen verstärkt um junge, gesunde Versicherte mit minimalem Morbiditätsrisiko warben. So waren unter den 1,2 Millionen neuen Mitgliedern der Betriebskrankenkassen im Jahr 2000 lediglich 0,06% chronisch Kranke. Diese „Morbiditätsverdünnung“ auf Seiten der neuen Kassen hatte jedoch zur Folge, dass sich zunehmend chronisch kranke und alte Versicherte bei den traditionellen Krankenkassen (z.B. AOK) konzentrierten. (vgl. Scholze 2002, S.7)
Hier kommen nun die im Januar 2002 in Kraft getretene Reform des Risikostrukturausgleichs und die Disease-Management-Programme ins Spiel: Um die Situation chronisch Kranker zu verbessern, Krankenkassen mit einem höheren Anteil chronisch Kranker zu entlasten und Anreize zur Auswahl eines Klientels mit geringem Morbiditätsrisiko zu eliminieren , wurde eine zusätzliche Gruppe im RSA geschaffen, aus der die Kosten für chronisch Kranke vergütet werden, die sich in ein DMP eingeschrieben haben. So entsteht ein höherer Finanzrückfluss aus dem RSA. Dabei handelt es sich jedoch nur um eine Übergangsregelung:
„Nach dem Fahrplan des Bundesgesundheitsministeriums soll bis zum 1.1.2007 – nach intensiven Vorarbeiten – ein echter morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich eingeführt werden.“ (Scholze 2002, S.7)
[...]
- Arbeit zitieren
- Anonym, 2005, DMP - Disease Management Programme, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50201
Kostenlos Autor werden
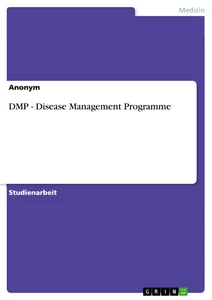

















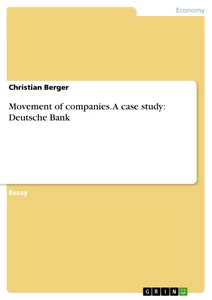

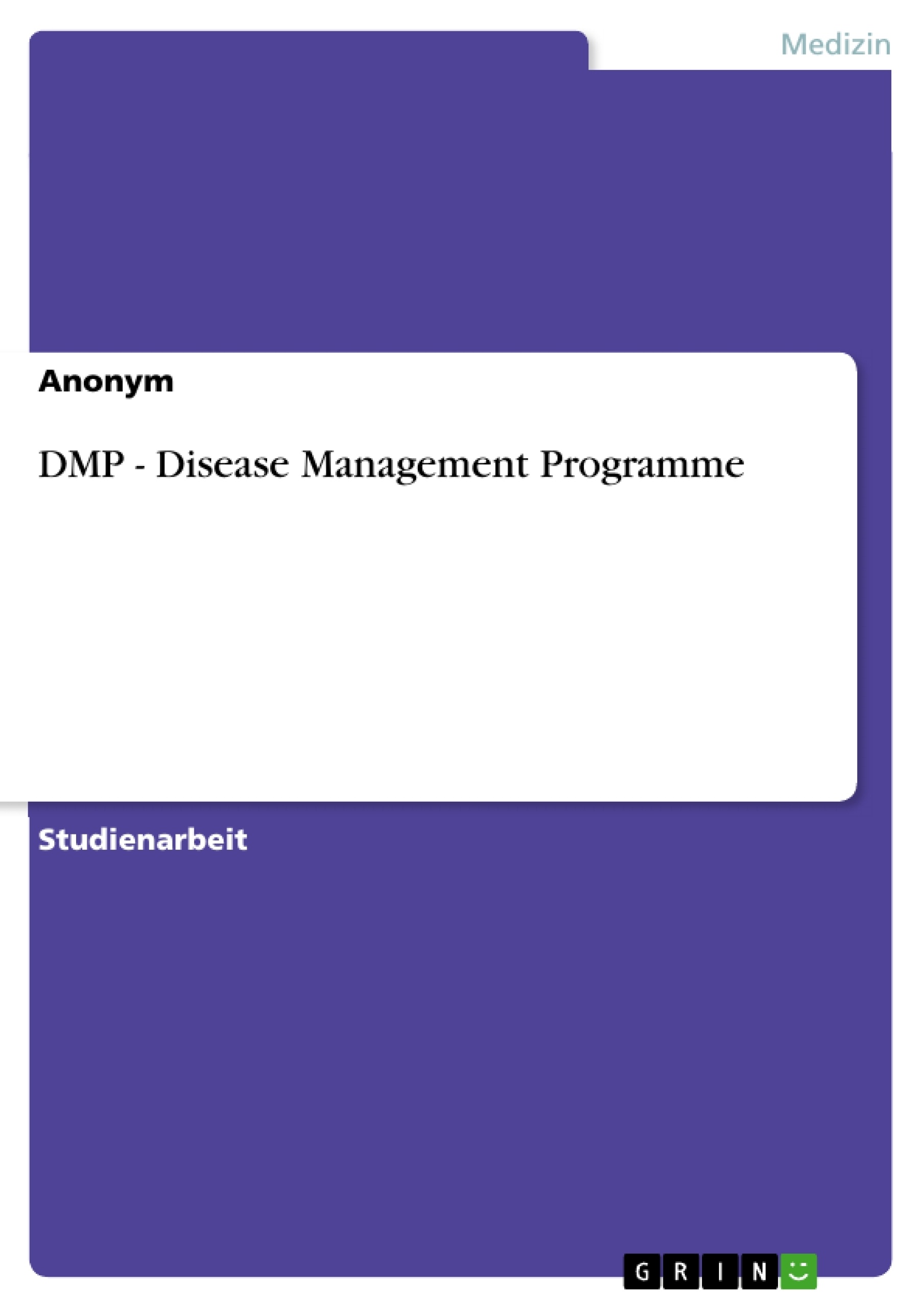

Kommentare