Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Zum Thema
1.2 Vorgehensweise und Ziel
2. Oettingens System
2.1 Herleitung der Klangverwandtschaft
2.1.1 Verwandtschaft innerhalb von akustischen Klängen und Mehrklängen
2.1.2 Klangvertretung
2.1.3 Tonizität und Phonizität
2.2 Das Tonnetz der reinen Stimmung
2.3 Grundlagen der harmonischen Modulation
2.3.1 Verwandtschaftsarten
2.3.2 „Dissonanz und Auflösung“: Terminologie
2.3.3 Verwandtschaftskreis der reinen Tongeschlechter
3. Reaktionen
3.1 Stumpfs Kritik
3.2 Riemanns Modifizierungen
3.3 Ausblick auf Vogel
4. Fazit
Literatur- und Siglenverzeichnis
Anhang: Tabelle des Verwandtschaftskreises der reinen Tongeschlechter
1. Einleitung
1.1 Zum Thema
Unter dem Begriff „harmonischer Dualismus“ etablierte sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland eine Letztbegründungsbewegung innerhalb der Musik‑
theorie. Anlass war das bisherige Versagen aller namhaften Musiktheoretiker, das Mollgeschlecht als neben dem Durgeschlecht gleichberechtigten Pfeiler der harmonischen Tonalität herzuleiten. Zwar gab es schon lange vor Rameau diesbezügliche Versuche (vgl. R 1921, 389 ff.). Jedoch gilt als der erste, der die „Tonalität in ihrer Dualität als Dur [und] Moll“ (R 1914, 49) systematisch herzuleiten versucht hat, Arthur von Oettingen (1836-1920). Seine früheste Ausarbeitung zu diesem Thema erschien 1866 unter dem Titel Harmoniesystem in dualer Entwickelung (Oe 1866). Der dort zutage tretende Letztbegründungsanspruch forderte in den darauffolgenden Jahrzehnten die namhaftesten Musiktheoretiker in Deutschland zu Anknüpfungen oder kritischen Stellungnahmen heraus. Bis heute bedeutsam sind hierbei Carl Stumpf (1848-1936) und Hugo Riemann (1849-1919). – Nach Riemanns Eintreten für den „harmonischen Dualismus“ wurde es jedoch still um denselben. Die auf die musikalische Praxis des Komponierens und Instrumentalspiels abgestellte Musiktheorie an den staatlichen Hochschulen für Musik meinte, auf diesen teilweise sehr komplizierten theoretischen Überbau verzichten zu müssen, da er die musikalische Praxis eher behindere als fördere. – In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war dagegen Martin Vogel (geb. 1923) bestrebt, die Erbschaft Oettingens und Riemanns wiederzubeleben, zu erweitern und für die musikalische Praxis und Theorie fruchtbar zu machen.
1.2 Vorgehensweise und Ziel
Meine Ausarbeitung gliedert sich in zwei Hauptteile:
Zuerst gehe ich auf Oettingen ein (Abschnitt 2). Dabei nehme ich hauptsächlich Bezug auf die zweite Fassung seines Systems, die er in den Annalen der Naturphilosophie der Jahrgänge 1902-1906 (Oe 1-5) veröffentlichte. Manche Begriffe, Symbole und Systematisierungen dieser Fassung erhalten in Oettingens vierter und letzter Fassung, die den Titel Die Grundlage der Musikwissenschaft trägt (Oe 1916), eine Revision hinsichtlich größerer Klarheit. Ich werde dieses Werk gelegentlich zur Ergänzung heranziehen[1].
Im zweiten Teil (Abschnitt 3) werde ich unter der Überschrift „Reaktionen“ skizzenhaft die Weiterentwicklungen bzw. Modifikationen des harmonischen Dualismus betrachten, wie sie sich bei Riemann (Abschnitt 3.2) und Vogel (3.3) finden. Dort wird auch auf die Einwände von Stumpf eingegangen (3.1).
Zur Zitier- und Abkürzungsweise: Die Quellenangaben sämtlicher Zitate und Abbildungen erfolgen direkt im fortlaufenden Text. Die dabei verwendeten Abkürzungen sind im Literatur- und Siglenverzeichnis (unten S. 37) den betreffenden Literaturangaben zugeordnet.
2. Oettingens System
- Anliegen und methodisches Vorgehen
Der harmonische Dualismus nach Oettingen möchte folgende Fragen klären:
- Wie verstehen wir Musik?
- Was macht insbesondere einen mehrstimmigen Klangverlauf („Akkordfortschreitung“) für uns sinnvoll?
- Welche Regeln muss der Komponist hierfür beachten?
- Oettingens Vorgehen hierbei:
Er will die Verwandtschaft zwischen gleichzeitigen oder aufeinanderfolgenden Tönen und Klängen erklären. Um musikalische Verwandtschaft zu erklären, muss der Begriff der Konsonanz geklärt werden. Dieser Begriff steht im allgemeinen für das wohlklingende bzw. harmonische Zusammenklingen von musikalischen Einzelbestandteilen (Töne/Klänge) in Form eines Mehrklangs. Ist Konsonanz vorhanden, so besteht per definitionem eine Verwandtschaft zwischen jenen Einzelbestandteilen. Das Zusammenklingen von nicht miteinander verwandten Bestandteilen wird dagegen Dissonanz genannt.
- Systematischer Ort
Gesetzmäßigkeiten der oben genannten Art aufzustellen ist traditioneller Weise Aufgabe der Harmonielehre. Als solche will auch Oettingen sein System verstanden wissen. Musik (als mehrstimmige) wird hier nur unter dem Aspekt der vertikalen akkordischen Zusammensetzung und deren zeitlicher Veränderung betrachtet. Außer Betracht bleiben metrische, rhythmische und – zumindest bei Oettingen – auch stimmführungsbezogene Gesetzmäßigkeiten.
* * *
Zunächst gibt Oettingen (in den Annalen) einen Überblick über die Teilgebiete seines Systems (Oe 2, 375). Ich werde sie im Folgenden unter drei Hauptgesichtspunkte zusammenfassen:
- Herleitung der Klangverwandtschaft (Abschnitt 2.1)
- Das Tonnetz der reinen Stimmung (Abschnitt 2.2)
- Grundlagen der harmonischen Modulation (Abschnitt 2.3).
2.1 Herleitung der Klangverwandtschaft
Oettingens erstes Arbeitsziel seines Systementwurfs ist „die duale Herleitung der beiden Formen der Konsonanz als tonischer und phonischer Dreiklang“ (Oe ). Was unter den beiden letztgenannten Begriffen zu verstehen ist, wird sich im Verlauf der Darstellung seiner Klangverwandtschaftstheorie klären.
2.1.1 Verwandtschaft innerhalb von akustischen Klängen und Mehrklängen
Klangverwandtschaft ist die Grundlage jeder Modulation. Seit der Etablierung von Riemanns „funktioneller“ Harmonielehre[2] beziehen sich die Gesetze der Verwandtschaft zwischen Tönen oder Klängen auf das Wechselverhältnis der beiden Tongeschlechter Dur und Moll. Im folgenden gilt es herauszuarbeiten, wie Oettingen die Klangverwandtschaftsgesetze herleitet. Dabei wird deutlich werden, dass das Wechselverhältnis der beiden Tongeschlechter bei Oettingen sogar der Ausgangspunkt seiner Klangverwandtschaftstheorie ist.
Verwandtschaft zwischen Klängen beruht auf dem Konsonanzprinzip. Konsonanz wird von Oettingen u.a. als die psychische Tätigkeit bezeichnet, zwei oder mehrere gleichzeitig erklingende Töne zu einem Klang zusammenzufassen, der als „einheitliche Vorstellung“ empfunden wird (vgl. Oe 1, 63). Um zu erklären, was diese psychische Tätigkeit im Menschen auslöst, bezieht sich Oettingen auf die physikalisch-akustische Herleitung der Konsonanz, die Hermann von Helmholtz (1821-1894) in seinem Buch „Die Lehre von den Tonempfindungen“ von 1863 (Hel 1913) vorgelegt hatte. Sowohl Helmholtz als auch Oettingen sehen in einer akustischen Konsonanzbestimmung die notwendige Grundlage jeder Harmonielehre. Ich werde im Folgenden einige Begriffsbestimmungen vornehmen, die Oettingens auf Helmholtz bezogene Auffassung der Konsonanz betreffen.
- Akustische Klänge und Mehrklänge
Helmholtz nennt obertonhaltige Töne „Klänge“, im Gegensatz zu (aus einer einzelnen periodischen Schwingung bestehenden) Sinustönen (vgl. He 1913, 39). Klänge beinhalten stets einen Grundton und eine (im Idealfall unendliche) Reihe von Obertönen, deren Frequenzverhältnisse auf der ganzzahligen harmonischen Teilungsreihe beruhen: 1 : 1/2 : 1/3 : 1/4 etc. (Bei realer Tonerzeugung erklingen, je nach Instrument variierend, immer nur bestimmte Ausschnitte der Obertonreihe.)
Ich werde „Klänge“, wie Helmholtz sie definiert, im Folgenden „akustische Klänge“ nennen, um sie von „Mehrklängen“ (z.B. Zwei- und Dreiklängen) zu unterscheiden.
- Intervalle und Akkorde
Mehrklänge, die aus zwei Tönen bestehen („Zweiklänge“), werden in durmolltonaler Musiktheorie Intervalle genannt, wogegen unter den Begriff Akkorde Mehrklänge ab drei Tönen fallen (vgl. R 1909 unter den jew. Stichwörtern). Nach Oettingen sind Intervalle nicht konsonanzfähig im musikalischen Sinn, da erst das Dazukommen eines dritten Tons entscheidet, ob der fragliche Klang im vorliegenden musikalischen Zusammenhang (akkordischer Verlauf) eine Kon- oder Dissonanz ist (s. unten S. 13).
- Akustische und musikalische Konsonanz
Wenn, wie oben erwähnt, der akkordische Verlauf eines Stückes entscheiden soll, ob ein bestimmter Einzelklang desselben konsonant oder dissonant ist, spricht Oettingen von musikalischer Konsonanz. Andere Kriterien gelten ihm zufolge für die akustische Konsonanz. Dieser Terminus bezieht sich auf physikalische Eigenschaften.[3]
Oettingen übernimmt hierfür Helmholtz’ These, dass wir Mehrklänge genau dann als „einheitliche Vorstellung“ empfinden, wenn ihre Einzeltöne (als akustische Klänge) mehrere Natur- bzw. Teiltöne beinhalten, die von ihren Frequenzen her miteinander identisch sind („koinzidieren“). Es lässt sich laut Helmholtz eine Stufenfolge von Konsonanzgraden erstellen (vgl. Hel 419 ff.). Demnach sind zwei Töne im Abstand einer Oktave am engsten verwandt, da die meisten ihrer Teiltöne identisch sind. Bei einer Quinte sind mindestens drei übereinstimmende Teiltöne im – nach Oettingen – hörbaren Bereich vorhanden.[4] Und bei einem Dreiklang, bestehend aus Prim, großer Terz und Quinte, sind es mindestens zwei Teiltöne.
Der Quintabstand wird in der Musiktheorie seit den Griechen als sehr bedeutsam für die Verwandtschaftsstiftung zwischen Tönen angesehen[5]. Um zu zeigen, warum Klänge[6] in Dur und Moll, deren Grundtöne im Quintverhältnis stehen, verwandt sind, braucht Oettingen den Begriff der Klangvertretung.
2.1.2 Klangvertretung
Klangvertretung heißt zunächst (wie es auch Riemann versteht: vgl. R 1916), dass Einzeltöne, Intervalle oder Akkorde als Bestandteile eines Dreiklangs aufgefasst werden und denselben jederzeit in musikalischen Zusammenhängen „vertreten“ können, ohne dass der gesamte Dreiklang erklingt. Hierfür braucht man nur zu wissen, dass ein Einzelton sechs verschiedene Dreiklänge vertreten kann, ein Intervall zwei (nämlich einen Dur- und einen Molldreiklang), und ein dreistimmiger Akkord (...) immer nur „e i n e ganz bestimmte Klangvertretung aufweisen“ kann.[7]
Was berechtigt die beschriebene Klangvertretung? Es muss nachgewiesen werden, dass der betreffende Einzelton engstens verwandt ist mit den Klängen, die er vertritt. Hierzu zeigt Oettingen im Anschluss an Helmholtz, dass jeder Einzelton als harmonischer Grundton eines akustischen Klanges angesehen werden kann – d.h. als Teilton Nr. 1 – , und zwar sowohl als Grundton einer Ober- als auch einer Untertonreihe. Die Klangvertretung ist jetzt nicht mehr bezogen auf Klänge, die durch unterschiedliche Tonquellen erzeugt werden, sondern auf Klänge, die einer einzigen Tonquelle entstammen. Oettingen bemüht diesen Rückgriff auf die (Helmholtzsche) Akustik, um die Klangverwandtschaft als ein natürliches Gesetz der Musik herleiten zu können.
Helmholtz hat die Verwandtschaft zwischen akustischen Klängen – ihre Eigenschaft, miteinander zu konsonieren – u.a. durch die teilweise Identität ihrer Teiltonreihen erklärt. Oettingen gibt Helmholtz’ Definition der Konsonanz mit folgenden Worten wieder:
- „Er wies darauf hin, dass wir die einfachen reinen Intervalle, wie 1:2, 2:3, 4:5, [d.h.] Octave, Quint und Terz als Theile eines Klanges erkennen; andererseits wies er darauf hin, daß solche Intervalltöne gemeinsame Obertöne haben“ (Oe 1, 64).
An dieser Formulierung wird zweierlei deutlich. Erstens zeigt sie Oettingens Bestreben, Helmholtz als „Ahnherrn“ seiner wichtigsten Erkenntnis darzustellen, nämlich: dass
„ [...] das Consonanz-Prinzip ist ein duales, d.h. zwiefältig entgegengesetztes“ sei (Oe 1, 74.). – Zum anderen bilden, dem obigem Zitat zufolge, die zwei Töne, aus denen ein Intervall besteht, nicht von sich aus eine (musikalische) Konsonanz. Sondern der Anfangs- und der Endton eines Intervalls sind genau dann miteinander verwandt, wenn sie als Teile eines Mehrklangs (ab drei Tönen) erkannt werden. Wie ist das zu verstehen? Warum sind erst Dreiklänge konsonanzfähig im musikalischen Sinn? Hierauf gibt Oettingen durch seine „duale“ Definition der Konsonanz, und sein darauf bezogenes Gesetz der Klangvertretung, eine Antwort.
- Die duale Definition der Konsonanz
Das Gesetz der Klangvertretung wird von Oettingen in zweierlei Hinsicht formuliert: bezüglich des Dur - und des Moll dreiklangs (jeweils in Grundstellung).
(a) Dass die drei Töne des Durdreiklangs zu einer Einheit im Sinne der Konsonanz verschmelzen, lasse sich dadurch erklären, dass man sie als Obertöne eines gemeinschaftlichen Grundtons (“Klang“ im akustischen Sinn nach Helmholtz) ansieht, genauer gesagt: als dessen Teiltöne Nr. 4, 5 und 6. Der Grundton dieser Obertonreihe (als Teilton Nr. 1) ist dann der Vertreter jenes Dreiklangs. Dass Obertöne mit ihrem Grundton zu einem akustischen Klang verschmelzen, der als einheitliche Vorstellung fungiert, wie die Hörpsychologie ja nachgewiesen hat, liegt nach Helmholtz an den ganzzahligen Verhältnissen seiner Teiltonfrequenzen. Die hier stattfindende Verschmelzung[8] wird nun von Oettingen als Argument dafür genommen, dass drei Töne, die einen Durdreiklang bilden, aber unterschiedlichen Tonquellen entstammen, genauso stark verschmelzen.
(b) Der Molldreiklang wird hörpsychologisch bekanntlich ebenfalls als konsonante Einheit empfunden. Der Grund liegt nach Oettingen darin, dass seine drei Einzeltöne (Quintton, große-Terzton, Primton – in absteigender Form) – jeder als akustischer Klang gesehen – mindestens einen (gut vernehmbaren) gemeinsamen Oberton haben. Beim c-Moll-Dreiklang ist dieser Oberton das zwei Oktaven über dem Quintton g liegende g" (vgl. Vo 1966, 105). Die Töne g-es-c sind dann Vertreter des (quasi) akustischen Klangs g("), allerdings als Bestandteile seines Unter -, nicht seines Oberklangs. In der folgenden Abbildung sind die Untertöne Nr. 4, 5 und 6 als Bestandteile der harmonischen Teilungsreihe von C angegeben.[9]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gemäß der dargestellten Herleitung unterscheiden sich Dur und Moll durch die Kennzeichnungen „Sein“ und „Haben“: „Bei Oettingen sind die Töne des D u r dreiklangs gemeinsame Bestandteile eines tonischen Grundklangs und haben die Töne des
M o l l dreiklangs einen gemeinsamen phonischen Oberton“ (Vo 1966, 106). Quelle: Vo 1966, 105
Oettingen verzichtet auf die traditionellen Bezeichnungen Dur und Moll. Moll lässt sich nicht aus der mitklingenden Obertonreihe ableiten, wie es Musiktheoretiker seit Rameau immer wieder mit Dur getan haben, um die Naturgegebenheit der Durmolltonalität zu beweisen. Ein Äquivalent haben die drei Töne des Mollakkords nur in den Teiltönen Nr. 10, 12 und 15, die hörpsychologisch viel weniger repräsentativ sind als die Teiltöne Nr. 1-6, die sämtlich der Durharmonie angehören. – Die Herleitung der Tongeschlechter aus mitklingenden Teiltonreihen ist seit Stumpf und Riemann endgültig ad acta gelegt worden (vgl. Vo 1966, 107). Oettingens Neuversuch ist es, den Molldreiklang als „Umkehrung“ des Durdreiklangs anzusehen. Dann könne man durchaus Teiltonreihen heranziehen, ohne sich in Widersprüche zu verwickeln. Man komme nämlich um das Problem der Begründung der kleinen Terz herum, wenn man auf dem Primton des Durdreiklangs eine absteigende Teiltonreihe beginnen lasse (die dann allerdings ein bloßes Konstrukt ist, dem kein akustisches Äquivalent entspricht): vgl. die Abbildung auf der folgenden Seite.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
c' : e' : g' reziprok zu c' : as : f
P gT Q P gT Q des anderen Geschlechts.[10]
Die drei Tonleiterformen, die traditionellerweise dem Mollgeschlecht zugerechnet werden (natürlich/äolisch, harmonisch, melodisch), werden bei Oettingen durch eine einzige Form ersetzt. Diese ergibt sich bei ihm direkt aus seiner spiegelbildlich symmetrischen Herleitung der Tongeschlechter und stimmt mit keiner der drei Mollskalen, dagegen aber mit der sogenannten „antik-dorischen“ Skala, überein (vgl. unten Abschnitt 2.3.1). Konsequenterweise ersetzt Oettingen den Begriff Moll durch einen anderen, nämlich phonisch, und tauft, um ein Äquivalenzverhältnis herzustellen, Dur in tonisch um.
Soweit zur Symmetrie des „tonischen“ und „phonischen“ Dreiklangs. Oettingen bemüht sich jedoch des Weiteren, nachzuweisen, dass beide Dreiklangsformen auch von ihrer physikalischen Natur her aufeinander bezogen sind.
Dies erfordert es, Oettingens Begriffe Tonizität und Phonizität zu erörtern. Sie sind gar nicht so einfach zu verstehen in der Wechselseitigkeit dessen, was sie aussagen. – Im nächsten Abschnitt wird gezeigt, inwiefern Oettingens spezifischer Klangvertretungsbegriff (der sehr viel weiter gefasst ist als bei Riemann, vgl. R 1905, Nr.3, 45) sich nur aus jenem polaren Begriffspaar verstehen lässt. Gegen Ende des folgenden Abschnitts (S. 12) werde ich dann Oettingens endgültige Definition der Klangvertretung anführen.
2.1.3 Tonizität und Phonizität
- Definitionen:
(1) „Die Eigenschaft, Teiltöne eines und desselben Gruntones zu sein, nennen wir Tonicität, und die andere, gemeinsame Obertöne zu haben, nennen wir Phonicität.“ (Oe 3, 64; Kursivsetzung: Vf.).
(2) Konkretion zur Phonizität:
„Den ersten allen [drei Bestandteilen eins Dreiklangs] gemeinsam zukommenden Partialton nenne ich den [...] phonischen Oberton, weil alle den Ton gleichsam singen, d.h. wirklich angeben (von [griech.] jwnew, ich singe)“ (Oe 3, 260).
(3) Konkretion zur Tonizität:
„Tonicität eines Intervalles oder Akkordes ist seine Eigenschaft, als Klangbestandteil eines Grundtones aufgefaßt zu werden. Diesen Grundton nennen wir den tonischen Grundton. [...] „Es erscheinen die drei Töne [am Beispiel eines aus dem 4., 5. und 6. Partialton bestehenden Akkords] in eine Klangmasse eingespannt“, wobei „tonisch nichts anderes als e i n g e s p a n n t“ bedeutet (a.a.O., 259. Kursivsetzung: Vf.).
Tonizität und Phonizität sind Ausdruck von Oettingens Bestreben, Dur und Moll in spiegelbildlicher Symmetrie aus einer gemeinsamen Wurzel herzuleiten[11]. Es ist, wie gezeigt wurde, die Symmetrie von Oberton-Sein und Oberton-Haben. Daraus ergibt sich aber das Paradox, dass im Falle des Molldreiklangs der erste gemeinsam gehabte Oberton nachträglich zum (harmonischen) Grundton der drei Töne erklärt wird. Im vorigen Abschnitt wurde bereits gezeigt, dass die Klangvertretung beim Molldreiklang nur durch eine exakte Umkehrung der Obertonreihe des Durdreiklangs zu verstehen ist, die dann als „Untertonreihe“ zu gelten hat. Helmholtz dagegen spricht von (akustischem) „Klang“ nur im Falle eines obertonhaltigen Tons. Ein untertonhaltiger Klang ist, wie oben erwähnt, ein bloßes Konstrukt. – Martin Vogel, der Hauptvertreter des harmonischen Dualismus im 20. Jahrhunderts, hat zwar nichts dagegen einzuwenden, die beiden Tongeschlechter aufgrund einer Ober- und einer Untertonreihe herzuleiten. Sein Vorwurf an Oettingen ist aber, dass er in einem Atemzug sowohl ein physikalisches als auch ein abstrakt konstruiertes Prinzip zur Begründung heranzieht. Vogel hat im Anschluss an Stumpf dargelegt, dass auch die akustisch nachweisbare Obertonreihe nicht zur Begründung von Dur taugt (vgl. unten Abschnitt 3.1). Vogel lässt im Gegensatz zu Stumpf aber beide Teiltonreihen als abstrakte mathematische Prinzipien zu Herleitungszwecken gelten (vgl. 3.3).
In der auf der nächsten Seite abgebildeten Grafik verdeutlicht Oettingen den Dualismus von Tonizität und Phonizität. Oettingen scheint stillschweigend vorauszusetzen, dass der Leser dieses (von Rummenhöller so bezeichnete) „logistische“ Gedankenkonstrukt akzeptiert als eine ausreichende Grundlegung der Klangverwandtschaft (vgl. Oe 3, 251; Rum 83).
Die linke Spalte (I) zeigt die Ober- und die Untertonreihe des Tons D an, über drei Systeme (nach oben und unten) verteilt[12]. Umkringelt sind jeweils diejenigen Teiltöne, die dem Dur- und dem Molldreiklang in Grundstellung entsprechen.
[...]
[1] Oettingens dazwischenliegende dritte Fassung erschien 1913 unter dem Titel Das duale Harmoniesystem (Oe 1913).
[2] Vgl. hierzu Riemanns Übersicht über seine eigene Entwicklung zu dieser Theorie von 1877 bis 1893 in: R 1921, 524 ff.
[3] Im späteren Verlauf seiner Ausführungen nennt Oettingen akustische Konsonanzen Konkordanzen; wogegen der Begriff Konsonanz auf die musikalischen Konsonanzen beschränkt wird (vgl. unten Abschnitt 2.3.2 ).
[4] Stumpfs Einwände aus hörpsychologischer Sicht behandele ich in Abschnitt 3.1.
[5] Vgl. R 1914, 28 ff.
[6] sowohl als akustische Klänge als auch als Mehrklänge verstanden. Warum Oettingen beide Arten hier gleichwertig behandelt, wird im nächsten Abschnitt gezeigt.
[7] Vgl. Oe 3, 268. Eine Darstellung aller Vertretungsmöglichkeiten in Notenschrift findet sich in R 1916, 6 f.
[8] Dieser Begriff bezieht sich bei Stumpf (Stu 1890) ausschließlich auf das Wahrgenommenwerden der Konsonanz, nicht auf ihre physikalische Beschaffenheit. Oettingen verwendet „Verschmelzung“ als Synonym zu „Konsonanz“ und macht Stumpf damit dessen Anspruch streitig, mit seinem Verschmelzungsbegriff eine Erklärung des Konsonanzphänomens geleistet zu haben. Vgl. Oe 4, 117 f., sowie unten Abschnitt 3.1.
[9] Zum Gegensatz von arithmetischer und harmonischer Teilungsreihe vgl. unten Abschnitt 3.3.
[10] P = Prim ton, gT = Endton der großen Terz, Q = Endton der Quinte. – Die Pfeile geben die Richtung des „Abzählens“ an; die Ableitung aus den Teiltonreihen findet sich vereinfacht und anschaulich, aber vom Prinzip her erheblich modifiziert bei Riemann: R 1914, 51 (vgl. auch unten, S. 31, Punkt 4).
[11] Oettingen selber will sein Prinzip nicht als symmetrisch verstanden wissen. Das widerspreche der sinnlichen Hörwahrnehmung. Symmetrie zeige sich nur im Notenbild; die Frequenzen beider Tonleitern sind dagegen als reziprok anzusehen. Vgl. Oe 1, 64 f., sowie Stumpfs unten in 3.1 referierte Kritik.
[12] Oettingen hat den Bassschlüssel deswegen gewählt, weil mit ihm das symmetrische Verhältnis beider Tongeschlechter am besten dargestellt werden könne, und zwar genau dann, wenn man den Ton D als Zentrum wählt. Oe nennt ihn deshalb auch D-Schlüssel. (Weiteres Argument: Auf der Klaviertastatur befindet sich D genau in der Mitte.)
- Arbeit zitieren
- Andreas Jakubczik (Autor:in), 2003, Der "harmonische Dualismus" von Arthur von Oettingen bis Martin Vogel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33519
Kostenlos Autor werden











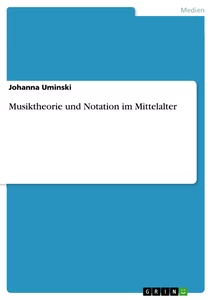



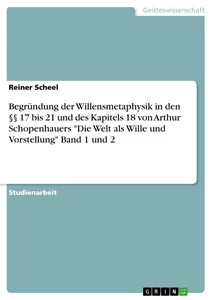



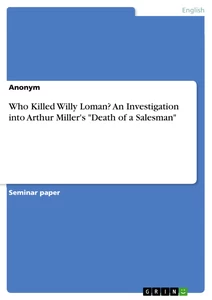
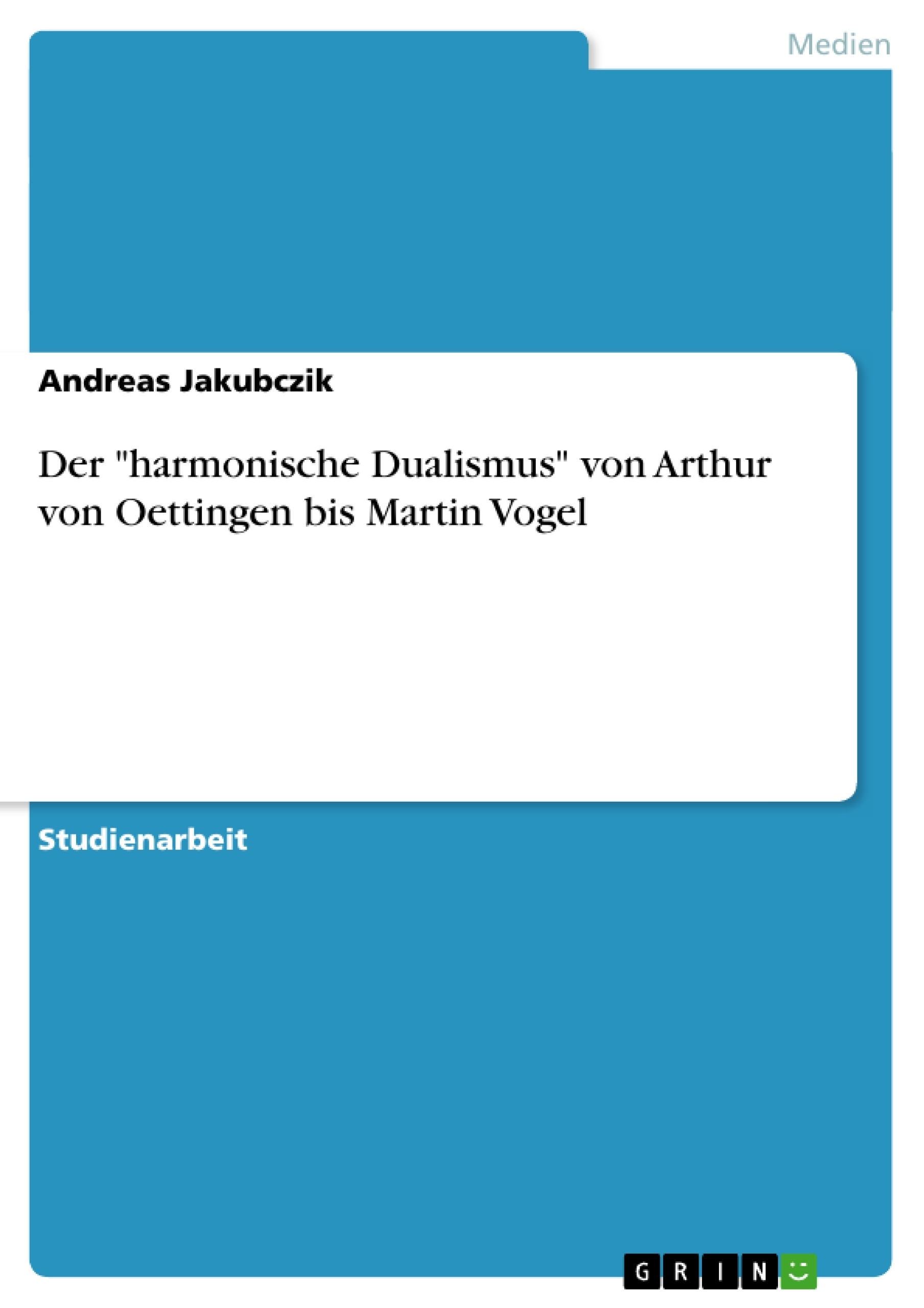

Kommentare
"Dur-Moll-Dualismus" ist nichts anderes als eine verkümmerte Reduzierung vorhandenen Skalenmaterials. Der diatonisch unterteilte Oktavraum erlaubt unterschiedliche Tongeschlechter. Lediglich die Musik der Klassik mit ihren Leerformeln, Klischees und endlosen Solfeggios brachte dieses stümperhafte Dur-Moll-Skelett hervor. (Florafox-Emeraldo)