Leseprobe
Inhalt
I. Begriffsbestimmung
II. Geschichte der Satire
III. Merkmale der Satire sowie innerhalb satirischer Texte wirksame Kategorien und Spannungsverhältnisse
IV. Darf Satire wirklich alles? Mögliche Ansätze zur Beantwortung der Frage
V. Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
“ Dieser Text ist nicht ernst zu nehmen. Er ist eine Satire.
Dieser Text ist verdammt ernst zu nehmen. Er ist eine Satire. “ 1
I. Begriffsbestimmung
Der Satire-Begriff geht nach heute vorherrschender Meinung auf die lateinische lanx satura, eine mit verschiedenen Früchten gefüllte Opferschale, zurück. Weitere Herleitungen, besonders während der Spätantike und der Renaissance, nahmen den griechischen Satyr (ein legendäres Mischwesen aus Mensch und Bock) bzw. das griechische Satyrspiel als Quelle für den Begriff an, was angesichts der humoristischen und parodistischen Züge dieses Vorläufers der antiken Tragödie auch durchaus berechtigt erscheint, allerdings seit der Aufklärung als widerlegt gilt.
Bis in die frühe Neuzeit hinein war “Satire“ die Bezeichnung einer speziellen literarischen Gattung, nämlich der Römischen Verssatire (siehe II.)2 Um 200 v.Chr. wurde der Begriff “Satura“ von Ennius für sein “Allerlei“ gemischter Gedichte (ohne eigentlichen satirischen Inhalt) verwandt und von Lucilian (siehe II.), der als Erfinder der Satire gilt, übernommen. Erst nach und nach begann sich der Begriff aufzuweichen und bezeichnet heute vor allem eine die Gattungen und Einzelkünste übergreifende Verfahrensweise, die genauer zu definieren sich die Philologie bisher jedoch sträubt. Die Disparität der Erscheinungsformen von Satire macht eine Abgrenzung zu anderen Kunstformen, die nicht dogmatisch sein will, schwierig und würde die Satireforschung eher behindern als voranbringen, zumal sich die Satire längst auch andere Medien wie Bild und Film erobert hat und “das Satirische“ oft nur ein Gestaltungselement unter vielen innerhalb eines Kunstwerkes ist. Im weitesten Sinne wird Satire als Spott oder humoristische Kritik eines bestimmten Sachverhaltes aufgefasst; zu den wichtigsten satirischen Gestaltungsmitteln gehören Negativität, Ironie, Nachahmung und Wiederholung, Verfremdung und Indirektheit. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit sondern soll den Charakter der Satire nur grob umreißen. Eine detailliertere Darstellung wird im III. Abschnitt versucht werden.
II. Geschichte der Satire
Die Literaturgeschichte unterscheidet einen griechischen und einen römischen Zweig der antiken Satire. Begründer des ersten, der menippeischen oder varronischen Satire ist der Kyniker Menippos (3.Jh. v.Chr.), dessen mit Versen vermischte Form der Prosasatire im 1.Jh. v.Chr. von dem römischen Gelehrten Varro aufgegriffen wurde. Lukian (2.Jh. n.Chr.), der zu ihrem einflussreichsten Meister wurde, Seneca und Petron stehen ebenfalls in der Tradition der Menippea. Weitaus bedeutsamer und bekannter war in Antike und Mittelalter jedoch die auf Lucilian (2.Jh. v.Chr.) zurückgehende Verssatire, auch lucilische Satire genannt. Deren bedeutendste Vetreter im alten Rom waren Horaz (1.Jh. v.Chr.), Persius (1.Jh. n.Chr.) und Iuvenal (um 100 n.Chr.) Sie gelten als die drei Klassiker der Satire und waren durch das ganze Mittelalter hindurch bekannt, wobei Horaz einen gemäßigten, humorvollen Stil vertritt, zu dem Iuvenals beißende Gesellschaftskritik, die am ehesten der heutigen Vorstellung von Satire entspricht, oft in Opposition gesetzt wurde. Satirische Elemente finden sich auch in den Tierfabeln des Phaedrus und den Epigrammen Martials (beide 1.Jh. n.Chr.)
Das Mittelalter hat in seinen großen höfischen Epen keinen Platz für satirische Elemente. Diese finden sich vor allem im Tierepos (Heinrich von Glîchesaere: “Fvchs Reinhart“, um 1200), in der hauptsächlich an Iuvenal orientierten Ständesatire Heinrich von Melks, Heinrich Wittenwîlwers (um 1400) u.a., in der Sangspruchdichtung Walthers von der Vogelweide (um 1200) und den Liedern Neidharts von Reuental (Zeitgenosse Walthers). Offenkundig ist jedoch, dass Satire im MA sehr viel vermittelter als in der römischen Antike auftritt und ein historisches Gattungsbewusstsein als Satire weitgehend fehlt.
In der frühen Neuzeit erleben die antiken Satireformen eine Renaissance. Sebastian Brandts “Narrenschiff“ (1494) steht in der Tradition der lucilischen Satire, über die zur gleichen Zeit mit den Horaz-, Persius- und Juvenalkommentaren damals namhafter Humanisten die satiretheoretische Reflexion einsetzt. Der Narr wird zum Paradigma satirischer Schreibart schlechthin; auch Erasmus von Rotterdam orientiert sich in seinen Satiren an Brandt. Weit bedeutender aber ist die Wiedergeburt der menippeischen Satire, zu nennen sind hier vor allem Rabelais’ “Gargantua et Pantagruel“ (1533) sowie Cervantes’ “Don Quijote“ (1605/1616). Die Spannungen der Reformationszeit schließlich begünstigen eine bisher beispiellose Vielfalt satirischer Formen, die von Luthers Fabelbearbeitungen (1530) über die Dialogform im “Gesprächsbüchlein“ Ulrich van Huttens (1521) bis zu den Fastnachtsspielen Hans Sachs’ reicht.
Während des Dreißigjährigen Krieges entstehen bis auf Moscheroschs “Wunderliche Gesichte“ (1540/43) bemerkenswert wenig satirische Texte. Das ändert sich in der zweiten Hälfte des 17. Jh., in der die menippeische Tradition von Ch. Weise und Ch. Reuter durch Parodien auf den Reiseroman fortgesetzt wird, während N. Boileau, A. Gryphius und Logau an die römische Verssatire anknüpfen. Eines der bedeutendsten Werke der Epoche dürfte Grimmelshausens “Simplicissimus“-Roman (1669) sein, der als einzige deutschsprachige Satire vor dem 18. Jh. weltliterarischen Rang erlangt hat. Hauptthema der barocken Satire ist die von Krieg und Pest gebeutelte vanitas -Welt, der nun nicht mehr ein an höfischen Werten orientiertes (wie im Mittelalter) oder aus humanistischen und theologischen Grundsätzen abgeleitetes (wie in der Renaissance und Reformationszeit) Idealbild entgegengehalten wird, sondern vielmehr ein Verweis auf die Ewigkeit, die satirische Negation irdischen Lebens schlechthin.
Die Vertreter der Menippea des 18. Jh. nehmen den Optimismus des aufklärerischen Vernunfts- und Fortschrittsdiktums aufs Korn, am sinnfälligsten in Swifts “Gulliver’s Travels“ (1726), Voltaires “Candide“ (1759), Lichtenbergs “Timorus“ (1773) sowie Jean Pauls Frühwerk. Ch. M. Wieland wandelt mit seinen “Abderiten“ (1774/80) auf den Spuren Lukians, während in den satirischen Kleinformen der Zeit eher die Horazische Mäßigung den Vorzug vor scharfer Kritik erhält (bei G.W. Rabener, F.v. Hagedorn, G.E. Lessing).
Für die Satiretheorie bringen das 17. und 18. Jh. einen deutlichen Fortschritt. Die verstärkte Rezeption der griechischen Klassiker hat u.a. eine Übertragung der Kategorien der aristotelischen Poetik auf die Satire zur Folge, was für diese einen Ausbruch aus der vornehmlich italienischen Sammel- und Kommentierleidenschaft bedeutet und ihr einen literaturwissenschaftlichen Zugang ermöglicht. Die Satire als Gattung aber auch das Satirische als Schreibweise werden in Abgrenzung zu anderen literarischen Formen reflektiert und schärfer konturiert, hingewiesen sei hier auf Casaubonus, Heinsius, Dacier und Drydens bahnbrechenden “Discourse Concerning the Original and Progress of Satire“ (1693).
Das 19. Jahrhundert kennt eine Vielzahl satirischer Formen, was allerdings mit dem endgültigen Verlust des satirischen Gattungsbewusstseins einhergeht. Heinrich Heine verbindet in “Deutschland. Ein Wintermärchen“ (1844) literarische und politische Satire. Der deutsche poetische Realismus enthält sich allerdings fast vollständig der Satire, obwohl die satirische Zeitschrift (“Kladderadatsch“, 1848- 1944) als neues Medium in Erscheinung tritt und auch der Satire verwandten Kleinformen wie der Karikatur zu Verbreitung verhilft. In England hingegen ist die Satire auch in dieser Zeit sehr lebendig, beeindruckendstes Beispiel ist Dickens’ “Oliver Twist“ (1837).
Erst Heinrich Mann (“Der Untertan“, 1916) vermag dem satirischen Roman in Deutschland wieder zum Durchbruch zu verhelfen, Karl Kraus’ “Die letzten Tage der Menschheit“ (1918) schließen sich an, während James Joyce 1922 mit “Ulysses“ Aufsehen erregt. Die satirischen Utopien Huxleys (“Brave new world“, 1932) und Orwells (“Animal farm“, 1945; “1984“, 1949) gehören zu den bedeutendsten Prosasatiren des 20. Jahrhunderts, in Deutschland wären Grass’ “Blechtrommel“ (1959) und Bölls “Ansichten eines Clowns“ (1963) zu nennen. Aber auch andere Gattungen und Medien sind stark vom Satirischen geprägt. Tucholsky und Kästner sind Meister der satirischen Kleinform, Kabaretts schießen nach 1900 wie Pilze aus dem Boden, Chaplin produziert die ersten Filmsatiren und auf dem Theater schreiben Brecht, Bernhard und Shaw Satiregeschichte.
III. Merkmale der Satire sowie innerhalb satirischer Texte wirksame Kategorien und Spannungsverhältnisse
Wenn im folgenden von Satire die Rede ist, so ist damit nicht die historische Gattung, sondern der satirische Modus, die satirische Schreibweise, kurz: das Satirische gemeint.
Jürgen Brummack bringt für die Satire drei konstitutive Elemente in Geltung: “ein individuelles: Haß, Wut, Aggressionslust, irgendeine private Irritation; ein soziales: der Angriff dient einem guten Zweck, soll abschrecken oder bessern und ist an irgendwelche Normen gebunden; und schließlich ein ästhetisches, das zwar in seiner Besonderheit von den beiden ersten bedingt ist, aber nicht einfach auf sie zurückgeführt werden kann.“3 Die daraus abgeleitete Formel (Brummack vermeidet den Begriff Definition) lautet: “Satire ist ästhetisch sozialisierte Aggression.“4
Das aggressive Element der Satire wird vornehmlich durch ihre Negativität kenntlich: die Satire, spottet, straft, brandmarkt. Grundvoraussetzung zur negativen Beurteilung eines Gegenstandes ist jedoch eine diesem Negativen entgegengesetzte Position, d.h. der Satiriker muss sich an einer positiven Norm orientieren, um das Negative konstatieren und darstellen zu können. Diese positive Norm kann einem Idealbild oder einer Utopie entsprechen und wird in den seltensten Fällen in der Satire zur konkreten Darstellung gelangen - sie ist jedoch ein aus der Negativität ableitbarer impliziter Bestandteil der Satire. Diese Normbindung bezeichnet das soziale Element der Satire, denn die Norm muss vom Zielpublikum, also einer bestimmten Gruppe innerhalb einer Gesellschaft, geteilt oder zumindest verstanden werden, wenn die vorgebrachte Kritik als solche erkannt werden soll.
Das wichtigste ästhetische Merkmal der Satire ist die Ironie. Sie verleiht der Satire ihre einmalige Gestalt, indem sie den kritisierten Gegenstand absichtlich in ein positives Licht rückt, durch Verfremdung, Übertreibung, Parodie, Metaphern, Wortspiele usw. jedoch diese positive Darstellung gleichzeitig als fadenscheinig und trügerische entlarvt und dadurch den Gegenstand selbst wieder negiert. Aus dem Gegensatz zwischen der konkret dargestellten Verherrlichung und der dennoch evozierten Negativität des Gegenstandes ergibt sich der komische Effekt, der den Gegenstand der Lächerlichkeit preisgibt und auf diese Weise weitaus wirksamer bestraft, als dies eine unumwundene Kritik könnte, da eine solche Kritik, den Gegenstand ernst nehmend, ihn immer auch aufwerten müsste. Die Parodie ist deswegen ein beliebtes Hilfsmittel der ironisierenden Darstellung, weil sie durch die Nachahmung konventioneller Gebrauchsformen (z.B. Brief, Lobrede, Festschrift, Expertise) den Kontrast zwischen äußerer Darstellung und tatsächlicher Aussage am sinnfälligsten zum Ausdruck bringen kann. Zum anderen können solche Gebrauchsformen auch selbst zum Gegenstand des satirischen Angriffs werden und bieten sich als formaler Rahmen für eine Satire auf ebendiese Formen geradezu an.
Aus dem ästhetischen Element der Satire ergibt sich zwangsläufig eine Abgrenzung gegenüber der Meinungsäußerung sowie der Problemanalyse und - erörterung. Das bedeutet, dass die Satire niemals Anspruch auf Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit oder Angemessenheit erheben kann, denn sie hat fiktionalen Charakter. Dennoch tritt sie in ein besonderes Verhältnis zur Realität: ihre implizite, positive Norm ist immer ein Vorschlag zu einer veränderten Umgangsweise mit der Wirklichkeit, sei dies nun einfach eine veränderte Sichtweise oder gar die Umwälzung gesellschaftlicher Zustände. Sie befindet sich also bei der Wahl ihrer Gestaltungsmittel stets auf einer Gratwanderung zwischen Abstraktion und Realismus, Allgemeingültigkeit und Aktualität. Je realistischer, konkreter der dargestellte Gegenstand ist, je aktueller und erkennbarer die dargestellte Situation, desto größer wird die kontextuelle Befangenheit des Satirikers und damit die Wahrscheinlichkeit sein, dass seine Satire eine geringe künstlerische und dafür umso größere polemisierende Qualität entfaltet. Damit wird sie kurzfristig die Gemüter erhitzen, langfristig jedoch in Vergessenheit geraten (z.B. Delius’ “Unsere Siemens-Welt Eine Festschrift zum 125jährigen Bestehen des Hauses S.“) Eine hochgradig abstrakte Satire, die anstelle des empirischen Opfers ein Substitut angreift (Fabeln), anstelle der konkreten Situation allgemein menschliche oder gesellschaftliche Unzulänglichkeiten, läuft Gefahr, Belanglosigkeit oder den Verlust der Identifizierbarkeit des Szenarios zu riskieren. Solche Satiren entfalten ihre Wirkung langfristig, arbeiten mühsam an der Mentalität ihrer Zielgruppe, ohne dass im wirklichen Leben schnelle Konsequenzen zu erwarten wären - dafür haben sie die Kraft, weit über ihren Entstehungskontext hinaus ihr Publikum zu finden, spätere Generationen zu affizieren, in die Geschichte einzugehen (z.B. Swifts “Gulliver’s Travels“, Orwells “1984“). Solche Satiren werden kaum zu juristischen Streitigkeiten führen, da ihre Aggression sich zugunsten der Ästhetik gedämpft zum Ausdruck bringt und von einzelnen Personen des realen Lebens wahrscheinlich niemals als diskreditierend empfunden werden wird. Doch auch bei einem Streitfall um eine realistischere Satire darf niemals das empirische Opfer des Satirikers, gegen das sich dessen Aggression tatsächlich richtet, mit dem dargestellten Opfer verwechselt werden, wie auch eine eventuelle erzählende Instanz, ein literarisches “Ich“, nicht mit dem Autor identisch ist. Zumindest muss berücksichtigt werden, dass die bloße Aggression nicht das letzte Ziel des Satirikers ist, sondern dass einerseits die soziale Komponente noch eine Rolle spielt und andererseits die ästhetische Form keine Maske, sondern Bedingung der Satire ist. Eine Beschränkung der Problematik auf den Konflikt zwischen der Ehre des Individuums und der Freiheit der Kunst greift zu kurz, da sie weder den konstitutiven Zusammenhang zwischen dem aggressiven und dem ästhetischen Element berücksichtigen kann, noch der Bedeutung der normativen Wertsetzung der Satire gerecht wird.
[...]
1 Wedel, 10.
2 Quintilians berühmte Doktrin “satura tota nostra est“ arbeitete der lange Zeit gültigen Einengung des Satirebegriffs auf die römischen Verssatiren, wie sie Horaz, Persius und Iuvenal verfassten, vor ( Quintilian, Institutio oratoria, X 1, 93, zitiert nach Wenzelburger, 408).
3 Brummack, Zu Begriff und Theorie der Satire, 282.
4 Ebd.
- Arbeit zitieren
- Daniel Reichelt (Autor:in), 2001, Was darf die Satire?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8721
Kostenlos Autor werden

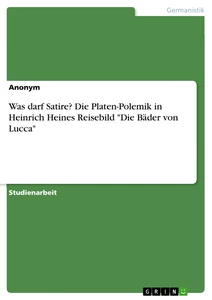




















Kommentare