Leseprobe
Inhalt
Prolog
1. Was heißt Strategie heute?
1.1 Hidden Champions
1.2 Value-to-Customer
2. Eignerstrategie
2.1 Warum eine Eignerstrategie ?
2.2 Vorteile der Eignerstrategie
2.3 Entwicklungsgrundsätze einer Eignerstrategie
2.4 Inhalte einer Eignerstrategie
2.4.1 Leitidee
2.4.2 Nutzenpotentiale und Wertschöpfungskonzept
2.4.3 Ergebnisorientierung
2.4.4 Führungsmäßige Einflußnahme
2.4.5 Führungsziele und Führungsleistung
2.4.6 Finanzierung
2.4.7 Risikopolitik
2.4.8 Steuerpolitik
2.4.9 Strategische Erfolgspositionen (SEP)
2.5 Die Entwicklung einer Eignerstrategie in der Praxis
3. Konflikte
3.1 Konfliktursachen
3.2 Strategien zur Konfliktbewältigung
3.2.1 Komplexität lösen
3.2.2 Komplexität beherrschen
3.3 Der Beirat
4. Management des Nachfolgeprozesses
4.1 Nachfolgefallen
4.2 Die Sicht des Seniors
4.3 Die Sicht des Juniors
4.4 Integriertes Nachfolgekonzept
4.4.1 Überlegungen zur Nachfolge im Familienunternehmen
4.4.2 Inhalte eines Nachfolgekonzeptes
5. Recht und Steuern im Familienunternehmen
5.1 Rechtliche Optimierung der Unternehmensnachfolge
5.1.1 Ziele der rechtlichen Optimierung
5.1.2 Grundlagen für Nachfolgeregelungen
5.1.2.1 Vorweggenommene Erbfolgeregelungen
5.1.2.2 Nachfolgeregelungen von Todes wegen
5.1.2.3 Ehevertrag
5.1.2.4 Gesellschaftsvertragliche Regelungen
5.1.3 Hinweise zur Gestaltung von Unternehmererbfolgen
5.1.3.1 Letzwillige Verfügung als Teil des Nachfolgekonzeptes
5.1.3.2 Übergehen des Ehegatten
5.1.3.3 Überspringen einer Generation
5.1.3.4 Erbvertrag versus Testament
5.1.3.5 Anordnung der Testamentsvollstreckung
5.1.3.6 Vorausvermächtnis versus Teilungsanordnung
5.1.3.7 Vermeidung der Sonderbetriebs- und Betriebsaufspaltungsfalle
5.2 Steuerliche Optimierung der Unternehmensnachfolge
5.2.1 Ziele der steuerlichen Optimierung der Unternehmensnachfolge
5.2.2 Vermeidung der steuerlichen Realisierung stiller Reserven
5.2.2.1 Stille Reserven und letztwillige Verfügungen
5.2.2.2 Stille Reserven und vorweggenommene Erbfolge
5.2.3 Erbschaftsteuerliche Ausgestaltung
5.2.3.1 Grundlagen der Erbschaftsteuer
5.2.3.2 Steuerklassen und Steuersätze
5.2.3.3 Freibeträge
5.2.3.4 Bewertung des steuerpflichtigen Vermögens
5.2.3.5 Vermögensstrukturierung unter erbschaftsteuerlichen Aspekten
5.2.3.6 Erbschaftsteuerliche Vorteile der vorweggenommenen Erbfolge
5.2.3.7 Erbschaftsteuerliche Überlegungen von Ehepaaren
5.2.4 Stiftungen
5.3 Der richtige Gesellschaftsvertrag
5.3.1 Bedeutung des Gesellschaftsvertrages
5.3.2 Spezifische Probleme in Gesellschaftsverträgen von Familiengesell-schaften
5.3.2.1 Unternehmensleitung durch Familienmitglieder
5.3.2.2 Die Kontrolle der Geschäftsführung
5.3.2.3 Interessengegensätze und ihre Lösung
5.3.2.4 Abfindungen an ausscheidende Gesellschafter
5.3.2.5 Erhaltung des Familiencharakters
5.3.2.6 Testamentsvollstreckung
5.3.2.7 Zulassung von Mehrheitsentscheidungen
5.4 Die Rechtsform eines Familienunternehmens
5.4.1 Denkbare Rechtsformen
5.4.2 Kriterien der Rechtsformwahl
5.4.2.1 Personenhandelsgesellschaften, insbesondere die GmbH & Co. KG
5.4.2.2 Die GmbH
5.4.2.3 Die Aktiengesellschaft
5.4.2.4 Die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)
6 Führung und Organisation
6.1 Führung im Umbruch
6.2 Motivation durch Führung
6.3 Der Unternehmer im Spannungsfeld zwischen offener und geschlossener Gesellschaft
6.4 Veränderungsmanagement
7 Vermögen
7.1 Von Vermögensanalyse zu Vermögensplanung
7.2 Optimale Vermögensstruktur
8. Die Zukunft des Familienunternehmens
9. Entwicklung eines Fahrplans
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Abbildungen , Beispiele und Tabellen
Anlage 1 10 Erfolgsfaktoren im Familienunternehmen
Anlage 2 Das Unternehmen Brita
Anlage 3 Umsetzung ethischer Grunsätze in das Führungs-konzept eines Familienunternehmens am Beispiel Underberg
1 Einleitung
2 Das Führungskonzept im Hause Underberg
3 „Aktuell“
Anlage 4 Vermögensübersicht
Anlage 5 Vermögensanalyse
Anlage 6 Rendite verschiedener Asset-Klassen
Anlage 7 Finanzierungsprogramme
Anlage 8 Fallbeispiele
8.1 Verkauf eines Einzelunternehmens gegen Einmalzahlung
8.2 Übertragung gegen Rente, Raten oder dauernde Last
8.3 Unternehmensnachfolge im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge
8.4 Schrittweise Übertragung eines Gewerbebetriebes durch Gründung einer Personen- oder Kapitalgesellschaft
8.5 Übertragung der Geschäftführung auf einen Manager
8.6 Die Gründung einer Aktiengesellschaft
8.7 Der Verkauf an Dritte
8.8 Übernahme durch das Management
8.9 Der Gang an die Börse
8.10 Unternehmensporträt: Die Steilmann-Gruppe
Anlage 9 Wichtige Kontakte
Prolog
Das Familienunternehmen – fürwahr ein schillernder Untersuchungsgegenstand. Bis vor kurzem noch schamhaft hinter dem eher quantitativen Begriff des Mittelstandes versteckt, nimmt das – vor allem öffentliche – Interesse am Familienunternehmen seit kurzem spürbar – fast möchte man sagen sprunghaft – zu.
Was also hat es auf sich mit Familienunternehmen? Warum erhalten so viele unserer erfolgreichsten Unternehmen Ihre Prägung, ihr Gesicht und ihre Kultur von einer oder mehreren Familien – und das nicht nur im handwerks- oder kleingewerblichen Bereich. Drei Viertel der von Simon[1] untersuchten Hidden Champions, der heimlichen Weltmarktführer, befinden sich im Familienbesitz. Brita[2], Dräger, Dragoco, Stiehl oder Windhoff seien an dieser Stelle exemplarisch genannt. Aber auch unter den Großunternehmen finden sich überraschend viele, die oft seit vielen Generationen von Familien geprägt werden. In Deutschland haben Namen wie Haniel, Röchling, Quandt, Oetker, Tengelmann, C&A, Werhahn, Heraeus, Miele oder Vorwerk einen besonderern Klang.
Andererseits schaffen nur zwei Drittel der Familienunternehmen den Sprung von der ersten in die zweite, nur noch ein Drittel den Sprung in die Dritte und sogar nur noch ein Sechstel den Sprung in die vierte Generation, wie das Bonner Institut für Mittelstandsforschung ermittelt hat.
Das Auf und Ab von Familienunternehmen hat als offenkundiges Phänomen sogar den Volksmund erreicht – und das weltweit. „Die erste Generation erstellt’s, die zweite erhält’s, in der dritten zerfällt’s“, heißt es in Deutschland, „Shirt sleeves to shirt sleeves in three generations“ sagt der Amerikaner.
Die Chroniken vieler Familienunternehmen erinnern an die von May[3] erfundene Geschichte der Familie Max Müller, die als Einführung in die Thematik an dieser Stelle eingefügt ist.
Max Müller ist der klassische Pionier. Eines Tages, in der Mitte seines Lebens, geht der begnadete Verkäufer zu seinem Chef und sagt: „Herr Oberberg, ich mache mich selbständig!“ Max Müller hat den richtigen Riecher. Er sieht frühzeitig den unaufhaltsamen Aufstieg des discountierenden Lebensmitteleinzelhandels voraus, aber auch dessen Schwierigkeiten, von den etablierten Markenherstellern ausreichend mit Ware versorgt zu werden. Und so beschließt Max Müller, ein verläßlicher Partner der jungen Discounthändler zu werden. Er kratzt all seine Ersparnisse zusammen, beleiht das Einfamilienhaus und das Erbe seiner Ehefrau, kauft zwei Maschinen und beginnt, in einem an das Haus angrenzenden Schuppen mit der Produktion von Apfel- und Orangensäften.
Das kleine Unternehmen ist ein Familienunternehmen im wahrste Sinne des Wortes: Max‘ Frau Luise sitzt auf der Kasse, sein Sohn, Max jun., kauft ein, Moritz betreut das Lager und Max sen. verkauft. Und weil Max ein begnadeter Verkäufer ist, wächst der Umsatz rasch und stetig. Bald werden erste Mitarbeiter eingestellt, aber immer noch wird in erster Linie improvisiert. Erst spät, und nur aufgrund des dauerhaften Drängens des mit Max befreundeten Steuerberaters Klaus Weitsicht entsteht so etwas wie eine Betriebsorganisation. Zwischen Chef und Mitarbeiter werden Abteilungsleiterstellen eingerichtet, und auch Max‘ Söhne dürfen fortan den Titel ‚Abteilungsleiter‘ führen. Aber auch jetzt gibt es noch keine Organigramme, keine Stellenbeschreibungen oder Handbücher und auch keine Stäbe. Dafür kennt Max alle seine Mitarbeiter mit Vornamen, von den meisten sogar den Geburtstag. Zum Geburtstag gibt es Blumen, zur Silberhochzeit gibt sich der Chef höchstpersönlich die Ehre. Als Chef ist Max der typische Patriarch. Sein Wort ist Gesetz, Widerworte gibt es nicht. Sein Führungsstil ist direkt, bis hin zur körperlichen Züchtigung, und intuitiv.
Max traut seinem Bauch mehr als dem Kopf, achtet nur „gestandene Praktiker“ und schimpft auf „studierte Theoretiker“, er liebt das Detail und macht am liebsten alles selbst. Selbstverständlich besucht er die Kunden persönlich, mit den meisten ist er befreundet. Jeden Nachmittag um fünf weiß er den Umsatz des Tages und die aktuellen Kontostände.
Als Max schließlich 63-jährig an den Folgen eines Herzinfarktes stirbt, hinterläßt er ein Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 100 Mio DM, mit etwa 100 Mitarbeitern, mit viel Drive, aber wenig Ordnung. Er hat viel erreicht, aber auch manches verpaßt. Das Unternehmen macht Gewinn, hat aufgrund expansiver Investitionspolitik aber dennoch kaum Eigenkapital. Bei seinem Tode ist Max vollhaftender Einzelkaufmann; ein Testament oder eine Bestimmung, wer die Nachfolge im Unternehmen antreten soll, existiert nicht.
Zum Glück sind sich die beiden Söhne, Max jun. und Moritz, rasch einig. Unter fachkundiger Beratung von Steuerberater Weitsicht zahlen sie die Mutter aus, wandeln das Unternehmen in eine GmbH & Co. KG um und schließen einen ausführlichen Gesellschaftervertrag mit zwei Stämmen, denen jeweils gleiche Anteile und gleiche Rechte zustehen. Dazu gehört auch das Recht, jeweils den eigenen Nachfolger als Geschäftsführer präsentieren zu dürfen.
Max jun. und Moritz haben Glück. Sie haben unterschiedliche Begabungen und eine friedfertige Natur. Max jun. übernimmt den Verkauf und Moritz die Technik. Sie vertragen sich gut, bis auf manchmal, aber dann, da sind sich Max und Moritz einig, sind fast immer ihre Frauen schuld.
Im übrigen starten sie durch. Denn Max und Moritz haben längst erkannt, daß sie das vom Vater begründete Nutzenpotential, leistungsfähiger und verläßlicher Discountlieferant zu sein, ausbauen und ausnutzen können. Bald stellen sie nicht nur Saft, sondern auch Marmelade, Butter, Eier, Milch und Käse her. Später kommen noch Bier, Kaffee und Schnaps dazu. Max jun. und Moritz gelten als die aggressivsten Anbieter und die unumstrittenen Kostenführer im Markt. Sie beliefern ALDI, Lidl, Penny, Norma, Plus und die anderen Discounter. Sie verkaufen in Deutschland, aber auch in Holland, Belgien, Frankreich, Österreich und Großbritanien. Fünfzehn Jahre nach der Übernahme hat der Umsatz eine Mrd. DM erreicht, die Zahl der Mitarbeiter ist auf über 1.000 angestiegen.
Das gesamte Unternehmen ist von einem ausgeprägten Expansionsstreben erfaßt. Es gibt eine klare Identifikation nach dem Motto: „Max und Moritz gegen den Rest der Welt“, oder: „Wo wir sind, ist vorne.“ Die Kontakte zu den wichtigsten Kunden werden immer noch persönlich gepflegt. Dennoch läßt sich die allmähliche Delegation von Verantwortung in dem größer gewordenen Unternehmen nicht mehr vermeiden. Nach und nach entstehen kleine Stäbe. Auch will man Stellenbeschreibungen und ein Unternehmenshandbuch erstellen, findet dafür aber glücklicherweise keine Zeit.
Neben Max jun. und Moritz gibt es inzwischen auch einen Finanzprokuristen. Der ist nicht nur für die Zahlen, sondern nach Ansicht von Max und Moritz auch sonst für alles verantwortlich, was im Unternehmen nicht funktioniert. Beide Brüder halten Emil Vorsicht für einen engstirnigen Bürokraten und einen rückgratlosen Intriganten, feuern wollen sie ihn trotzdem nicht. Immer wenn Max jun. von Entlassung spricht, ist Moritz dagegen und umgekehrt.
Alle im Unternehmen arbeiten viel und schlafen wenig. Und so kommt es wie es kommen muß: Max jun. verliert die Übersicht und Moritz bekommt eine Gelbsucht. Kurz nach dieser Erkrankung gibt es den ersten ernsthaften Streit zwischen den Brüdern. Moritz, der nur eine Tochter hat, will seinen Schwiegersohn, einen Juristen, als Nachfolger präsentieren. Max jun., der von seinem Vater die Abneigung gegen „studierte Theoretiker“ übernommen hat, ist dagegen. Es kommt zu einem Schiedsverfahren. Als Resultat wird ein Beirat eingerichtet, der Schwiegersohn wird akzeptiert, weil gleichzeitig der einzige Sohn von Max jun., der im übrigen fünf Töchter hat, ein mittelmäßiger Versicherungsmakler, zum Finanzchef des Unternehmens berufen wird.
Schon wenig später bereut Max jun. seine Entscheidung. Nicht nur, daß sein Sohn Edzard nicht reüssiert. Auch das bis dahin gute Verhältnis zwischen seiner Frau und seiner Schwiegertochter artet nach dem Generationswechsel rasch in einen privaten Kleinkrieg aus. Jeden Abend beschwert sich Frau Müller sen. bei ihrem Mann über das angeblich unmögliche, anmaßende und auftrumpfende Auftreten der jungen Frau Müller, die alles in den Dreck trete, wofür die alten Müllers so lange gekämpft hätten und vor allem den nötigen Respekt vor ihr, der Seniorin, vermissen lasse. Max jun. ist unglücklich. Aber noch bevor er sich auf Drängen seiner Frau dazu entschließen kann, seinen Sohn samt Familie zu enterben und aus dem Familienunternehmen zu verbannen, verstirbt er 70-jährig nur wenige Wochen vor seinem Bruder Moritz.
Damit sind wir bei der dritten Generation. Das Unternehmen hat wiederum zwei Geschäftsführer, dafür aber sieben Gesellschafter, von denen nur einer tätig ist. Von den sechs nicht tätigen Töchtern sind vier verheiratet, und zwar mit Lehrern, Künstlern oder ähnlich problematischen Menschen. Die beiden anderen bleiben unverheiratet und genießen ihren Status als „Erbtanten“. In dem nach dem Stammesprinzip paritätisch besetzten Beirat sitzen ein Rechtsanwalt, der Sohn von Steuerberater Weitsicht, sowie die Ehefrau und ein Jagdfreund des Juristen. Der Beirat tagt dreimal im Jahr, in der Regel ohne die Geschäftsführung. Dabei beschäftigt er sich mit so grundsätzlichen Fragen wie einer Tanksatzung für die Betriebstankstelle, einem Beratungsvertrag als Personalentwickler für den mit der ältesten Tochter verheirateten Lehrer und mit dem Problem, ob Aufwendungen für einen Jagdausflug mit Kunden steuerlich absetzbar sind. Dessen ungeachtet verdient das Unternehmen stabil, zumindest in den ersten Jahren. Es besitzt eine prall gefüllte Kasse, glänzende Bilanzen und eine geringe Investitionsneigung, weshalb es von den Banken hoch geschätzt wird. Auch in der Öffentlichkeit genießen die Müllers hohes Ansehen, vor allem weil sie ihr öffentliches Engagement in dem Maße verstärken, in dem sie den Einsatz für das Unternehmen reduzieren. So ist der Jurist, Dr. von Scharenberg, Präsident der IHK und Vorsitzender des regionalen Unternehmerverbandes. Der ehemalige Versicherungsmakler Edzard Müller kauft sich einen Doktortitel, wird Konsul von Togo und Mitglied im Beirat der Allianz und der Deutschen Bank.
Dafür stagniert der Umsatz. Das Unternehmen hat kaum noch neue Produkte; seit Jahren ist es nicht mehr in neue Märkte eingestiegen. Überall wird optimiert, reorganisiert und restrukturiert, es gibt Handbücher, Stellenbeschreibungen, Arbeitsanweisungen, ein umfangreiches Reporting und ein noch umfassenderes Planungsinstrumentarium. Es gibt viel Papier, noch mehr Kommitees und Ausschüsse, jede Menge Strategien, aber wenig Umsetzung, ein ausgeprägtes Kästchendenken und bald Machtkämpfe auf allen Ebenen. Auch Dr. von Scharenberg und Edzard Müller bleiben davon nicht verschont. Frau Dr. von Scharenberg hat nie verstanden, warum ihr Mann, den sie für eindeutig besser qualifiziert hält, nicht eine herausgehobene Stellung und mehr Geld erhält als ihr Vetter Edzard Müller. Jeden Abend weist sie ihren Mann auf diese Ungerechtigkeit hin, bis Herr Dr. von Scharenberg es schließlich selbst glaubt. Frau Müller ist selbstverständlich ganz anderer Ansicht, weil ihrem Mann als „Müller“ ein natürliches Vorrecht gegenüber einem eingeheirateten Schwiegersohn gebühre. Als Frau von Scharenberg wieder einmal auf den Betriebsgärtner warten muß, weil dieser zuvor den Rasen bei Müllers mäht, kommt es zur offenen Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen, in die zunächst beide Ehemänner und schließlich alle Gesellschafter hineingezogen werden. In der Folge streitet man um die Abberufung von Dr. von Scharenberg und Edzard Müller, um die Höhe der Ausschüttungen, um Einsichts- und Informationsrechte der nicht tätigen Gesellschafter und ihrer Ehegatten, sowie um das Recht einzelner Gesellschafter, ihre Gesellschaftsanteile an ein Konkurrenzunternehmen zu verkaufen.
Kurz nach dem Tod Dr. von Scharenbergs kommt das Aus für die Müllers. Das Unternehmen sieht sich zunehmend in Preiskämpfe und Verdrängungswettbewerb verstrickt und zu stetigen Preisnachlässen gezwungen. Qualifizierte Führungskräfte und Mitarbeiter wandern ab. Das verbleibende Management ist überaltert und kämpft weniger mit dem Wettbewerb, als um das eigene Überleben. Der Umsatz geht zurück, zunächst wird das Jahresergebnis, dann auch der Cash-flow negativ. Kurz vor dem Konkurs betreibt der Banker im Beirat den Verkauf des Unternehmens an den großen internationalen Wettbewerber Nestchen. So retten die Müllers zwar nicht ihr Unternehmen, aber zumindest den Rest ihres Vermögens.
Beispiel 1 : Aufstieg und Fall der Familie Max Müller [4]
Beim Studium der Geschichte von Max Müller stellen sich unvermutet Fragen wie: „Warum haben sie denn nicht ?“ oder „Hätten sie doch einfach ...“ z.B. ein Testament gemacht, einen anderen Gesellschaftervertrag vereinbart, einen professionelleren Beirat gewählt usw.
Damit sind wir auch schon bei den Kernfragen der Unternehmensentwicklung angelangt, die im folgenden näher beleuchtet werden sollen.
1. Was heißt Strategie heute?
1.1 Hidden Champions
„Strategie ist die Kunst und die Wissenschaft, alle Kräfte eines Unternehmens so zu entwickeln und einzusetzen, daß ein möglichst profitables, langfristiges Überleben gesichert ist.“[5]
Dieser Grundsatz gewinnt in unserer Zeit zunehmend an Bedeutung. Die „Bauchsteuerung“ eines Max Müller sen. ist langsam am Aussterben und seine Sichtweise der Dinge stellt heute in aller Regel eher einen unternehmerischen Nachteil dar. Spätestens wenn ein Unternehmen seine Gründerphase hinter sich gebracht hat, ist der Unternehmer gezwungen, sich strategische Gedanken zu machen, also die Unternehmenssteuerung vom Bauch auf den Kopf zu verlagern. Strategien sind dabei nicht nur für das Management des operativen Geschäfts wichtig, sondern eben auch für die Garantie des Fortbestehens eines Unternehmens über mehrere Generationen hinweg.
Strategie bedeutet, sich zwei Fragen zu beantworten, nämlich „wo?“ und „wie?“. Wo wollen wir konkurrieren? Wie wollen wir konkurrieren? Wo soll das Unternehmen in der nächsten Generation stehen? Wie kann ich das Unternehmen in die nächste Generation führen? Die Hidden Champions haben sich diese Fragen frühzeitig gestellt und beantwortet. Durch konsequentes Verfolgen der Antworten haben sie Ihren Status erreicht. Was genau zeichnet einen Hidden Champion aber nun aus?
1. Nr. 1 oder Nr. 2 im Weltmarkt oder Nr. 1 im europäischen Markt
2. Nicht mehr als 1,5 Mrd. Umsatz (bis auf wenige Ausnahmen)
3. Niedriger Bekanntheitsgrad
Beispiele für Hidden Champions sind HAUNI (Zigarettenmaschinen), WEBASTO (Schiebedächer, Standheizungen), BAADER (Fischfiletiermaschinen), BRITA (Wasserfilter)[6], TETRA (Zierfischfutter), WÜRTH (Schrauben etc.) oder SAT (Straßenfräsen).
Das Erfolgsrezept der Hidden Champion resultiert aus einer eindeutigen Zielsetzung und der konsequenten Verfolgung dieser Ziele.
I. Unser Ziel ist, die Nr. 1 zu werden und zu bleiben
II. Wir wollen in unserem Markt weltweit die Besten sein
III. Marktführer, sonst nichts
IV. Wir verteidigen unsere führende Position mit allen Mitteln
V. Bei den 30 TOP-Unternehmen der Welt wollen wir Lieferant sein
VI. Wir bestimmen die Spielregeln
VII. Wir wollen der psychologische Marktführer sein
Die Hidden Champions streben Marktführerschaft an, sonst nichts. Sie verfolgen das klare Ziel, in Ihren Märkten/Segmenten die Nr. 1 in der Welt zu sein/zu werden und verteidigen diese einmal errungene Position mit aller Vehemenz.
Um das zu erreichen, konkurrieren diese Unternehmen nicht in der Breite (Diversifikation) sondern in der Tiefe (Segmentierung).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 : Fokussierte Strategie – Tiefe statt Breite – Das Beispiel Winterhalter [7]
Diese Strategie impliziert die Konzentration des Unternehmens auf seine Kernkompetenzen. Hidden Champions zeichnen sich insbesondere dadurch aus, daß es ihnen gelungen ist, eine Nische zu entdecken und zu füllen. Die mit den Jahren entwickelte Kompetenz in den Nischenlösungen ist der große Wettbewerbsvorteil. Wenn diese Nischen verlassen werden, nützt die erworbene Kompetenz nichts mehr und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Mißerfolg. Die Beachtung dieses Grundsatzes erlaubt den Hidden Champions das Überleben im Weltmarkt und die erfolgreiche Verteidigung ihres Segmentes auch gegen die Angriffe wesentlich größerer Unternehmen, die versuchen, nachträglich den eigenen Markt aufzuzrollen. Marktdefinition wird nicht als extern vorgegeben verstanden, sondern ist Teil der eigenen Strategie. Märkte werden eng definiert und beziehen dabei Kundenbedürfnis und Technologie ein.
Weiteres herausragendes Kennzeichen der Hidden Champions ist ihre globale Präsenz in den Zielmärkten. In den USA sind 97,4% aller Hidden Champions vertreten, in Frankreich 76,9 % und in Großbritannien 66,7%. Auch sonst findet man sie überall dort, wo ihre Produkte benötigt werden, und zwar immer als erste. Vor allem die Präsenz auf dem US-Markt ist ein großer Vorteil gegenüber der Konkurrenz, weil dieser von den deutschen Unternehmen im allgemeinen geradezu vergessen wurde. Am deutlichsten zeigt sich dies an den Export-Zahlen. Obwohl Deutschland ein sehr stark exportorientiertes Land ist, gehen nur 7,5% aller nationalen Exporte in die USA, dagegen 57,1% in die Mitgliedsländer der EU. Noch deutlicher wird das Problem, wenn man sich den Anteil deutscher Exporte an den Inlandsmärkten der Importländer anschaut. Hier können wir in den USA nur unbedeutende 0,37%, in Japan 0,34% und in Frankreich immerhin 3,5% verzeichnen.[8] Den Löwenanteil dieses so geringen globalen Geschäftes geht dabei an die Hidden Champions, was die Bedeutung für den unternehmerischen Gesamterfolg noch zusätzlich unterstreicht. Der deutsche Michel hat es bis jetzt noch nicht geschafft, über den Tellerrand des europäischen Kontinents hinaus zu sehen. Beispielhaft sei der Internationalisierungsprozeß von KÄRCHER dargestellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1 : Internationalisierung von KÄRCHER [9]
Wer allerdings in den US-Markt einsteigen will, muß sich sorgfältig darauf vorbereiten. Vor allen Dingen muß beachtet werden, daß der amerikanische Kunde mit dem europäischen nicht zu vergleichen ist. Die Anforderungen und Bedürfnisse an die Produkte sind extrem anders und daher birgt dieser Markt ein erhebliches Risikopotential. Als Beispiel sei hier auf den schon seit Jahren vergeblichen Versuch von AUDI verwiesen, am amerikanischen Markt Fuß zu fassen. Es gelang nicht, mehr als 20.000 Fahrzeuge p.a. abzusetzen, was in Anbetracht der Größe des amerikanischen Kfz-Marktes geradezu lächerlich gering ist. Dann passierte ein Unglück: Eine ältere Dame überfuhr mit ihrem Audi ein kleines Mädchen, weil sie beim Versuch zu bremsen das Bremspedal verfehlte. Daraufhin ging die Zahl der abgesetzten Fahrzeuge schlagartig auf 9.000 Stück p.a. zurück. Der für den Export zuständige Manager der Zentrale begab sich persönlich in die USA, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Er hatte keinen Erfolg. Zwar hat Audi erkannt, daß der amerikanische Autofahrer das Automatikgetriebe liebt, jedoch übersehen, daß amerikanische Autos zusätzlich über anders geartete Gas- und Bremspedale verfügen, als in Europa üblich. Man hat in den Export-Fahrzeugen einfach das Kupplungspedal weggelassen, so wie auch in bei uns erhältlichen Wagen mit Automatikgetriebe. Die amerikanische Autoindustrie verwöhnt ihr Klientel dagegen mit Pedalen, wie man sie hierzulande nur in LKW’s findet, wobei insbesondere das Bremspedal sehr groß und vor allen Dingen breit ausfällt. Das war auch die Ursache für den oben beschriebenen Unfall. Meines Wissens hat sich AUDI bis heute nicht erfolgreich im US-Markt plazieren können.[10]
Die Hidden Champions haben erkannt, daß man die Bedürfnisse eines geographisch oder kulturell bedingten Marktsegments eben nicht einfach auf andere Segmente übertragen kann, sondern jedes Segment individuell ausleuchten muß. Es zeigt sich auch schon, daß eine einfache Marktsegmentierung nach nur einem Kriterium – also Geographie oder Produkt oder Kulturkreis oder gesetzliche Rahmenbedingungen – allein nicht ausreichend ist. Erst die Kombination aller Bedingungen und die individuelle Betreuung aller entstehenden Segmente bezüglich ihrer besonderen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen führen letztendlich zum Erfolg. Diese Segmentierung zunächst einmal zu erkennen ist sicherlich sehr mühsam, aber der Erfolg gehört am Ende dem, der den Markt am besten kennt.
Erleichtern kann dies die Rekrutierung eines internationalen Managements, d.h. wenn man beispielsweise Produkte in Kanada verkaufen will, ist dazu ein Kanadier am ehesten geeignet.
Die Hidden Champions kombinieren ihre Spezialisierung in Produkt und know-how mit weltweiter Vermarktung. Sie sind in wichtigen Zielmärkten mit eigenen Tochtergesellschaften präsent und delegieren die Beziehung zu Kunden nicht an Dritte. So erreichen sie trotz ihrer Nischenmärkte „Economies of Scale“ und verhindern das entstehen neuer Konkurrenten in fremden Märkten.
Die Hidden Champions verstehen es besonders, ihre Kundennähe als herausragenden Wettbewerbsvorteil einzusetzen. Zum Vergleich:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 : Marktprofessionalität und Kundennähe [11]
Das heißt, daß sie immer dahingehen, wo ihre Top-Kunden auch hingehen, denn nur der kann (Welt-)Marktführer werden oder bleiben, der Lieferant der globalen Top-Kunden ist. Dabei sind die anspruchsvollsten Kunden vor allem in Deutschland, Japan, den USA und im übrigen Europa vertreten. Wer also Marktführer werden oder bleiben will, muß diese Märkte auf jeden Fall abdecken. Im Hinblick auf das starke Wachstum und die zunehmende Bedeutung des asiatischen Raumes wird auch hier ein Engagement mittelfristig nicht mehr zu umgehen sein. Auch wenn der asiatische Markt in jüngster Vergangenheit unter erheblichen Turbulenzen gelitten hat, sollte die momentane „Schwäche“ mehr als Chance denn als Risiko verstanden werden, um den Schritt nach Fernost zu wagen.
Der Verkaufserfolg leitet sich bei den erfolgreichen Unternehmen auch nicht von der Preisgestaltung ab. Viel wichtiger sind eine langfristige Kundenbindung und die Betonung der Leistungsfähigkeit des Produktes. Der Trend geht in Richtung Systemgeschäft, d.h. zunehmend gewinnen auch Dienstleistungen wie Serviceangebote im post-sales Bereich an Bedeutung bei den Kunden (Zusammenführung von Produkt und Dienstleistung). Nur wer sich diesen Veränderungen der Bedürfnisse stellt und sein Unternehmensangebot darauf ausrichtet, wird zukünftig am Markt bestehen können.
Die Hidden Champions haben eine sehr hohe Kundennähe, insbesondere zu ihren Top-Kunden. Die Kundennähe umfaßt alle Funktionen und Ebenen. Sie sind aber keine Marketing-Profis im Sinne von Lehrbüchern. Sie verkaufen ihre Waren über den Wert, nicht über den Preis, ohne jedoch ihre Kostenstruktur zu vernachlässigen.
Innovation ist die Voraussetzung für technologische Überlegenheit. Hier zeigen sich die Hidden Champions der Konkurrenz gegenüber als absolute Vorreiter. Die Anzahl der Patente pro 100 Mitarbeiter liegt in der Regel über 10[12]. Dabei beschränkt sich der Innovationsprozeß aber bei weitem nicht nur auf das Produkt, sondern auch auf die Gestaltung von Geschäftsprozessen, den Einstieg in neue Märkte, die globale Orientierung. Die Wünsche und Anregungen der Kunden werden nicht als lästig und unangenehm, sondern als Chance gesehen. Hidden Champions sind hochinnovativ. Innovationen sind das Fundament ihres langfristigen Erfolges, denn Stagnation bedeutet Rückschritt. Sie bleiben an der Spitze, weil sie kontinuierliche Innovation betreiben.
Eine weitere Besonderheit stellt die Orientierung der Unternehmen dar. Während große Unternehmen entweder technologisch orientiert sind, oder sich an den Bedürfnissen des Marktes ausrichten, gelingt den Hidden Champions der Spagat zwischen beiden Sichtweisen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3 : Markt- vs. technologische Orientierung [13]
Es werden zwei verschiedene Strategieansätze verfolgt: Externe Chancen, welche sich aus den Märkten, den Kunden und dem Wettbewerb ergeben einerseits, und interne Ressourcen, als da sind Kernkompetenzen, Fähigkeiten des Unternehmens und seiner Mitarbeiter und die Stärken des Unternehmens, andererseits. Die Kombination beider Ansätze ist einer der Erfolgsfaktoren der Hidden Champions und führt zu einer erfolgreichen Strategie. Durch gleichwertige Integration von Markt und Technik als Antriebskräfte erreichen sie die Synergie von internen Kompetenzen und externen Marktchancen.
Im strategischen Dreieck gelingt es den Hidden Champions, wichtig für ihre Kunden zu sein, dauerhaft von der Konkurrenz nur schwer einholbar zu bleiben und dies dem Kunden überzeugend zu vermitteln.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4 : Strategisches Dreieck [14]
Um die eigene Innovationsfähigkeit zu erhalten, wird die Nähe zur Konkurrenz ganz bewußt gesucht. Dabei dient ein scharfer Wettbewerb mit den Spitzenkonkurrenten immer der eigenen Leistungssteigerung. Wegen dieses Phänomens sind Orte wie das Silicon Valley entstanden, wo sich die globalen Spitzenkonkurrenten auf engstem Raum versammeln. Niemals sollte man einen Wettbewerber irgendwo auf der Welt (ungeplant) aus den Augen verlieren oder zur Ruhe kommen lassen. Dabei darf aber nicht vergessen werden, daß der Weg vom leistungssteigernden zum ruinösen Wettbewerb oft nur ein kleiner ist und man somit auch immer eine Gratwanderung vollzieht. Beispiele für in hartem Wettbewerb stehende Hidden Champions liefert folgende Tabelle:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2 : Hidden Champions im engen Wettbewerb [15]
Die Hidden Champions schaffen ausgeprägte Wettbewerbsvorteile bei Produktqualität und Service. Sie sind nahe an ihren besten Wettbewerbern und suchen die aktive Konkurrenz mit diesen. Sie verteidigen ihre Wettbewerbsposition verbissen und sofort.
Eine weitere Fragestellung der sich die Unternehmen heute stellen müssen, lautet „Make or buy?“. Dabei werden sehr unterschiedliche Wege beschritten. Einige Unternehmen schwören auf das Outsourcing und versuchen möglichst viele Teilleistungen auf Zulieferbetriebe zu verlagern, während andere möglichst alles im eigenen Unternehmen belassen. Letzteres kann soweit führen, daß sogar Produktionsmaschinen selbst entwickelt und hergestellt werden. Welcher Weg der richtige ist, muß letzlich jedes Unternehmen für sich entscheiden. Beides bietet Vor- und Nachteile. Die Hidden Champions vertrauen auf ihre eigenen Kräfte. Sie glauben nicht, daß andere ihre Probleme lösen. Um ihr know-how und ihre Kernkompetenzen zu schützen, mißtrauen sie Kooperationen und strategischen Allianzen. Sie gehen sie nur mit großer Vorsicht ein, wenn sie es alleine partout nicht schaffen (z.B. japanischer Markt).
Die Mitarbeitermotivation und - führung ist ein weiterer Pluspunkt gegenüber den Großunternehmen. Durch die Prägung als Familienunternehmen ist in der Regel eine sehr eigenwillige Unternehmenskultur vorhanden, die dazu führt, daß die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen sehr hoch ist, die Krankenstände meist unter 4% liegen und nur wenig Fluktuation zu beobachten ist. Die Hidden Champions haben stets „mehr Arbeit als Köpfe“ und selektieren im Frühstadium eines Arbeitsverhältnisses scharf. Universelle Einsetzbarkeit, Vorschlagsaktivitäten und Lernbereitschaft der Mitarbeiter sind vorbildlich.
In der Unternehmensleitung leben die Hidden Champions von Führerpersönlichkeiten. Die Amtszeit der Geschäftsführung liegt in der Regel deutlich über 30 Jahre[16], wodurch eine extrem hohe Kontinuität in der Geschäftsleitung erreicht wird. Die Führer leben die Einheit von Person und Aufgabe. Sie führen autoritär in den Grundwerten und partizipativ im Detail. Sie sind große Energieträger und Inspiratoren.
Als Fazit bleibt festzustellen, daß die Hidden Champions stets ihren eigenen Weg gehen. Dieser unterscheidet sich in aller Regel deutlich von dem, was die jeweils populären Management-Gurus predigen. Doch schließlich ist es noch niemandem gelungen, Vorteile zu erlangen, indem er es seinen Konkurrenten immer gleich gemacht hat.
1.2 Value-to-Customer
Der zunehmende Konkurrenzdruck in allen Branchen sowie die zunehmende Reife der Kunden zwingt die Unternehmen heute dazu, neue Sichtweisen zu entwickeln bzw. alte Werte wieder aufzugreifen. Die fetten Jahre des Nachkriegswirtschaftswunders, die es den Unternehmen erlaubten, praktisch alles zu verkaufen und darüber hinaus noch zu Preisen, die von der Verkäuferseite bestimmt wurden, sind ein für allemal vorbei. Das Geld sitzt nicht mehr so locker und das Bewußtsein für ein ordentliches Preis-/Leistungsverhältnis wächst bei den Kunden zunehmend. Dieser Umstand zwingt die Unternehmen heute immer mehr dazu, das zu produzieren und zu verkaufen, was der Kunde haben möchte, und nicht dem Kunden zu sagen, daß dieses oder jenes produziert wurde, weil der Kunde es angeblich braucht. Die Initiative ist letztendlich auf die andere Seite übergegangen.
Die Wissenschaft hat als neue Errungenschaft den Begriff des Value-to-Customer, den Kundennutzen, geprägt und als neue Erkenntnis gefeiert. Dabei ist der Gedanke der hinter dem Modebegriff steht wahrlich ein alter Hut. Schon seit Generationen kannte jeder Selbständige den Grundsatz: „Der Kunde ist König.“ Daran hat sich auch nie etwas geändert, nur hat man es in den fetten Jahren einfach verdrängt. Aufgabe der Unternehmen muß es sein, diese Erkenntnis wieder zu beleben und alle Mitarbeiter darauf einzuschwören. Wem dies am besten gelingt, der wird zukünftig der erfolgreichste Marktteilnehmer werden oder bleiben. Das gesamte Unternehmen, von der Unternehmensleitung bis zum Lagerarbeiter, muß den Gedanken verinnerlichen und ihn leben. Der Value-to-Customer steht am Beginn jeder unternehmerischen Entscheidung. Im Auge des Kunden ist er gar das einzig Entscheidende. Der Gedanke muß jede Person, Funktion und Handlung eines Unternehmens bestimmen und wird dann einen doppelten Hebeleffekt auf Menge und Preis nach sich ziehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5 : Magisches Dreieck [17]
Wenn der Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung erwirbt, dann tut er dies nicht um der Sache selbst willen, sondern er möchte ein Problem lösen. Um den Kundennutzen überhaupt erst zu ermitteln, muß ein Unternehmen also zunächst feststellen, welches Problem der Kunde tatsächlich hat. Das ist eine Aufgabe, die viel schwieriger ist, als man auf den ersten Blick zu glauben vermag. Davon auszugehen, daß der Kunde selbst genau weiß, was sein Problem ist, und daß man ihn nur danach fragen muß, ist ein Kardinalfehler.
Die Realität sieht oftmals ganz anders aus. Dabei liegt hier die Ursache der weit verbreiteten Unzufriedenheit des Verbrauchers. Der Kunde selbst sieht Probleme immer isoliert und aus der Situation heraus. Er sucht nach kurzfristigen Einzellösungen, welche dann aber im Zusammenspiel Inkompatibilitäten an den Tag legen und alle Bemühungen im Nachhinein wieder zunichte machen. Um einen langfristigen Kundennutzen zu generieren und eine Bindung an das eigene Unternehmen herbeizuführen, ist es erforderlich, im Rahmen eines pre-sale gemeinsam mit dem Kunden die gesamte Palette seiner Probleme zu beleuchten, um dann Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten, die langfristigen Bestand haben und erforderlichenfalls auch modifizierbar sind, um auf veränderte Umgebungsbedingungen reagieren zu können.
Die Modifizierbarkeit betrifft schon den post-sales Bereich, der ganz allgemein Wartungs- und Betreuungsleistungen umfaßt. Der Hebeleffekt ergibt sich dann daraus, daß einerseits durch größere Zufriedenheit die Menge der abgesetzten Produkte steigt und andererseits das Vorhandensein eines qualitativ hochwertigen Dienstleistungsumfeldes den Kunden dazu veranlaßt, höhere Preise zu akzeptieren.
Ein optimaler Kundennutzen kann also nur erreicht werden, wenn sich die Kundenbeziehung von dem den reinen Verkaufsakt eines Produktes oder einer Dienstleistung um Beratungsleistungen im Vorfeld und um Serviceleistungen im nachhinein erweitert. Wenn es gelingt, dem Kunden dann das Gefühl zu vermitteln, daß der Verkäufer ein langfristiges Interesse hat, seine eigenen Probleme aus der Welt zu schaffen, statt nur Umsatz zu machen, ist der unternehmerische Erfolg fast schon vorprogrammiert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3 : Kundendienst
Unsere Gesellschaft wandelt sich immer mehr zur Dienstleistungsgesellschaft. Dies bedeutet aber nicht, daß der klassische Wirtschaftszweig Dienstleistungsgewerbe stetig wächst und dagegen der Bereich produzierendes Gewerbe rückläufig ist. Die Konsequenz aus der obigen Erkenntnis ist, daß eben Dienstleistung nicht als eigenständiger Gewerbezweig verstanden werden darf, sondern integraler Bestandteil jeder unternehmerischen Tätigkeit werden muß. Nur im ständigen Kontakt und Austausch mit den Kunden kann realistisch abgeschätzt werden, was tatsächlich gebraucht wird und welche technischen Veränderungen gewünscht werden. Es ist kaum eine größere Geldverschwendung denkbar, als wenn die F&E-Abteilung technische Neuerungen entwickelt, die am Planungstisch revolutionär anmuten, die aber eigentlich keiner haben will.
Unsere Beispielfirma Müller hat es in der dritten Generation nicht mehr geschafft, diese Sichtweise zu erhalten. Die Energie des Unternehmens und der Mitarbeiter kehrte sich nach innen, aber der Erfolg spielt sich nun einmal außerhalb des Unternehmens ab. Innere Querelen sind der Dolchstoß für jede unternehmerische Tätigkeit und müssen stets im Keim erstickt werden. Die Verursacher müssen, ohne Rücksicht darauf, ob sie vielleicht aus der Unternehmerfamilie stammen, aus dem Unternehmen eliminiert werden, um die Überlebensfähigkeit nicht zu gefährden. Die Firma Müller ist letztendlich gescheitert, weil sie genau das nicht geschafft hat.
2. Eignerstrategie
2.1 Warum eine Eignerstrategie ?
Verschiedene empirische Untersuchungen haben gezeigt, daß Unternehmen, die ein langfristig ausgerichtetes, systematisches, strategisches Management betreiben letztendlich erfolgreicher sind als solche, die eher „ad hoc“ geführt werden. Diese Erkenntnis hat sich zunehmend in den Unternehmen durchgesetzt und man wird vor allem bei den größeren Unternehmen Mühe haben, eines zu finden, welches keine klare Strategie verfolgt.[18]
Bemerkenswert dabei ist jedoch, daß sich die Notwendigkeit der strategischen Planung bislang weitgehend auf die betriebswirtschaftliche Dimension beschränkt hat. Es werden Strategien für einzelne Geschäftseinheiten und eine Oberstrategie für das Gesamtunternehmen entwickelt. Der Eigner eines Unternehmens befindet sich hier aber in einem Dilemma, welches die meisten gar nicht erkennen. Zwar wurde eine zweckmäßige Strategie für das Unternehmen gefunden, die persönlichen oder familiären Belange des Eigners treten jedoch völlig in den Hintergrund und fließen in die Strategie nicht mit ein. Untersuchungen an der Universität St. Gallen haben gezeigt, daß eine Optimierung auf Unternehmensebene keinesfalls automatisch auch zu einer optimalen Lösung aus Sicht des Inhabers führen. Im Gegenteil dominieren im privaten Umfeld in der Regel historisch oder mehr oder weniger zufällig gewachsene Strukturen, die alles andere als optimal zu nennen sind. Eine solche Konstellation führt häufig zu gravierenden Fehlentwicklungen, die erst mittel- oder langfristig in vollem Umfang wirksam werden. Im folgenden sei beispielhaft die reale Situation eines namhaften schweizerischen Unternehmens angeführt.
In den fünfziger Jahren gründete Herr Hans W. die Firma ABC. Sie spezialisierte sich schon frühzeitig auf eine Marktnische mit großem Wachstumspotential im elektromechanischen Bereich. Zuerst wurden die Spezialprodukte in der Schweiz, bald aber auch in Westeuropa und nach und nach auch in überseeischen OECD-Ländern angeboten. Die Strategie war einfach und klar: Es ging darum, mit einem relativ engen, stets den neuesten technologischen Entwicklungen angepaßten und qualitativ überlegenen Sortiment die Marktführerschaft im Zielsegment konsequent auszubauen. Nachdem diese Strategie in der Schweiz erfolgreich umgesetzt wurde, übertrug das Unternehmen seine Vorgehensweise auf Europa und Übersee. Zu Beginn der achtziger Jahre beschäftigte das Unternehmen mehrere hundert Mitarbeiter.
Die erfolgreiche Unternehmensentwicklung erlaubte es Herrn W., sich als Inhaber ein gutes Salär auszubezahlen und darüber hinaus beachtliche Dividenden auszuschütten. Die ihm so zufließenden Mittel verwendete Herr W. auf unterschiedlichste Art und Weise. Schon in den sechziger Jahren beteiligte er sich an einer von einem Freund gegründeten Elektonik-Firma und stellte in beträchtlichem Umfang Venture Capital zur Verfügung. Später wurde ihm von einem Bekannten ein Mehrheitspaket an einer mittleren Handelsfirma angeboten. Da dies Geschäft interessante Zukunftsperspektiven versprach, erwarb Herr Weber kurzerhand die Aktien. Auf ähnliche Weise gelangte er in den Besitz von zwei Minderheitsbeteiligungen an ortsansässigen Firmen. Einen relativ geringen Teil seines Vermögens übergab er zur Verwaltung an eine namhafte Privatbank.
Rückblickend zeigt sich, daß das Stammgeschäft nach wie vor floriert. Hier fühlt Herr W. sich zu Hause und setzt den größten Teil seiner Aktivität ein. Ganz anders haben sich seine anderen Investments entwickelt. Die Beteiligung an der Elektronik-Firma muß weitgehend abgeschrieben werden. Die Handelsfirma stagniert seit der Übernahme und auch die Minderheitsbeteiligungen werfen nur eine höchst bescheidene Rendite ab. Lediglich der der Bank übergebene Vermögensanteil, der weitgehend in Obligationen angelegt wurde, erzielt eine akzeptable Verzinsung.
Beispiel 2 : Investmentdiversifikation am Beispiel eines Schweizer Unternehmens
Der beschriebene Fall zeigt exemplarisch eine Entwicklung auf, die in Familienunternehmen allzu häufig auftritt: Das klare strategische Vorgehen auf Unternehmensebene führt zusammen mit ad-hoc Entscheidungen auf Eignerebene, die meist von Gelegenheiten oder persönlichen Beziehungen gesteuert sind, zu eindeutig faßbaren Negativentwicklungen.
1. Der Eigner investiert in Geschäfte, für die ihm das know-how fehlt und die er darum nicht korrekt beurteilen kann
2. Der Eigner konkurriert bei Investments mit professionellen Anlegern, die ihm hinsichtlich des Anleger-know-hows weit überlegen sind
3. Der Eigner konzentriert sich auf sein Kerngeschäft und vernachlässigt die Kontrolle und Weiterentwicklung seiner anderen Investments
4. Auftretende negative Entwicklungen bei den anderen Investments verstärken diese Haltung noch, obwohl gerade dann aktives Handeln geboten wäre
5. Der Fokus für Investments wird vom Zufall gesteuert. Es fehlt ein ganzheitliches Anlagekonzept.
Es wird deutlich, daß das Nebeneinander von strategischem Verhalten auf Unternehmensebene und ad-hoc-Führung im Eignerbereich durch die Entwicklung eines harmonischen Gesamtkonzeptes abgelöst werden muß. Dieses Konzept, welches beide Bereiche gleichermaßen berücksichtigt stellt dann eine echte Eignerstrategie dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6 : ganzheitliche Betrachtung: Eignerziele
2.2 Vorteile der Eignerstrategie
Auch eine Eignerstrategie stellt natürlich kein Wundermittel gegen alle typischen Probleme eines Familienunternehmens dar, aber sie ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Erfahrung aus der Beratungspraxis hat gezeigt, daß bereits der Weg ein Ziel ist, d.h. daß schon die Entwicklung einer Eignerstrategie positive Effekte mit sich bringt:
1. Es kann ein breiter Betrachtungsfokus eingenommen werden, der sowohl den Unternehmens- als auch den Eignerbereich umfaßt
2. Die vom Alltag bestimmte kurzfristige Sichtweise im privaten Umfeld wird durch eine langfristig orientierte Betrachtung ersetzt
3. Es wird ein vorhandenes, aber nie deutlich zu Tage getretenes Gerüst an Zielen und Werthaltungen innerhalb des Eignerkreises dokumentiert und als Orientierung für die langfristige Entwicklung des Eignervermögens genutzt
Ein wesentlicher Aspekt der Eignerstrategie ist die Schaffung eines proaktiven Handlungsspielraumes für den Eigner. An dieser Stelle sei angemerkt, daß die Entwicklung der Strategie nicht erst in Krisensituationen angegangen werden sollte, auch wenn sie hier zumindest teilweise hilfreich sein kann. Ihr wahres Potential entfaltet die Eignerstrategie dann, wenn sie in Zeiten ohne Not entwickelt wird. Nur dann hat der Unternehmer die notwendige Zeit und kreative Freiheit, neue Möglichkeiten für das Eignervermögen auszuloten. Die Beratungspraxis zeigt, daß hier erstaunliche Wertschöpfungspotentiale identifiziert und genutzt werden. Die Vermögenswerte können somit auf der Eignerseite nachhaltig gesteigert werden. Eine Eignerstrategie ist für den Inhaber bei der Setzung von Handlungsprioritäten unter einem langfristigen Horizont nützlich, da sie einerseits zu einer zeitlichen und mentalen Entlastung des Unternehmers und andererseits zu einer größeren Hebelwirkung in jenen Bereichen führt, in denen sich der Einsatz von Zeit und Ressourcen tatsächlich lohnt.
Ein weiterer Aspekt liegt in der Tatsache, daß der Eigner als Unternehmer besonderen Risiken ausgesetzt ist. Die Eignerstrategie erlaubt es, diese Risiken einzubeziehen, um die Gefährdung des Vermögens zu reduzieren. Im Rahmen der Strategieentwicklung müssen auch Verfahren entstehen, die die schrittweise Heranführung der Nachfolge-generationen an die Thematik der Führung von Familienunternehmen sicherstellen.
Es ist ersichtlich, daß diese Probleme bei isolierter Betrachtung einer Unternehmensstrategie nicht gelöst werden können. Erst die übergeordnete Eignerstrategie kann adäquate Resultate erbringen. Die Vorteile überwiegen die durchaus vorhandenen Nachteile wie Beratungs- und Zeitaufwand bei weitem, so daß die Frage der Entwicklung eines solchen Konzeptes auf keinen Fall verneint werden kann.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7 : Dimensionen der Eignerstrategie
2.3 Entwicklungsgrundsätze einer Eignerstrategie
Damit eine Eignerstrategie Erfolg haben kann, müssen eine Reihe von Anforderungen erfüllt sein. Oberstes Gebot ist das Prinzip der Ganzheitlichkeit. Verschiedene Problemstellungen, denen sich der Eigner gegenüber sieht, werden von unterschiedlichen Spezialisten gelöst. Der Jurist formuliert Verträge, der Treuhänder berät in Finanzfragen. Der Bankier ist oftmals eher an einem going-public interessiert und versucht, den Eigner zum Börsengang zu überreden. Die diversen guten Freunde machen zudem mit ihren eigenen Ratschlägen von sich reden. Jeder Berater verfolgt dabei ganz bestimmte eigene Ziele und hat auch eine ganz spezifische Sichtweise. Deshalb werden nur Insellösungen erzeugt, die sich vielleicht manchmal ergänzen, in den meisten Fällen aber eher konträre Auswirkungen haben und so insgesamt mehr Probleme schaffen als lösen. Die ganzheitliche Eignerstrategie sorgt nun dafür, daß die Teillösungen sich gegenseitig stützen und stärken. So entsteht ein festes Netz um Unternehmen, Familie und Vermögen.
Das Konzept muß aber auch möglichst einfach aufgebaut sein. Komplexität, wie sie schon durch das Nichtvorhandensein einer Strategie entstanden ist, ist in der Regel kostenintensiv und mehr hemmend als nützlich. Die vorhandene Komplexität muß also aufgelöst und darf auf keinen Fall durch eine neue ersetzt werden. Das Gesamtkonzept muß darüber hinaus auch konsistent sein, damit sich die einzelnen Komponenten nicht gegenseitig blockieren. Die Forderung nach Einfachheit zieht zwangsläufig die Forderung nach sich, bei allem Regelungswunsch sich auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren. Die Eignerstrategie sollte als Zielsetzung immer verfolgen, eine nachhaltige Wertsteigerung des Familienvermögens sicherzustellen – nicht mehr und nicht weniger. Keinesfalls sollte versucht werden, etwa zukünftige Aktivitäten des Unternehmens festzuschreiben oder ähnlich unsinnige Anliegen zu Papier zu bringen, die zukünftigen Generationen mehr schaden als nützen.
2.4 Inhalte einer Eignerstrategie
Wie bereits beschrieben, soll die Eignerstrategie ganzheitlich gestaltet sein, also alle für den Inhaber wichtigen Aspekte integriert abhandeln. Nachfolgend sollen die wichtigsten Inhalte kurz erläutert und die Wechselbeziehungen zur Unternehmensentwicklung besonders berücksichtigt werden.
2.4.1 Leitidee
Erfolgreiche Unternehmer zeichnen sich dadurch aus, daß sie eine Leitidee, eine Vision entwickeln. Diese Leitidee sollte auch das Fundament der Eignerstrategie darstellen, weil so die unternehmensspezifischen Belange integriert werden.
2.4.2 Nutzenpotentiale und Wertschöpfungskonzept
Nutzenpotentiale sind die in Umwelt, Markt oder Unternehmen vorhandenen Konstellationen, die zum Nutzen der Bezugsgruppen ausgeschöpft werden können.[19] Neben dem Marktpotential sind eine Reihe weiterer Potentiale von Interesse, wie beispielsweise das Finanzpotential (Beschaffung günstiger finanzieller Ressourcen) oder das Humanpotential (Gewinnung hochmotivierter Mitarbeiter).[20] Nutzenpotentiale geben immer Auskunft über interessante Wertschöpfungsmöglichkeiten. Im Mittelpunkt der Eignerstrategie steht somit die Frage, welche Potentiale zu erschließen sind und welche Wertschöpfungsmöglichkeiten genutzt werden sollen.
Für die Unternehmensentwicklung sind in der Regel die Produkt/Markt- und Profilierungsaspekte von zentraler Bedeutung. Auch der Eigner hat die Möglichkeit, sich voll auf die Erschließung des Marktpotentials als primäres Nutzenpotential zu konzentrieren, jedoch ist dies unter dem Aspekt der Risikodiversifikation kritisch zu beurteilen. Aus finanzieller Sicht ist festzulegen, inwieweit Beteiligungen an Drittunternehmen zu erwerben und in welchem Umfang dabei Investitionen in börsennotierte Unternehmen vorzunehmen sind. Diese Überlegungen berücksichtigen auch die Verteilung des Risikos. Eine spezielle Variante dieser Strategie hat der amerikanische Milliardär Warren Buffet praktiziert.[21] Sein Konzept des „Value Investing“ beinhaltet die Beschränkung auf Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen, die aufgrund einer sorgfältigen Investmentanalyse besonders zukunftsträchtig und erfolgversprechend erscheinen.
Im Rahmen einer Beteiligungsstrategie soll auch die mögliche Konzentration des Eigners auf spezifische Phasen des Lebenszyklus von Unternehmen erwähnt werden. So beteiligen sich Venture-Kapitalsten wie Alan Patricof Ass. vorwiegend an sogenannten „Start-ups“ und hoffen, in der erwarten Wachstumsphase eine überdurchschnittliche Wertschöpfung zu erzielen. Eigner wie beispielsweise die der Hanson Plc. erzielen eine große Wertschöpfung durch die Übernahme von „undermanaged companies“ und deren Restrukturierung.
Weiterhin besteht die Möglichkeit sein Vermögen nicht komplett unternehmerisch zu nutzen, sondern von einer Bank oder einer vergleichbaren Institution verwalten zu lassen.
2.4.3 Ergebnisorientierung
Die Definition von Ergebniszielen ist ein weiters wichtiges Element der Eignerstrategie. Diese Ziele sind unmittelbar von der Vision des Eigners abhängig. Ein Unternehmer, der vor allem ideelle Werte, Selbstverwirklichung oder persönliche Unabhängigkeit anstrebt, verfolgt völlig andere Ergebnisziele, als ein auf finanziellen Erfolg ausgerichteter Eigner. Einer grundsätzlichen Festlegung der Gewinnerwartungen incl. eines Zeithorizontes folgt die Präzisierung der Erwartungen zur Verwendung des Cash- flows. Der Eigner kann die Höhe der ausgewiesenen Gewinne durch die Wahl von Bewertungsrichtlinien und Ausnutzung des Aktivierungswahlrechts beeinflußen. Je nach Umfang der Beteiligung kann er mehr oder weniger direkten Einfluß auf die Gewinnverwendung ausüben. Es ist letzlich ihm überlassen, ob er zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und Selbstfinanzierungskraft eine Gewinnthesaurierung präferiert oder vorzugsweise eine Ausschüttung der Gewinne zur privaten Verwendung vornimmt. Bei der Auswahl sollte berücksichtigt werden, daß die Entscheidung für den einen oder anderen Weg einen unmittelbaren Einfluß auf den Entwicklungspfad des Unternehmens hat.
2.4.4 Führungsmäßige Einflußnahme
Der Eigner muß sich entscheiden, ob er den klassischen Weg der Führung beschreitet und selbst operativ an der Spitze seines Unternehmens steht, ob als Präsident oder Vorsitzender der Geschäftsleitung, oder vielleicht lieber sein Unternehmen nur „präsidiert“, die operative Führung aber einem Geschäftsführer überläßt. Die letztere Möglichkeit verschafft ihm dann die Möglichkeit, seine freigewordene Zeit den anderen Investments oder seinem Privatleben zur Verfügung zu stellen. Die Wahl ist sicherlich in erster Linie von der Größe des Unternehmens und dem Umfang des vorhandenen Vermögens abhängig, da der zweite Weg schon eine gewisse Potenz verlangt. Sicherlich ist es auch sinnvoll, in diesem Zusammenhang die Legitimation der Einflußnahme zu hinterfragen. Die Legitimation kann einmal ausschließlich in der Kapitalbeteiligung begründet sein. In diesem Fall wäre zu überlegen, ob eine Einflußnahme über die Mitgliedschaft in Verwaltungsorganen nicht sinnvoller ist, als die Führung des operativen Geschäfts. Ist die Legitimation aber aus besonderen Managementfähigkeiten oder Branchenkenntnissen abgeleitet, ist eine Beteiligung an der direkten Unternehmensführung dagegen außerordentlich wünschenswert. Da die führungsmäßige Einflußnahme von besonderer Bedeutung für die Entwicklung des Unternehmens ist, sollte man die Hinterfragung der Legitimation auf keinen Fall zu einem Tabuthema machen, sondern regelmäßig zur Diskussion stellen.
2.4.5 Führungsziele und Führungsleistung
Eine strategische Schlüsselfrage liegt in den Zielsetzungen bezüglich der Einflußnahme auf die Beteiligungsgesellschaft(en) und dem persönlichen Führungsengagement, welches der Eigner zu bringen gewillt ist.
Ein Eigner, der als oberstes Ziel die Verbesserung der umsatzmäßigen Entwicklung verfolgt, wird seine Aktivitäten auf eine Expansion der Beteiligungsunternehmen ausrichten und damit verbunden nach einer Festigung der Marktstellung oder der technologischen Führung streben. Für viele ist Wachstum aber nur von sekundärer Bedeutung. Ihnen geht es mehr darum, den Aktionärswert zu maximieren und sie werden daher ihr Augenmerk auf den langfristig erzeugten Cash-flow richten. Für die Unternehmensentwicklung bedeutet dies eine starke Finanzorientierung. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, durch gezielte Akquisition und Integration von Unternehmen, begleitet von einem Turnaround-Management, eine angemessene Wertschöpfung zu erzielen.
2.4.6 Finanzierung
Für die Finanzierung seiner Investments stehen dem Eigner diverse Möglichkeiten offen, die in direkter Abhängigkeit zu seinen Wertvorstellungen über Unabhängigkeit, Freiheit und langfristiger Sicherung des Unternehmensbesitzes stehen. Sind im Vermögen bereits ausreichend Werte vorhanden, so kann Kapital durch Umschichtungen gewonnen werden – eine Ausgangssituation, die eher eine Ausnahme darstellt. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, Anteile am Stammunternehmen zu verkaufen, um Kapital zu gewinnen. Ein in den achtziger und neunziger Jahren zunehmend populärer gewordenes Instrument ist auch das going public, der Börsengang. Allerdings muß das Stammunternehmen schon eine respektable Größe oder überdurchschnittliche Expansionsmöglichkeiten haben, um hier erfolgreich Kapital beschaffen zu können. Letzten Endes bleibt die klassische Methode der Finanzierung über Bankkredite – die aber wegen der extrem risikoaversen Einstellung der deutschen Banken als höchst problematisch anzusehen ist – sowie die Finanzierung über die cash-flows von Tochterunternehmen.
2.4.7 Risikopolitik
Im Rahmen einer Risikopolitik muß der Eigner sich darüber klar werden, welches Risikopotential er zusätzlich zu den persönlichen Risiken im Bezug auf die unternehmensbezogene Entwicklung[22] auf sich zu nehmen bereit ist. Neben der persönlichen Risikoneigung des Unternehmers kommt der Absicherung möglicher Risiken ganz entscheidende Bedeutung zu. Die einfachste Absicherung besteht sicherlich darin, Risiken zu vermeiden, nur, wer allen Risiken aus dem Wege geht, wird auch keinen Erfolg haben. Echte Absicherungsmaßnahmen liegen z.B. in der Bildung von finanziellen Reserven, der sorgfältigen Überwachung der Geschäftsaktivitäten oder der vertraglichen Gestaltung. Von vielen Eignern wird der Verteilung der Risiken eine zu geringe Bedeutung beigemessen. Dabei steht insbesondere die Frage im Vordergrund, ob man sich auf einige wenige Investments, bei denen man über ein gutes Hintergrundwissen verfügt, beschränkt, oder ob man lieber möglichst viele differierende Investitionen zur Diversifikation betreiben soll.
Ein Risiko, über daß die wenigsten Betroffenen gerne nachdenken, besteht darin, daß eine übermäßig starke führungsmäßige Einflußnahme auf ein Unternehmen durch den Eigner selbst zu einer sehr starken Abhängigkeit führt, die bei einem unvorhergesehenen Ausfall des Unternehmers oder auch im Rahmen eines Generationswechsels unvorhergesehene und schwerwiegende Negativeinflüsse auf das Unternehmen und seine Entwicklung nach sich ziehen wird.
2.4.8 Steuerpolitik
Jede Eignerstrategie muß auch eine Standortbestimmung in Bezug auf Steuern beinhalten. Dabei muß berücksichtigt werden, daß die steuerliche Privatsituation in aller Regel nicht getrennt von der steuerlichen Unternehmenssituation betrachtet werden kann. So kann beispielsweise durch eine Standortverlagerung eines Unternehmens über Steuereinsparungen Kapital für Expansionsbestrebungen gewonnen werden. [Beispielhaft sei hier der Ort Norderfriedrichskoog an der Nordsee genannt, der von ansässigen Unternehmen keine Gewerbesteuer verlangt.-Anm. des Verfassers]
2.4.9 Strategische Erfolgspositionen (SEP)
Letzendlich hängt der Erfolg des Unternehmers davon ab, ob es ihm gelingt, die in den Phasen des Unternehmenslebenszyklus jeweils erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln. In der Pionierphase sind deutlich andere Eigenschaften gefragt wie als Mehrheitsaktionär eines Großunternehmens. Um Vorteile in bestimmten Bereichen erzielen zu können, müssen die eigenen Fähigkeiten kritisch analysiert werden, um festzustellen, welche in der jeweiligen Entwicklungsphase des Unternehmens erfolgswirksam sind. Aus dieser Erkenntnis sind sodann SEP zu entwickeln[23].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Pionier Wachstum Reife Wende Zeit
Abbildung 8 : Lebenszyklus von Unternehmen
2.5 Die Entwicklung einer Eignerstrategie in der Praxis
Von der methodischen Seite her kann eine Eignerstrategie ebenso wie eine Unternehmensstrategie entwickelt werden.
1. Lagebeurteilung
Bisherige Ausschöpfung von Nutzenpotentialen
Nicht ausgeschöpfte Nutzenpotentiale
2. Strategie
Nach Lagebeurteilung und Ermittlung der Möglichkeiten des Eigners
Prüfung und Bewertung verschiedener Alternativen
3. Umsetzung
Umsetzungspläne formulieren und implementieren
Besondere Beachtung ist dem Umstand zu schenken, daß, sowohl bei der Analyse von Informationen als auch bei der Strategieentwicklung, gewonnene Erkenntnisse über die Auswirkungen von Eignerstrategien berücksichtigt werden müssen. Allgemeine strategische Grundsätze wie Konzentration der Kräfte, Ausschöpfung von Nutzenpotentialen oder Aufbau von Stärken sind ebenso zu beachten, wie die in diversen Untersuchungen gewonnene Erkenntnis, daß es insbesondere für Familienunternehmen Erfolgsfaktoren gibt, deren Einhaltung die Basis für den Erfolg einer Eignerstrategie darstellen können.
In der Praxis stehen für die Entwicklung einer solchen Strategie grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung. In einer relativ kurzen Zeit kann sie in Gesprächen zwischen Inhaber und erfahrenem Berater entwickelt werden. Der Berater stellt in diesem Fall im Rahmen der Informationsanalyse gezielte Fragen, ergänzt die Antworten gegebenenfalls um spezifische Erhebungen und formuliert sodann gemeinsam mit dem Eigner eine Strategie.
Sind in einer Familie aber verschiedene Stämme vertreten, wie es sehr häufig der Fall ist, empfehlen sich eher andere Methoden. So könnten beispielsweise im Rahmen von Workshops die einzelnen Themenbereiche erarbeitet werden. Die Praxis hat gezeigt, daß in aller Regel etwa 5 Workshops ausreichend sind, wobei die ersten beiden der Informationsanalyse dienen, die folgenden zwei für die Strategieentwicklung genutzt werden und der letzte schließlich mit der Festlegung der Umsetzung den Strategieentwicklungsprozeß abschließt. Zwischen den Arbeitstagungen sind dabei unbedingt Vorabsprachen zu treffen, so daß an den Tagungen zielstrebig gearbeitet werden kann. Erfahrungsgemäß ist für einen solchen Prozeß ein Zeitraum von etwa fünf Monaten einzuplanen.
Ob ein Firmeneigner sich letzendlich bei der Entwicklung einer Strategie auf sein Unternehmen konzentrieren oder sein Konzept aus der persönlichen Sicht entwickeln will, hängt von seiner Aufwands-/Ertragsüberlegung ab. Unternehmen befanden sich in den siebziger und achtziger Jahren in einer vergleichbaren Situation, als das strategische Management mehr und mehr fester Bestandteil der Unternehmensführung wurde. Damals wie heute gab und gibt es Vorreiter und Nachzügler, doch wird der relativ geringe Aufwand für die Erstellung einer Eignerstrategie im Verhältnis zu seinem Nutzen dafür sorgen, daß sich zunehmend mehr Eigner dafür entscheiden werden.
3. Konflikte
3.1 Konfliktursachen
Konflikte entstehen in einem Familienunternehmen auf die vielfältigste Weise. An unserem einführenden Beispiel der Familie Max Müller ist das deutlich zu erkennen. Um Konflikte kontrollieren zu können, ist es von elementarer Bedeutung, sich frühzeitig darüber Klarheit zu verschaffen, wo Konfliktpotential vorhanden ist und wie man einem daraus eventuell entstehenden Konflikt begegnen soll. Der Fehler, den viele Familienunternehmer immer wieder begehen, liegt darin, das Familienunternehmen und die Familie nur für den Zeitraum zu betrachten, der ihn persönlich betrifft. Auch hier zeigt der Fall Max Müller, daß eine solche Sichtweise letzendlich langfristig das eigene Lebenswerk zerstören kann. Um nun Strategien zur Konfliktbewältigung entwickeln zu können, muß man sich zunächst einmal darüber klar werden, welche Grundphilosophie denn die Familie und Ihr Unternehmen verfolgen soll. Man unterscheidet dabei folgende Alternativen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 4 : Philosophien von Familienunternehmen [24]
Weiterhin ist die unterschiedliche Interessenlage aktiver und passiver Familienmitglieder zu berücksichtigen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 5 : Interessenlagen aktiver und passiver Familienmitglieder [25]
Das Beziehungsgeflecht in einer Familie kann allein schon relativ schnell komplexe Strukturen ergeben, ebenso wie in einer Unternehmung. Kommt allerdings beides zusammen, entsteht eine unüberschaubare Situation, in der die Auswirkungen einzelner, kleiner Konflikte in ihrer endgültigen Bedeutung oftmals gar nicht mehr abzusehen sind.
Unternehmen Familie Familienunternehmen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 9 : Beziehungsgeflecht in Familienunternehmen [26]
Damit sind schon einige Konfliktfelder benannt. Doch die größte Bedeutung kommt der Tatsache zu, daß Familiensicht und Unternehmenssicht grundsätzlich konträr sind. Hier stoßen absolut gegensätzliche Auffassungen aufeinander, die zwangsläufig permanente Auseinandersetzungen zwischen den Parteien zur Folge haben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 6 : Familie versus Unternehmen [27]
Nachdem nun alle wesentlichen Konfliktpotentiale zusammengetragen sind, stellt sich die Frage, wie solche Konflikte überhaupt entstehen und wie man mit ihnen umgehen soll, wenn man sie denn nicht vermeiden kann.
Eine sehr interessante Darstellung, wie sich ein Konflikt entwickelt, stellen die vier K’s der Eskalation dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 7 : Die 4 K's der Eskalation [28]
Ein typisches Beispiel für die katastrophalen Auswirkungen, die ein solcher Konflikt haben kann stellt die Familie Bahlsen dar.
In der letzten Generation führten zwei Brüder das bekannte Unternehmen. Einer davon hatte zwei Söhne, der andere nur einen. Bei der Generationenfolge ging das Unternehmen an die drei Jüngeren über. Es herrschte zwischen den zwei Brüdern Einigkeit über den Grundsatz „business first“ und damit die Priorität der Gewinnverwendung in der Thesaurierung. Der Vetter hatte hier eine völlig konträre Auffassung und sah das Unternehmen als finanzielle Grundlage eines exklusiven Lebensstils. Da die Auffassungen der drei Männer nicht über eine Kompromißlösung anzunähern waren, eskalierte der Streit. Die beiden Brüder legten ihrem Vetter nahe, aus dem Unternehmen auszusteigen, was dieser aber für den gebotenen Gegenwert ablehnte. Da auch hier kein Konsens entstand, trug der Vetter den Konflikt schließlich an die Presse und verbreitete unternehmensschädigende Gerüchte. Die beiden Brüder prozessierten sechs jahre, bis es ihnen gelang, den Vetter aus dem Unternehmen zu entfernen. Das kostete enorme finanzielle, psychische und physische Ressourcen und heute steht das Unternehmen kurz vor dem Verkauf an die Konkurrenz, eine Lage, die die Brüder Bahlsen immer verhindern wollten.
Beispiel 3 : Konflikteskalation bei Bahlsen [29]
Konflikte müssen aber nicht immer nur negative Auswirkungen haben, wenn auch der Begriff sehr negativ behaftet ist. Man muß sorgfältig zwischen konstruktiven und destruktiven Konflikten unterscheiden. Bei ersteren wird das Vertrauen und der Respekt der Parteien gewahrt und es erfolgt eine Konzentration auf das „Wie“ und nicht das „Worum“. Außerdem signalisieren alle Beteiligten fortwährende Lösungsbereitschaft und kommunizieren direkt und offen miteinander. Es wird immer versucht, kreative Ansätze zu finden, die letzlich einen Gewinn für alle bedeuten. Der Umgang mit solchen Konflikten fällt auch relativ leicht, weshalb sie wohl meistens auch nicht als solche wahrgenommen werden.
Der destruktive Konflikt dagegen geht von der Bereitschaft zur Zerstörung des gegenseitigen Verhältnisses und des Konfliktgegenstandes aus und konzentriert sich lediglich auf das „Worum“. Die Beteiligten drohen einander ständig mit dem Schlimmsten, kommunizieren nur indirekt und symbolisch miteinander und zeigen sich ständig wiederholende Rituale.
Mit destruktiven Konflikten umzugehen ist ausgesprochen schwierig, aufreibend und zeitraubend. Konfliktstrategien, die einen destruktiven Konflikt nach sich ziehen, enden allesamt mit negativen Ergebnissen für die Betroffenen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 8 : Destruktive Konfliktstrategien [30]
Dagegen ist es wesentlich besser, sich darüber Klarheit zu verschaffen, welche Verhaltensweisen einen konstruktiven Konflikt nach sich ziehen. Wenn man sich an diese Verhaltensweisen hält, kann man sich und seinen Mitmenschen jede Menge unangenehmer Empfindungen ersparen. Zunächst muß man seinen Konfliktpartner (nicht Konfliktgegner) immer respektieren, das heißt ihm das Recht auf seine Meinung und Einstellung in dem selben Maße zubilligen, wie sich selbst. Um zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelangen, muß man sich Zeit füreinander nehmen, bereit sein, voneinander zu lernen und als oberste Maxime immer berücksichtigen, daß der Erhalt der Beziehung mit dem Konfliktpartner wichtiger ist, als der Inhalt jeder Streitfrage.
Trotz aller Bemühungen, einen konstruktiven Konflikt zu führen, werden immer wieder Fehler begangen, die aus einem konstruktiven eine destruktiven Konflikt werden lassen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 9 : Irrtümer in Konfliktsituationen
3.2 Strategien zur Konfliktbewältigung
Die schwelenden Konflikte kommen in aller Regel dann an das Tageslicht, wenn weitreichende Entscheidungen für Familie und Unternehmen anstehen. Eine solche Entscheidung ist die Frage der Nachfolgeregelung. Es ist also von zentraler Bedeutung, eine verbindliche, langfristige – möglichst über mehrere Generationen bestehende – Regelung zu schaffen, um eine Nachfolgefrage ohne nachhaltige Konflikte abzuwickeln.
Für eine Lösung des oftmals komplexen Nachfolgeproblems bieten sich zwei Möglichkeiten an.
3.2.1 Komplexität lösen
Wenn man sich dafür entscheidet, die Komplexität der Nachfolgefrage aufzulösen, stehen dafür mehrere Optionen zur Verfügung, deren Vor- und Nachteile nachfolgend aufgeführt sind:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 10 : Optionen der Konfliktbewältigung
Wenn eine Familie sich zum Verkauf des Unternehmens entschließt, so geschieht dies in aller Regel, weil entweder kein oder kein geeigneter Nachfolger vorhanden ist oder weil die Familie so zerstritten ist, daß eine Fortführung des Unternehmens in der Familie unmöglich erscheint. Diese Lösung ist aber immer final und beendet sowohl für die Familie wie auch für das Unternehmen eine Ära. Es gibt aber Situationen, in denen sich ein Verkauf nicht vermeiden läßt.
Auch unter weniger dramatischen Umständen läßt sich ein Verkauf des Unternehmens nicht immer vermeiden. Beispielhaft sei hier das Unternehmen „CompuNet“ von Herrn Jost Stollmann genannt.
Die Firma CompuNet gehört zu den raketenhaft aufgestiegenen Beispielen der jungen, dynamischen IT-Branche. Herr Stollmann hat es geschafft, durch eine eigenwillige Unternehmenskultur und eine herausragende Führungspersönlichkeit, die die Schnellebigkeit dieser Branche perfekt verkörpert, binnen zehn Jahren aus dem Nichts ein globales Unternehmen mit über 2 Mrd DM Jahresumsatz zu machen. Die Expansionsansprüche, die von Seiten der Kunden an das Unternehmen herangetragen wurden, haben Herrn Stollmann aber dann gezwungen, sein Unternehmen an einen internationalen Konzern zu verkaufen. Es wurde verlangt, ein globales Vertriebs- und Servicenetz zur Verfügung zu stellen. Ein solches Netz kann man aber nicht über Nacht aus dem Boden stampfen, auch nicht mit 2 Mrd. DM Jahresumsatz. Und so mußte CompuNet an die General Electric verkauft werden, die ein entsprechendes Netz weltweit zur Verfügung stellen konnte. Herrn Stollmann ist die Entscheidung nach eigener Aussage nicht leicht gefallen, vor allem weil er sich bewußt war, daß mit der Übernahme durch einen Riesenkonzern die spezielle Unternehmenskultur, die er seinem Unternehmen eingehaucht hatte und die seinen ganz besonderen Reiz ausmachte, unwiederbringlich verloren gehen würde.
Beispiel 4 : Verkauf von CompuNet [33]
Die Thronfolgerlösung ist eine für den Regelfall schon wesentlich sympathischere Lösung. Ein Mitglied aus der Familie führt das Unternehmen fort, alle anderen Anwärter werden aus dem Familienvermögen abgefunden. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich bei dieser Lösung für den Senior, der einerseits gerecht gegenüber seinen Nachkommen sein und andererseits den Bestand des Unternehmens sichergestellt wissen will. Als Senior sollte man sich klar machen, daß es echte Gerechtigkeit nicht geben kann. Man kann den Wert eines übertragenen Unternehmens nicht mit anderen Vermögenswerten, mit denen die Geschwister abgefunden werden, vergleichen, da ein Unternehmen immer langfristig gebundenes Kapital bedeutet und ein erhebliches unternehmerisches Risiko beinhaltet.
Herr Leopold Schoeller[34] hat das Problem auf seine eigene Weise elegant und gelungen gelöst.
Herr Schoeller hat sein Unternehmen in den siebziger und achtziger Jahren durch eine turbulente Zeit geführt, in der sich die Textilbranche immer mehr durch Konkurrenz aus Fernost und anderen Billiglohnländern bedroht sah. Durch geschickte Unternehmensführung gelang es jedoch, die schwierigen Zeiten zu überstehen und sich schließlich wieder fest am Markt zu behaupten. Herr Schoeller hat sich frühzeitig Gedanken um seine Nachfolge gemacht, war sich aber immer der Tatsache bewußt, daß ein Unternehmen in einer so sensiblen Branche nur einem seiner beiden Söhne würde Arbeit und Brot geben können. Beide Söhne bereiteten sich entsprechend ihren Neigungen auf die spätere Übernahme vor, ohne vom Vater dazu gedrängt worden zu sein. Ein Sohn schlug den Weg der technischen Ausbildung ein, der Bruder absolvierte ein betriebswirtschaftliches Studium. Der Techniker kehrte nach der Ausbildung in den elterlichen Betrieb zurück, der Betriebswirt fand eine Stellung bei einer Unternehmensberatung. Eines Tages, als Herr Schoeller mit seinen Söhnen in Urlaub war, faßte er sich ein Herz, und eröffnete seinen Söhnen, daß nur einer von ihnen das Unternehmen weiterführen könne. Sie sollten aber, da er beide auf ihre Weise für qualifiziert hielt, untereinander ausmachen, wer in die Fußßstapfen des Vaters treten sollte. Die Brüder wurden sich schnell einig, daß der Techniker derjenige sein solle. Die Entscheidung wurde beiden erleichtert, da der Betriebswirt in der Unternehmensberatung bereits ein berufliches Zuhause gefunden hatte.
Beispiel 5 : Thronfolgerlösung bei der Leopold Schoeller jr. & Cie. [35]
Das Family oder Owner-Buy-Out ist durch ein spezielles Finanzierungsmodell sowie eine besondere steuerliche Gestaltung gekennzeichnet. Bei richtiger Handhabung stellt es ein gutes Instrument zur Sicherung des Fortbestandes und zur Wahrung des mittelständischen Charakters des Unternehmens dar.
Bei einem Buy-Out wird das Unternehmen an eine neu gegründete Erwerber-Holding veräußert, deren Minderheitsanteile vom bisherigen Eigentümer (Owner-Buy-Out), den leitenden Angestellten (Management-Buy-Out[36] ), der Belegschaft (Employee-Buy-Out), von externen Managern (Management-Buy-In) oder auch einer Kombination dieser Personenkreise übernommen werden. Die Mehrheitsanteile zeichnet dagegen ein institutioneller Investor (Beteiligungsfonds), der nicht an kurzfristiger Rendite, sondern vielmehr am langfristigen Wertzuwachs und einem attraktiven Veräußerungsgewinn aus dem Engagement interessiert ist.
Bei einem Buy-Out geht es grundsätzlich um einen Totalverkauf des mittelständischen Unternehmens an außenstehende Partner. Darüber hinaus ergibt sich beim Owner-Buy-Out die möglicherweise recht interessante Variante eines organischen Ausstiegs, da die bisherige Unternehmerpersönlichkeit weiterhin Kapitalanteile als Minderheitsgesellschafter hält und für einen überschaubaren Zeitraum die Geschäftsleitungsfunktion wahrnimmt.
Der Finanzpartner wird um eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit bemüht sein, weil von einem harmonischen Zusammenwirken der gemeinsame künftige Erfolg abhängt. Er wird sich nicht in das operative Tagesgeschäft einmischen, sondern lediglich bei strategischen Zukunftsfragen im Beirat mitentscheiden wollen. Wichtig ist auch, daß der Finanzinvestor die künftige Entwicklung des Unternehmens durch die volle Breite seiner Ressourcen, z.B. durch sein weitreichendes Informations- und Kontaktnetz, unterstützt und fördert. Bei der Auswahl des richtigen Investors ist es von Vorteil, wenn dieser im Portefeuille bereits Beteiligungen aus derselben bzw, vor- oder nachgelagerten Branchen hält, um Synergiepotentiale, z.B. im Einkaufs- oder Vertriebsbereich, zu aktivieren.
Die Familie Underberg hat hier eine sehr interessante Lösung gefunden. Sie hat eine Holding gegründet, die Eigentümer der inzwischen recht zahlreichen Tochterunternehmen ist und somit eine Variante des Owner-Buy-Out ohne Beteiligung externer Partner geschaffen. Die Geschäftsleitung liegt weiter in den Händen der Familie, ebenso wie das Eigentum an der Holding. Durch eine Kombination mit der Thronfolgerlösung ist sichergestellt, daß immer nur ein Nachfolger die Führungsnachfolge bzw. die Eigentumsnachfolge antritt. Durch eine geeignete Vermögensstrategie wird sichergestellt, daß für die nicht als Nachfolger in Betracht kommenden Kinder ein goldenes Sprungbrett in die eigene Selbständigkeit geschaffen wird. Die Realität zeigt, daß diese Selbständigkeit nicht zwangsläufig außerhalb des Unternehmens Underberg stattfinden muß, sind doch wegen der persönlichen Eignung durchaus Familienmitglieder als Angestellte im Unternehmen vorhanden.
Beispiel 6 : Underberg
Die Realteilung ist ein außerordentlich problematisches Instrument, das in der Regel nur dann in Frage kommt, wenn mehrere Einzelunternehmen bestehen. Selbst dann ist die Frage der Gleichwertigkeit nicht eindeutig zu beantworten und es ist nicht sichergestellt, ob die Einzelunternehmen ohne den übergeordneten Verbund mittel- und langfristig überhaupt überleben können.
Aldi hat es geschafft, indem die Brüder sich den bestehenden Markt regional geteilt haben (ALDI-Nord und ALDI-Süd). Jeder Unternehmensteil hat dabei genügend Marktanteile und Potenz behalten, um sich behaupten zu können. Wesentliche Voraussetzung war aber die Verpflichtung, sich nicht gegenseitig Konkurrenz zu machen. Neue Auslandsmärkte werden in gegenseitiger Absprache im Wechsel erschlossen, so daß auch dort gegenseitige Konkurrenz ausgeschlossen ist.
Beispiel 7 : Realteilung bei ALDI
Dieses gelungene Beispiel stellt aber eher die Ausnahme dar und ist sicherlich nicht beliebig auf andere Branchen portierbar.
3.2.2 Komplexität beherrschen
Wer sich dazu entschließt, die Komplexität zu akzeptieren, muß sich einen Weg überlegen, wie er sie beherrschen kann. Dazu ist es unumgäglich, eine Familienstrategie zu entwickeln, die so konzipiert ist, daß sie über mehrere Generationen Bestand hat.
Zunächst muß man sich im Hinblick auf den Unternehmenslebenszyklus (Abbildung 8, Seite 29) darüber klar werden, welche Anforderungen an die einzelnen Generationen überhaupt gestellt werden. Dies ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 11 : Herausforderungen im Familienunternehmen [37]
Damit eine Familienstrategie auch wirklich funktionieren kann, muß sie auf den bestehenden Verhältnissen aufbauen. Alle vorhandenen Familienmitglieder müssen einbezogen werden, um einen breiten Konsens sicherzustellen. Alle Kernfragen, die sich in Bezug auf Vermögen, Unternehmen und Familie ergeben, müssen zur Zufriedenheit aller Beteiligten beantwortet werden. Die Familienstrategie darf vor allem niemals als Produkt, sondern muß immer als Prozeß verstanden werden, damit ständig eine Anpassung an die Entwicklungen der Familie erfolgen kann. Im Kern muß eine solche Strategie handlungsorientiert sein, also für bestimmte vorhergesehene Konstellationen Handlungswege aufzeigen und für nicht vorhersehbare festlegen, wie sie zu behandeln sind.
Um eine Familienstrategie aufzubauen, kann man sich an der Beantwortung des folgenden Fragenkatalogs orientieren:
- Welche gemeinsamen Werte hat die Familie?
- Wie ist die Einstellung der Familie zum Unternehmen, zur Familie und zum Verhältnis zwischen Familie und Unternehmen?
- Welche Ziele bestehen für Unternehmen und Familie?
- Kernelemente einer Unternehmens- und Managementphilosophie
- Nachfolge in der Unternehmensführung
- Mitarbeit im Unternehmen
- Beteiligung am Unternehmen
- Code of conduct (Verhaltensregeln)
- Konfliktlösung (z.B. 24-Stunden-Regel)
- Ausbildung und Erziehung von Familienmitgliedern
- Förderung des Zusammenhaltes
- Umsetzungsmaßnahmen
Werden diese Fragen oder Problemfelder alle abgedeckt, so ist inhaltlich eine Familienstrategie vorhanden. Um aber in der Praxis überhaupt so weit zu kommen, bedarf es schon einiger Anstrengungen und auch einiger Ausgaben.
Am Anfang steht zunächst einmal die Festlegung des Ist-Zustandes. Dabei wird festgelegt, wer aktuell als der Familie zugehörig betrachtet werden soll, welche Beziehungen bestehen und vor allem welche Konflikte im Vorfeld zu beseitigen sind. Ist das geschehen, so muß danach die Familien-Strategie gemeinsam erarbeitet werden. Dies funktioniert am besten in Gruppenarbeit und unter der Anleitung eines erfahrenen Moderators. Die Familie sollte sich nicht scheuen, die Ausgaben für eine professionelle Moderation auf sich zu nehmen, da sonst der Erfolg im höchsten Maße zweifelhaft sein dürfte. Ist die gemeinsame Strategie dann erarbeitet, muß sie auch zum Leben erweckt werden. Die Manifestation von Absichtserklärungen auf Papier ist nur der erste Schritt; alle Beteiligten müssen die Inhalte der Übereinkunft auch leben. Um das sicherzustellen, bedarf es konkreter Umsetzungsmaßnahmen. Dabei muß Verantwortung delegiert werden, also einzelne Familienmitglieder werden für bestimmte Aufgaben verantwortlich gemacht. Dabei wird sowohl eine inhaltliche als auch eine zeitliche Komponente vorgegeben. Schlußendlich muß der Erfolg dieser Maßnahmen auch überprüft und die Einhaltung der Strategie durch gegenseitige Überwachung innerhalb der Familie gewährleistet werden.
So entsteht aus der Familienstrategie am Ende eine Familienverfassung. Wie so eine Verfassung aussehen kann, sei an einem Beispiel aus der Praxis aufgezeigt. Der Name der Familie spielt dabei keine Rolle und soll unbenannt bleiben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Beispiel 8 : Familienverfassung [38]
Wie in der obigen Familienverfassung zu lesen ist, wird einem Familienforum eine ganz besondere Bedeutung beigemessen. Es soll wenigstens einmal jährlich zusammenkommen und alle fünf Jahre erneut über die Verfassung beraten und abstimmen. Somit ist der bereits erhobenen Forderung, daß eine Familienstrategie ein Prozeß sein muß, Rechnung getragen.
Die Aufgaben eines Familienforums sollen nun noch beleuchtet werden. Es dient in erster Linie dazu, die Strategie weiter zu entwickeln und deren Umsetzung zu überwachen. Die Pflege der Familienkultur ist ebenso seine Aufgabe, wie die Entwicklung von Unternehmensverständnis bei den nicht tätigen Familienmitgliedern und auch die Entwicklung von Verantwortungsgefühl bei der jüngeren Generation, die frühzeitig an Sitzungen des Forums beteiligt werden sollte. Im Rahmen dieser Aufgaben ergeben sich einige Themengebiete, mit denen sich das Forum im einzelnen auseinandersetzen sollte:
- Geschichte und Traditionen der Familie
- Geschichte des Unternehmens, Performance und Perspektiven
- Unternehmen: Mission, Strategie, Ziele
- Die Bedeutung unternehmerischen Erfolges für die Familie
- Die Bedeutung der Familie für das Unternehmen
- Konfliktmanagement
- Persönlichkeitsentwicklung
- Leadership
- Team building
3.3 Der Beirat
Beiräte sind aus der Praxis des Familienunternehmens nicht mehr wegzudenken. Was vor 30 Jahren noch exotische Ausnahmeerscheinung war, ist inzwischen beinahe zum Standard einer zukunftssichernden Unternehmensorganisation geworden. Gewiß haben noch längst nicht alle Familienunternehmen einen Beirat, schließlich sind von Gesetzes wegen nur wenige Unternehmen in den Rechtsformen der AG und der GmbH zur Bildung eines zwischen Geschäftsführung und Unternehmenseigner tretenden Überwachungsorganes verpflichtet. Nimmt man jedoch die wachsende Zahl von Beiräten zum Thema und den Umstand zum Maßstab, daß namhafte Personalberater inzwischen professionelle Hilfe bei der Auswahl von Beiratsmitgliedern anbieten, dann wird die Installation eines solchen Gremiums heute nicht mehr als das Eingeständnis unternehmerischer Unzulänglichkeit bewertet.[39]
Familienunternehmen verfügen meist nicht über die qualitativen und quantitativen Managementkapazitäten anonymer Großkonzerne. Vor allem in der Aufbau- und Wachstumsphase gibt es keine auf Planung, Controlling, Organisation oder Forschung und Entwicklung spezialisierten Stäbe, keine auf Abruf wartenden Nachwuchstalente und die Betreuung der Unternehmensfinanzen ist keinem hochkarätigen Finanzvorstand, sondern eben einem Prokuristen anvertraut, dessen Qualifikation in erster Linie auf langjährige Betriebszugehörigkeit und treuer Ergebenheit gegenüber seinem „Chef“ beruht. Die meisten Familienunternehmer liegen damit auch ganz richtig, wenn sie sagen, daß sie sich eine aufgeblähte Personaldecke weder leisten können noch wollen. Aber die Kehrseite der Medaille sieht häufig genug so aus, daß es dem Unternehmer an der qualifizierten Unterstützung, motiviert-engagiertem Führungsnachwuchs oder kongenialen Partnern in der Unternehmensführung fehlt.
In solchen Konstellationen kann ein Beirat zu einem wichtigen Instrument werden, indem er als Sparringspartner der Unternehmensführung auftritt und dazu beiträgt, den Blick auf mögliche Schwachstellen der Organisation oder strategischen Ausrichtung zu lenken und die Qualität der unternehmerischen Entscheidung zu erhöhen. Als Unternehmer neigt man ganz besonders dazu, selektiv nur die Argumente zu sehen, die die eigene Auffassung stützen. Schon darum ist der Einsatz eines Beirates segensreich, weil der Unternehmer gezwungen ist, seine Entscheidungen zu rechtfertigen und deshalb seine eigene Argumentation stärker hinterfragen wird.
Noch wichtiger ist die Rolle des Beirates bei der Bewältigung des Problempotentials welches aus der Existenz verschiedener Interessengruppen auf der Eigentümerseite herrührt. In erster Linie steht hier die Frage an, wer die Führung des Unternehmens übernehmen darf, welche Befugnisse damit verbunden sind und welche Rechte den nicht beteiligten Gesellschaftern zustehen. Da die Gesellschafter höchst emotional und wenig sachkompetent zu urteilen pflegen, wenn es darum geht einen der eigenen Nachfolger auf den Thron des Unternehmens zu heben, sollte diese Entscheidung dem Beirat überlassen bleiben. Dazu muß allerdings gewährleistet sein, daß er angemessen besetzt ist.
Das Gremium sollte eine angemessene Größe haben, die ein sinnvolles Arbeiten ermöglicht. Daher darf die Zahl der Mitglieder nicht zu groß werden. Drei oder fünf Mitglieder haben sich in der Praxis als brauchbar herausgestellt. Die Mitglieder des Beirats sollten gewählt werden. Die überwiegende Mehrheit der Mitglieder sollte von externen Personen gestellt werden, um Problemen unter den Gesellschaftern nicht nur ein Forum zu errichten. Bei Freunden und Bekannten ist ebenso wie bei Gesellschaftern die Objektivität und nötige Distanz außerordentlich kritisch zu hinterfragen, zumal eine fachliche Kompetenz bei der Auswahl nur eine untergeordnete Rolle spielt. Ebenso mäßig geeignet scheinen daher Unternehmens- oder Steuerberater, Vertreter von Banken oder gar Geschäftspartner des Unternehmens. Maßgeblich für die Eignung als Beiratsmitglied kann letzendlich nur sein, ob der Kandidat über die benötigten persönlichen Eigenschaften verfügt, nämlich eine auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnittene Fachkompetenz, unternehmerische Qualität und Erfahrung, tiefes Verständnis für die spezifischen Gegebenheiten in Familienunternehmen, Unparteilichkeit und Zeit.
Abschließend sei noch angemerkt, daß sich der Erfolg in der Beiratsarbeit nicht von selbst einstellt. Er setzt, wie jeder unternehmerische Erfolg, die intensive Auseinandersetzung mit den Erfolgsvoraussetzungen, möglichen Hindernissen und der konsequenten Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse voraus. Er ist aber keineswegs unmöglich. Die große Zahl erfolgreich arbeitender Beiräte spornen zur Nachahmung an.
[...]
[1] Simon, Prof. Dr. Hermann, Simon, Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultans GmbH, Bonn, Vortrag USW Erftstadt, 1998
[2] vgl. Anlage 2
[3] May, Dr. Peter, INTES Gesellschaft für integrierte Eignerberatung mbH, Bonn, Vortrag USW Erftstadt 1998
[4] May, Dr. Peter, Vortrag USW Erftstadt 1998
[5] Simon, Prof. Dr. Hermann, Vortrag USW Erftstadt 1998
[6] vgl. Anlage 2
[7] Simon, Prof. Dr. Hermann, Vortrag USW Erftstadt 1998
[8] nach einer Untersuchung von Simon , Kucher & Partners
[9] Simon, Prof. Dr. Hermann, USW Erftstadt 1998
[10] Sabel, Prof. Dr. Hermann, Institut für Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften der Universität Bonn, Vortrag USW Erftstadt 1998
[11] Simon, Prof. Dr. Hermann, Vortrag USW Erftstadt 1998
[12] Untersuchung von Simon, Kucher & Partners
[13] Simon, Prof. Dr. Hermann, Vortrag USW Erftstadt 1998
[14] Simon, Prof. Dr. Hermann, Vortrag USW Erftstadt 1998
[15] Simon, Prof. Dr. Hermann, Vortrag USW Erftstadt 1998
[16] Untersuchung von Simon, Kucher & Partners
[17] Simon, Prof. Dr. Hermann, Vortrag USW Erftstadt 1998
[18] Pümpin. Prof. Dr. oec. Cuno, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule St. Gallen,
Ausarbeitung USW Erftstadt 1998, Auszüge
[19] Vgl. Pümpin, Cuno: Das Dynamikprinzip, Düsseldorf 1989
[20] Für eine ausführliche Typologie der Nutzenpotentiale siehe Pümpin, Cuno: Strategische Erfolgspositionen, Berlin, Stuttgart, Wien 1992, S. 19-22
[21] vgl. Train, Nick: The Midas Touch, New York 1988
[22] s. Pümpin, Cuno: Das Dynamikprinzip, Düsseldorf 1989, S. 240-250 für unternehmensbezogene
Risiken
[23] Analog zur Idee der SEP eines Unternehmens ist unter der SEP des Eigners eine durch den Aufbau von wichtigen und dominanten Fähigkeiten bewußt geschaffene Voraussetzung, durch die der Eigner langfristig überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen kann, zu verstehen; vgl. Pümpin, Cuno / Pritzl, Rudolf: Unternehmenseigner brauchen eine ganz besondere Strategie, Harvard-Manager III/91, S. 48
[24] May, Dr. Peter, Vortrag USW Erftstadt 1998
[25] May, Dr. Peter, Vortrag USW Erftstadt 1998
[26] May, ebenda
[27] May, Dr. Peter, Vortrag USW Erftstadt 1998
[28] May, Dr. Peter, Vortrag USW Erftstadt 1998
[29] Vortrag Bahlsen, lic. Oec. Werner Michael, Erftstadt 1998
[30] May, Dr. Peter, Vortrag USW Erftstadt 1998
[31] vgl. Anlage 8, 8.7: Der Verkauf an Dritte
[32] vgl. Anlage 8, 8.1: Verkauf eines Unternehmens gegen Einmalzahlung
[33] Stollmann, Jost, Vortrag USW Erftstadt 1998
[34] ehem. geschäftsführender Gesellschafter der Leopold Schoeller jr. & Cie., Düren (Textilbranche)
[35] Schoeller, Leopold, Vortrag USW Erftstadt 1998
[36] vgl. Anlage 8, 8.8: Übernahme durch das Management
[37] May, Dr. Peter, Vortrag USW Erftstadt 1998
[38] May, Dr. Peter, Vortrag USW Erftstadt 1998
[39] May, Dr. Peter, „Der Beirat im Familienunternehmen“, Ausarbeitung USW Erftstadt 1998, Auszüge
- Arbeit zitieren
- Martin Kraus (Autor:in), 1999, Nachfolgeregelung in mittelständischen Familienunternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4071
Kostenlos Autor werden



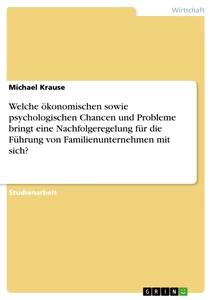



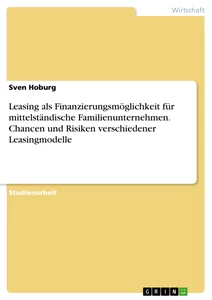








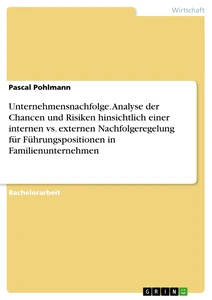





Kommentare